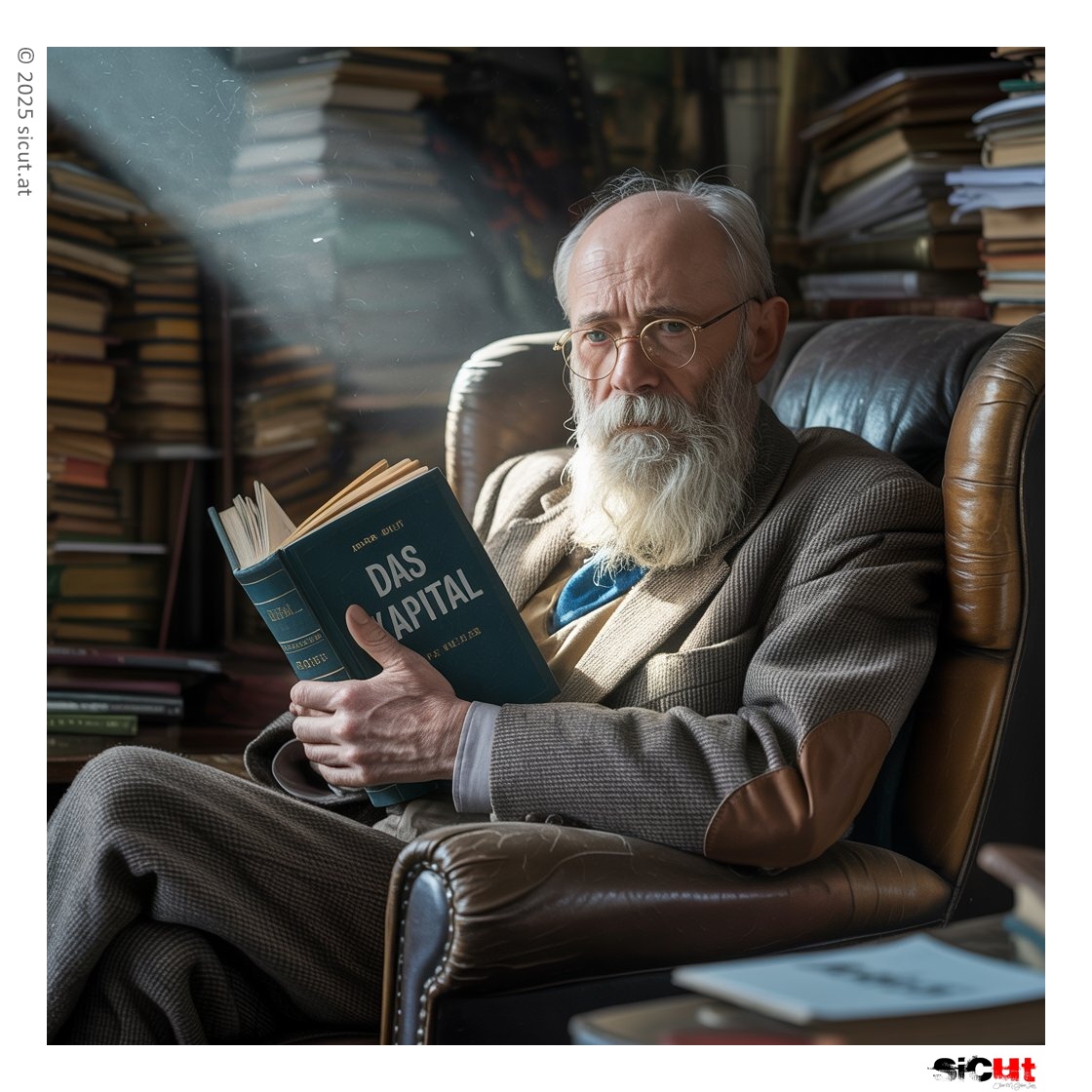Es gibt Momente in der Politik, in denen die pure, ungeschminkte Wahrheit so unvermittelt auf den Tisch knallt, dass man reflexartig nach einem Glas Wasser oder einem Beruhigungsmittel sucht – oder beides gleichzeitig. Die Äußerung von Saliha Raiss, sozialdemokratische Gemeinderätin in der Brüsseler Enklave Molenbeek, gehört in genau diese Kategorie. Ein Satz, so kurz wie ein Sprung, so scharf wie ein Rasiermesser, und doch in seiner unmittelbaren Wirkung ungefähr so subtil wie eine Atombombe in einem Porzellanladen: „Wörtlich sagte sie: „Wenn wir so viel stören, wenn man uns nicht mehr sehen will, möchte ich sagen: Die Region umfasst 19 Gemeinden; wenn es in Molenbeek anscheinend so unerträglich ist, ziehen Sie doch anderswohin, verschwinden Sie.“
Hier wird nicht nur ein Argument formuliert, hier wird ein epochales Lehrstück in der Kunst des Ausblendens von Dummheit gegeben. Raiss, die als Kind von Einwanderern in Molenbeek aufwuchs und deren Kopftuch im öffentlichen Raum zur selbstverständlichen Selbstverständlichkeit geworden ist, richtet sich gegen die puritanische Ekstase jener, die glauben, Neutralität ließe sich durch das Verbot eines Stoffstreifens erzwingen. Es ist ein kleiner Stoff, der so viel Aufruhr stiftet wie eine Sandkornlawine im Sandkasten der europäischen Moral. Und die Pointe, die hier übersehen wird: Man kann nicht überall sein, man kann nicht alles sehen, aber man kann sehr wohl verschwinden.
Die Kunst des „Anderswohin“ und die Trivialität der Empörung
Die Empörung, die auf Raiss’ Worte folgte, wirkt fast schon mechanisch, als hätte jemand den Automatismus der Entrüstung programmiert: Kopftuch – Verbot – Skandal – Shitstorm – empörte Politikerposen. Man könnte meinen, die ganze westliche Zivilisation sei nur noch ein Theaterstück, in dem jede Geste, jede Haarsträhne, jeder Stofffetzen als Subtext von Verrat oder Unterwerfung gelesen werden müsse. Und in diesem Theaterstück, ach, spielt Molenbeek die Rolle des Bösewichts, des unzivilisierten Außenseiters, der sich nicht dem Diktat der Sichtbarkeit unterwirft.
Doch genau hier liegt die Brillanz von Raiss’ Intervention: Sie entzieht dem Streit die Schärfe. Wer sich belästigt fühlt, der darf sich wegbewegen. Wer glaubt, Neutralität sei gleichbedeutend mit Zensur, der hat die Wahl – aber Molenbeek ist nicht verhandelbar. Es ist ein Vorschlag, der mehr ist als eine politische Position: es ist eine Lebensphilosophie, eine Einladung, die eigene Bedeutung zu überdenken, während man seine Koffer packt. „Verschwinden Sie“ – selten hat eine Aufforderung so lakonisch und gleichzeitig so existenziell das Verhältnis von Freiheit und Zwang auf den Punkt gebracht.
Humor als Waffe und Zynismus als Schild
Natürlich könnte man sich über den Tonfall echauffieren. Wie kann man nur so derb, so unverblümt, so unpolitisch korrekt sprechen? Doch der Humor in Raiss’ Formulierung ist keine bloße Verzierung, keine frivole Pointe, die man lächelnd abnickt. Er ist eine Waffe und ein Schild zugleich. In einer Zeit, in der politische Debatten oft von zermürbender Heuchelei und vorgetäuschter Sachlichkeit geprägt sind, ist das Augenzwinkern fast schon revolutionär. Es zeigt: Man kann sich der intellektuellen Auseinandersetzung stellen, ohne in der Falle der moralischen Unterwürfigkeit zu landen. Zynismus hier ist nicht Resignation, sondern scharfsinnige Abwehr gegen die allzu menschliche Neigung, andere für die eigene Unzulänglichkeit zu bestrafen.
Molenbeek als Spiegel: Wer bleibt, wer geht
Und schließlich reflektiert dieser kurze, giftige Satz eine größere Wahrheit: Die Gesellschaft hat die Wahl. Sie kann sich verbeugen vor der Illusion von Uniformität, vor der Diktatur des Sehens und Verstehens, vor der Angst vor Anderssein – oder sie kann akzeptieren, dass Vielfalt mehr ist als ein Feigenblatt der Toleranz, dass Unterschiede existieren, ohne dass jeder gleichmachen muss. Raiss’ „verschwindet doch“ ist keine Provokation, sondern eine Einladung, sich selbst zu überprüfen: Wer bleibt, wer geht, wer kann wirklich die Welt verstehen, und wer lebt nur in der Projektion seiner eigenen Unzulänglichkeit?
Am Ende bleibt die Erkenntnis, bitter wie ein Espresso und süß wie belgische Schokolade zugleich: Molenbeek ist nicht das Problem. Molenbeek ist der Spiegel. Und wer sich im Spiegel nicht ertragen kann, dem bleibt nur das Anderswohin. Ob das tragisch, lächerlich oder befreiend ist, entscheidet jeder selbst. Raiss hat die Karten auf den Tisch gelegt, die Figur gesetzt, den Vorhang gelüftet – und nebenbei die Absurdität einer Debatte offengelegt, die vielleicht nie politisch, aber immer komisch war.