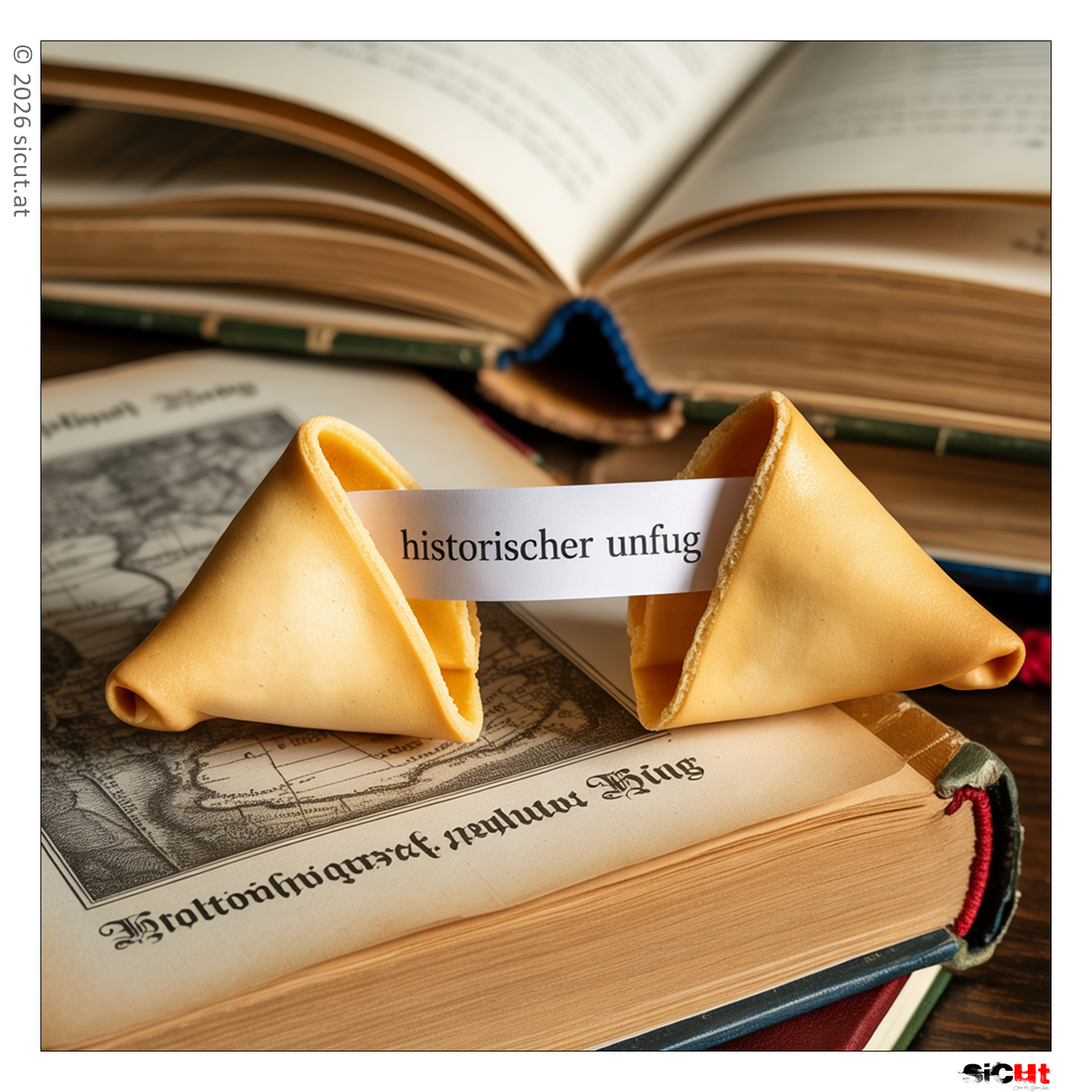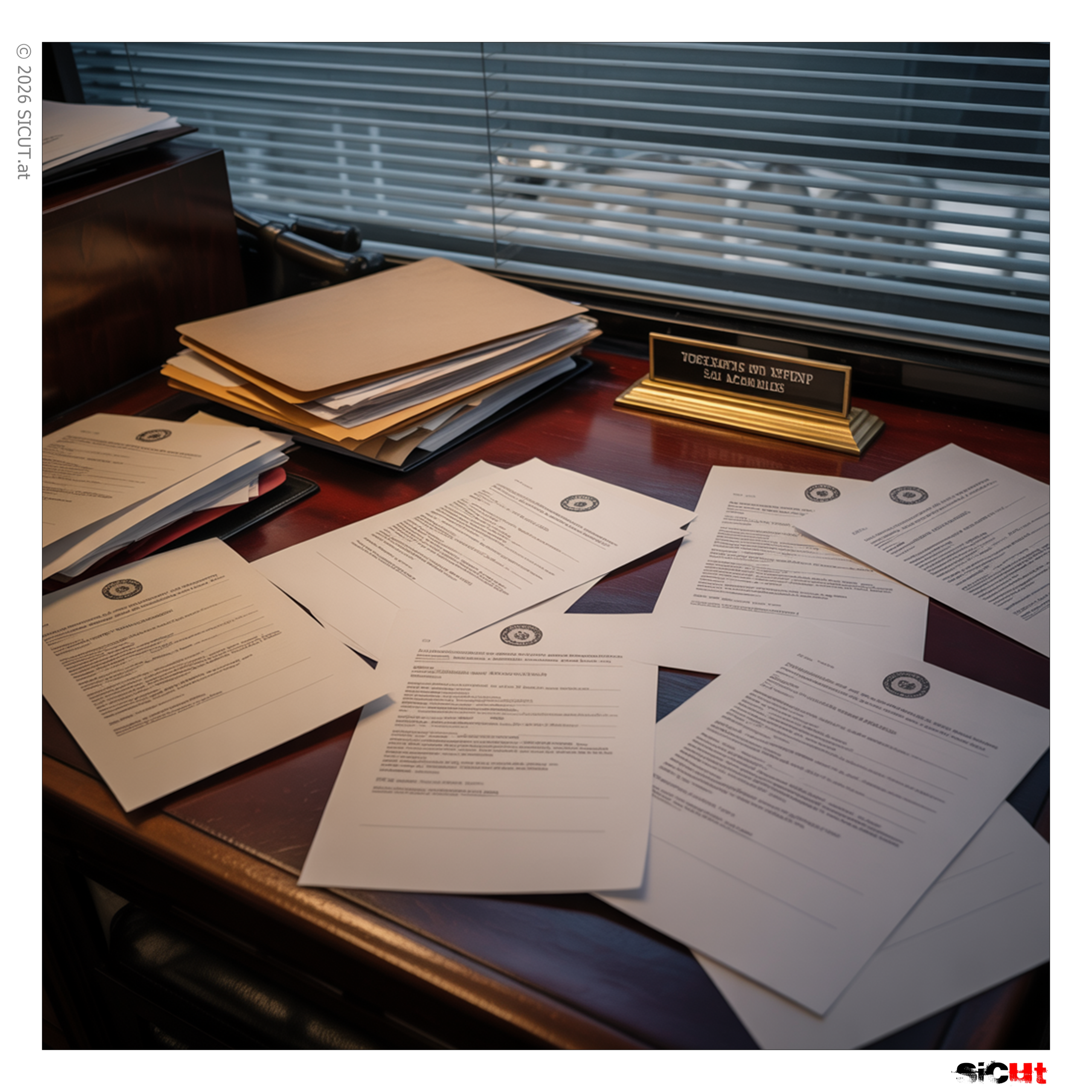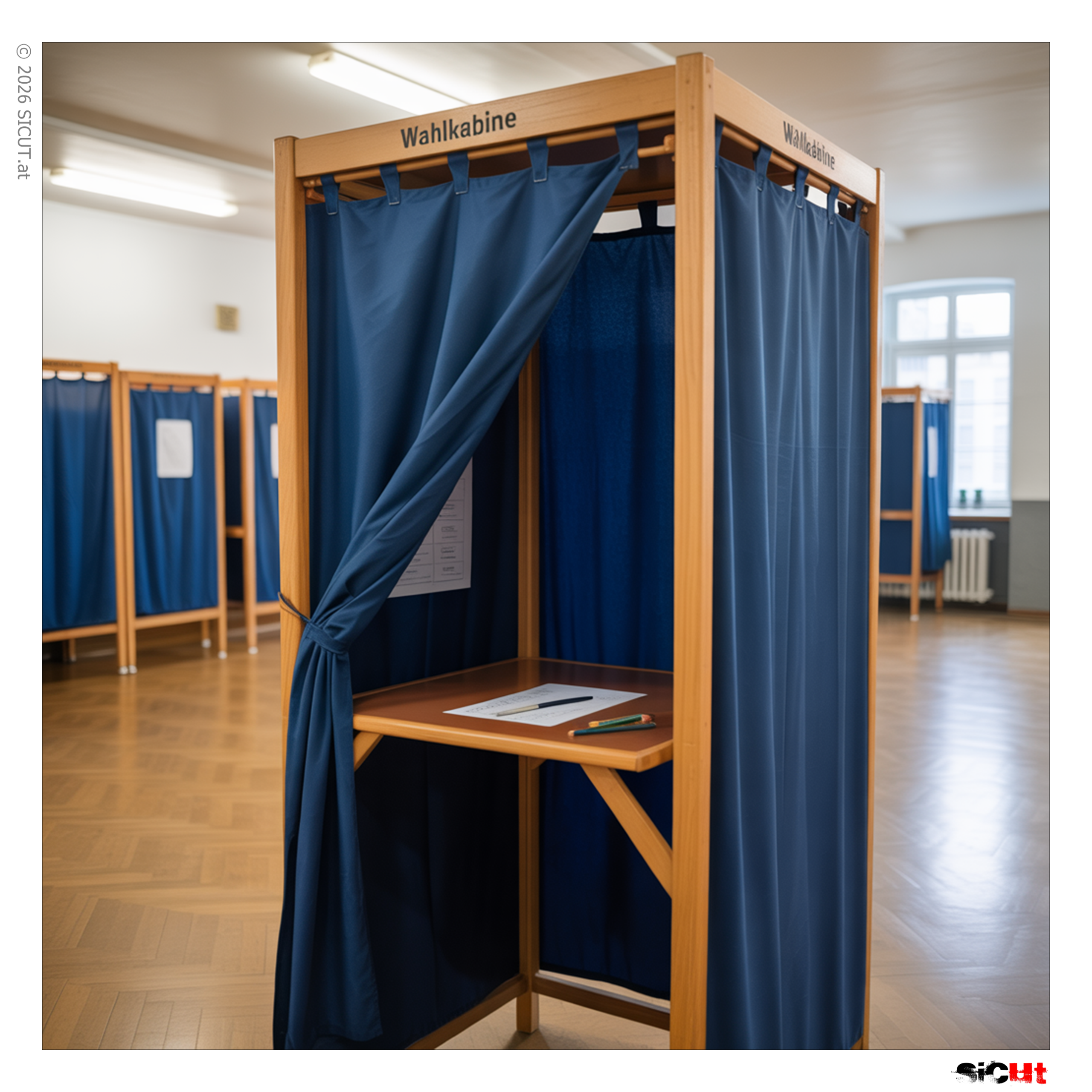oder Die ernste Leichtfertigkeit des moralischen Vorschlaghammers
Es gibt Sätze, die klingen zunächst wie ein schlecht gelaunter Kalauer aus der Kantine eines politikwissenschaftlichen Instituts, irgendwo zwischen verkochtem Kaffee und der resignierten Erkenntnis, dass man für Drittmittel inzwischen auch ein Seminar über „Narrative Fluidität im Postfaktischen“ anbieten muss. „Mit Auschwitz kann man natürlich auch viel Unfug treiben, indem man es politisch instrumentalisiert.“ Natürlich kann man das. Man kann mit allem Unfug treiben — mit Geschichte, mit Sprache, mit Erinnerung, mit der eigenen Großmutter, sofern sie nicht schnell genug aus dem Zimmer rollt, wenn die Talkshow beginnt. Aber dass man es kann, ist bekanntlich kein Argument dafür, dass man es sollte. Und doch leben wir in einer Epoche, die das moralische Dynamit vergangener Katastrophen gern als handlichen Taschenknallkörper mit sich herumträgt, bereit, ihn bei jeder Gelegenheit unter den rhetorischen Konferenztisch zu werfen, nur um anschließend empört aufzuschreien, wie laut es doch geknallt habe.
Herr Lüders — hier weniger als konkrete Person denn als Typus, als Archetyp des weltläufigen Erklärers mit Stirnfalte — wirkt dabei wie der Klassenclown im Seminarraum der Geschichte, allerdings einer, der seine Späße mit einer erstaunlichen Gravität vorträgt. Das ist eine besondere Kunstform: der Scherz mit ernster Miene, das ironische Augenzwinkern, das so subtil ist, dass es niemand bemerkt und alle glauben, man meine es bitterernst. Denn Auschwitz ist, um es einmal in einer schockierend nüchternen Untertreibung zu sagen, kein gewöhnliches Argument. Es ist der Mount Everest der historischen Singularität — und wer ihn als Wanderhügel behandelt, sollte sich nicht wundern, wenn ihm irgendwann die dünne Luft der Differenzierung ausgeht.
Die Inflation des Absoluten
Wir leben bekanntlich in Zeiten der Inflation. Nicht nur die Butter kostet mehr, auch das moralische Kapital wird täglich großzügig gedruckt. Jeder Konflikt ist „beispiellos“, jede politische Maßnahme „ein Angriff auf die Zivilisation“, und irgendwo findet sich garantiert jemand, der mit bebender Stimme fragt, ob „wir nichts gelernt haben“. Was genau gelernt wurde, bleibt meist so unklar wie die Bedienungsanleitung eines Multifunktionsdruckers, aber der Hinweis genügt, um sich selbst auf die Seite der historischen Wachsamkeit zu stellen — ein Ort, von dem aus man hervorragend auf andere herabblicken kann.
Die Instrumentalisierung von Auschwitz funktioniert dabei wie eine moralische Universalfernbedienung: Man richtet sie auf ein beliebiges Thema, drückt auf „Empörung“, und sofort schaltet sich der Diskurs in den Katastrophenmodus. Differenzierung? Leider gerade nicht lieferbar. Kontext? Ausverkauft. Historische Proportionen? Wurden aus Rationalisierungsgründen abgeschafft.
Das Absurde daran ist nicht einmal, dass Vergleiche gezogen werden — der menschliche Geist denkt nun einmal analogisch —, sondern mit welcher atemberaubenden Sorglosigkeit sie gezogen werden. Zwischen einer unliebsamen Gesetzesänderung und industriellem Massenmord liegt ungefähr dieselbe Distanz wie zwischen einem Papierschnitt und der Explosion eines Vulkans, aber in der Rhetorik mancher Debatten schrumpft diese Strecke auf Spaziergangsniveau. Man trifft sich gewissermaßen am Kraterrand zum Brunch.
Moral als Mehrzweckwerkzeug
Auschwitz ist längst zu einer Art moralischem Schweizer Taschenmesser geworden. Man kann damit warnen, anklagen, relativieren, sich selbst erhöhen oder — besonders beliebt — den Gegner endgültig delegitimieren. Wer den Vergleich gewinnt, gewinnt die moralische Oberliga; wer ihn verliert, darf sich glücklich schätzen, nicht gleich ins rhetorische Aus befördert zu werden.
Das Problem ist nur: Je häufiger man zum äußersten historischen Vergleich greift, desto stumpfer wird er. Das Absolute verträgt keine Dauerverwendung. Wenn alles „wie damals“ ist, dann ist am Ende nichts mehr wie damals — außer der erschreckenden Erkenntnis, dass Erinnerung offenbar auch verschleißen kann.
Hier liegt der eigentliche Zynismus unserer Gegenwart: Man beteuert unablässig die Unvergleichbarkeit des Holocaust und vergleicht gleichzeitig mit einer Begeisterung, die sonst nur bei Schlussverkäufen zu beobachten ist. „Nur heute! Historische Analogien zum Sonderpreis!“ Man möchte den Lautsprecher ausschalten, aber er gehört inzwischen zur Grundausstattung des öffentlichen Raums.
Der diskursive Jahrmarkt
Man stelle sich einen Jahrmarkt vor, auf dem historische Tragödien als Attraktionen betrieben werden. „Treten Sie näher! Hier sehen Sie die größte moralische Keule des Kontinents! Garantiert diskursentscheidend!“ Daneben verkauft jemand Zuckerwatte der Empörung, und ein selbsternannter Experte erklärt mit gewichtiger Stimme, dass man jetzt aber wirklich „die richtigen Lehren“ ziehen müsse — welche genau, wird nach der Werbepause erläutert.
In diesem Spektakel wirkt der Satz über den „Unfug“ beinahe wie ein unfreiwillig ehrlicher Moment. Ja, Unfug ist ein treffendes Wort — gerade weil es so harmlos klingt. Es erinnert an Kinder, die mit Konfetti werfen, nicht an Erwachsene, die mit historischen Abgründen hantieren. Doch vielleicht ist genau das die Pointe: Die politische Kultur hat stellenweise etwas erschreckend Kindliches angenommen. Man wirft mit großen Worten, ohne ihr Gewicht tragen zu wollen.
Und währenddessen sitzt die Geschichte irgendwo am Rand, leicht fassungslos, und fragt sich, wann sie eigentlich zur Requisite geworden ist.
Erinnerung ohne Pathos und ohne Zirkus
Es wäre allerdings zu einfach, nur auf die „Instrumentalisierer“ zu zeigen — ein herrlich bürokratisches Wort, das klingt, als gäbe es dafür ein Formular in dreifacher Ausfertigung. Denn hinter der ständigen Bezugnahme steckt auch eine ehrliche Angst: die Angst vor dem Vergessen, vor der Wiederholung, vor der bequemen Amnesie einer Gesellschaft, die sich lieber mit Streamingempfehlungen beschäftigt als mit den dunklen Kapiteln ihrer selbst.
Doch zwischen Erinnern und Ausbeuten verläuft eine feine, entscheidende Linie. Erinnern bedeutet, die historische Einzigartigkeit auszuhalten, ohne sie in den Dienst aktueller Schlagabtausche zu pressen. Es verlangt eine gewisse Demut — jene altmodische Haltung, die im Zeitalter der Dauermeinung ungefähr so populär ist wie Wählscheibentelefone.
Vielleicht müsste man sich darauf verständigen, dass Auschwitz kein Argument ist, sondern eine Grenze. Kein rhetorischer Verstärker, sondern ein stiller Maßstab. Etwas, das weniger nach schnellen Analogien ruft als nach langsamer Reflexion — ein Tempo, das in Talkshows ungefähr die Überlebenschancen einer Schnecke auf der Autobahn hat.
Schluss ohne Pointe, aber mit Haltung
Am Ende bleibt eine unbequeme Einsicht: Die größte Respektlosigkeit gegenüber der Geschichte besteht nicht im offenen Vergessen, sondern in ihrer routinierten Verwendung. Wer das äußerste Grauen zum alltäglichen Vergleich macht, reduziert es — nicht aus Bosheit, oft aus gedankenloser Gewohnheit. Doch Gewohnheit ist bekanntlich der elegante Cousin der Gleichgültigkeit.
Der augenzwinkernde Humor, wenn es denn einen geben darf, liegt vielleicht darin, dass wir uns für ungeheuer aufgeklärt halten und doch immer wieder in dieselbe Falle tappen: Wir glauben, moralische Größe zeige sich in der Lautstärke unserer historischen Bezüge, statt in der Sorgfalt, mit der wir sie vermeiden.
Und so könnte man Herrn Lüders — oder dem inneren Lüders in uns allen — freundlich zurufen: Ja, mit Auschwitz lässt sich viel Unfug treiben. Vielleicht wäre es daher an der Zeit, etwas weniger zu treiben und etwas mehr zu verstehen. Das wäre einmal ein wirklich geschmackvoller Scherz — einer, bei dem niemand lachen muss, weil alle begriffen haben, worum es geht.