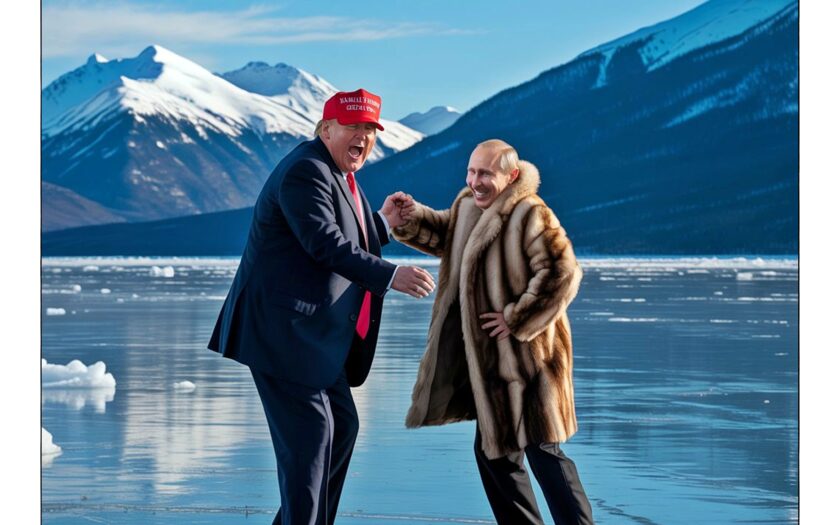Revolution der Sonne oder Märchenstunde der Windräder?
„Wind und Sonne könnten Öl und Gas in den kommenden 25 Jahren komplett verdrängen.“ So frohlockt Herr Tim Meyer, der deutsche Energieexperte mit dem Optimismus eines Zehnjährigen, der gerade sein erstes Einhorn gesehen hat. Die Worte klingen wie ein Werbeslogan für eine neue Disney-Produktion: „Energie ohne Ende – powered by Regenbogen!“ Doch wer sich ein wenig mit den nüchternen Realitäten der Elektrizitätsversorgung beschäftigt hat, kann nicht anders, als an der Stirn zu reiben. Dunkelflaute? Grundlast? Schwarzstartfähigkeit? All diese Begriffe, die wie verbotene Runen in der heiligen Hallen der „Erneuerbare-Alles-ist-Möglich“-Propheten klingen, scheinen in Meyers visionärer Utopie schlichtweg nicht existieren. Offenbar reicht es, die Sonne anzubeten und dem Wind ein paar motivierende Tweets zu schicken, dann löst sich jedes Energieproblem in Wohlgefallen auf.
Man könnte fast meinen, wir stünden mitten in einer industriellen Revolution, nur dass diese Revolution offenbar komplett auf Wunschdenken basiert. Historisch gesehen haben Revolutionen ihre Energie eher in Maschinen und Dampfmaschinen gesteckt – heute soll sie plötzlich aus Solarpaneelen kommen, die zwischen Sonnenbrand und Regenguss pendeln. Und während wir noch darüber nachdenken, wie man ein Stromnetz stabil hält, das auf dem Launenhaftesten aller Energieträger basiert, suggeriert Herr Meyer, dass Monsterbatterien schon bald wie Manna vom Himmel fallen werden. Dass diese Batterien nicht nur gigantische Mengen Lithium, Kobalt und Seltene-Erden-Magie benötigen, sondern auch eine Logistik, die selbst ein Schweizer Uhrwerk alt aussehen lässt, wird elegant ausgeblendet.
Der Tanz auf der Dünnen Leitung
Es ist faszinierend, wie unser kollektiver Glaube an die „Energiewende“ inzwischen einem religiösen Dogma gleicht. E-Autos werden fahren, KI wird rechnen, Wärmepumpen werden heizen – und dabei wird irgendwie genug Strom übrig bleiben, um die Grundlast zu decken. Dass die Realität weniger romantisch ist, stört den Enthusiasten kaum: Wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint und die Batterien leer sind, wird das Netz schon improvisieren. Schwarzstart? Ach, wir improvisieren lieber mit Spotify-Playlisten für die Stromausfall-Partys. Degroth, der Name eines mystischen Messias der Energiewirtschaft, wird uns schon retten.
Es gibt eine charmante Naivität in diesem Denken, die fast bewundernswert ist: Warum sich mit langweiligen physikalischen Gesetzmäßigkeiten aufhalten, wenn man einfach Hoffnung verkaufen kann? Die Industrie freut sich, die Politik applaudiert, und der Bürger staunt, während die wahren Ingenieure in stiller Verzweiflung die Stirn runzeln. In dieser Welt ist die Dunkelflaute ein Schreckgespenst aus alten Lehrbüchern, Grundlast eine lästige Fußnote, und Speichertechnologien das Äquivalent von Hogwarts-Zauberei.
Ironie als letzte Energiequelle
Vielleicht ist es gar nicht so falsch, diesen Enthusiasmus mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Denn wer sich vorstellt, dass wir in 25 Jahren wirklich ohne Öl und Gas auskommen, während wir gleichzeitig den Energiehunger von Millionen E-Autos, Milliarden KI-Operationen und unzähligen Smart-Home-Geräten decken müssen, könnte durchaus ins Grübeln kommen. Oder in ein ironisches Lachen ausbrechen. Die Hoffnung auf eine totale Solar- und Windrevolution ist nicht per se falsch, aber sie sollte nicht die einzige Leitlinie für unsere Energiepolitik sein. Sonst enden wir in einer Welt, in der wir im Sommer überquellende Solarpaneele haben und im Winter Kerzenlicht-Partys veranstalten – romantisch, aber nur bedingt praktikabel.
Und so bleibt uns die stille Bewunderung für die Visionäre, die glauben, dass der Strom einfach aus der Luft kommt – mit dem Wissen, dass die Realität, wie immer, unbeirrbar ihren eigenen Takt schlägt. Zwischen Polemik, Zynismus und Augenzwinkern dürfen wir uns vielleicht noch an der Hoffnung festhalten, dass Menschheit und Stromnetz eines Tages zusammen tanzen – hoffentlich nicht auf dünner Leitung.