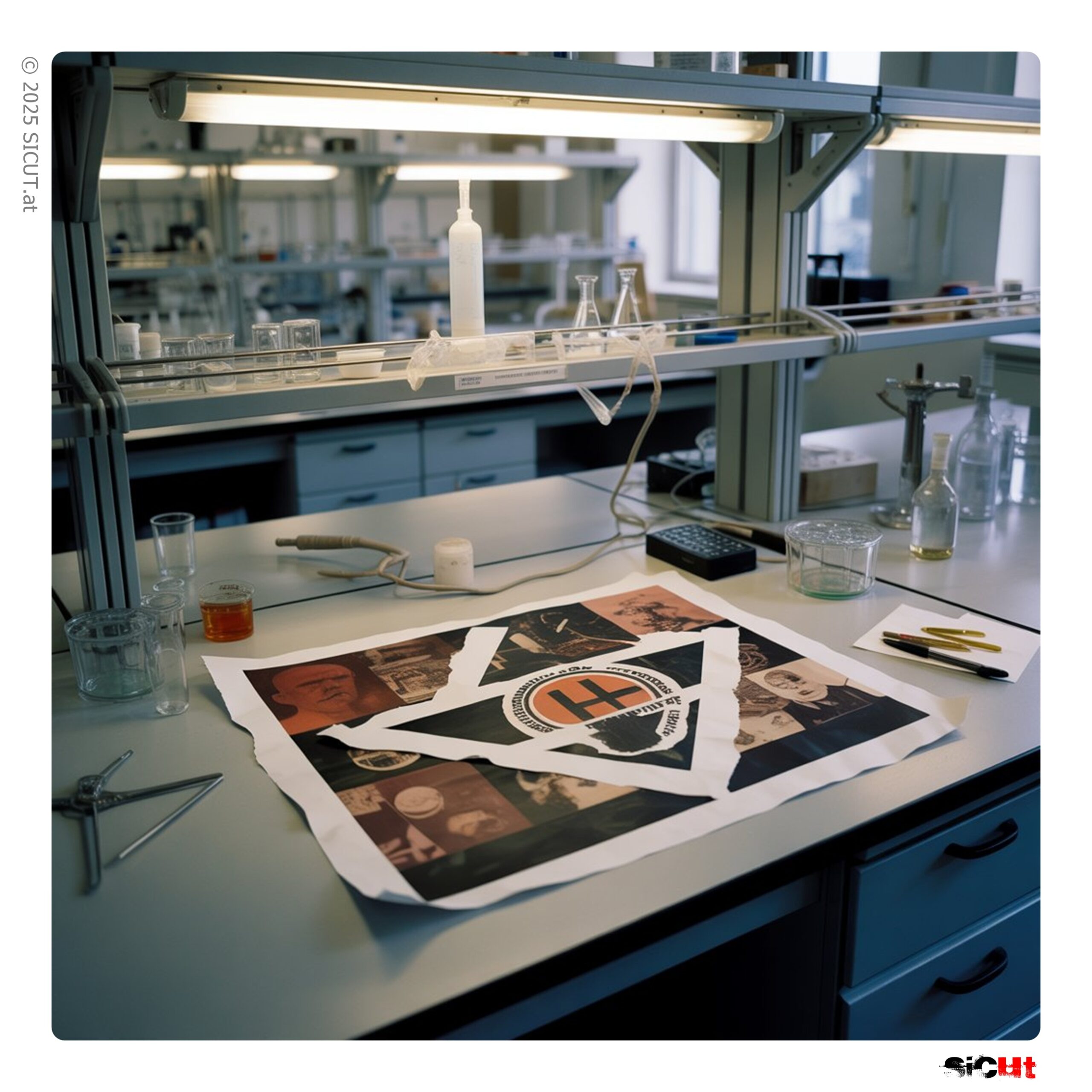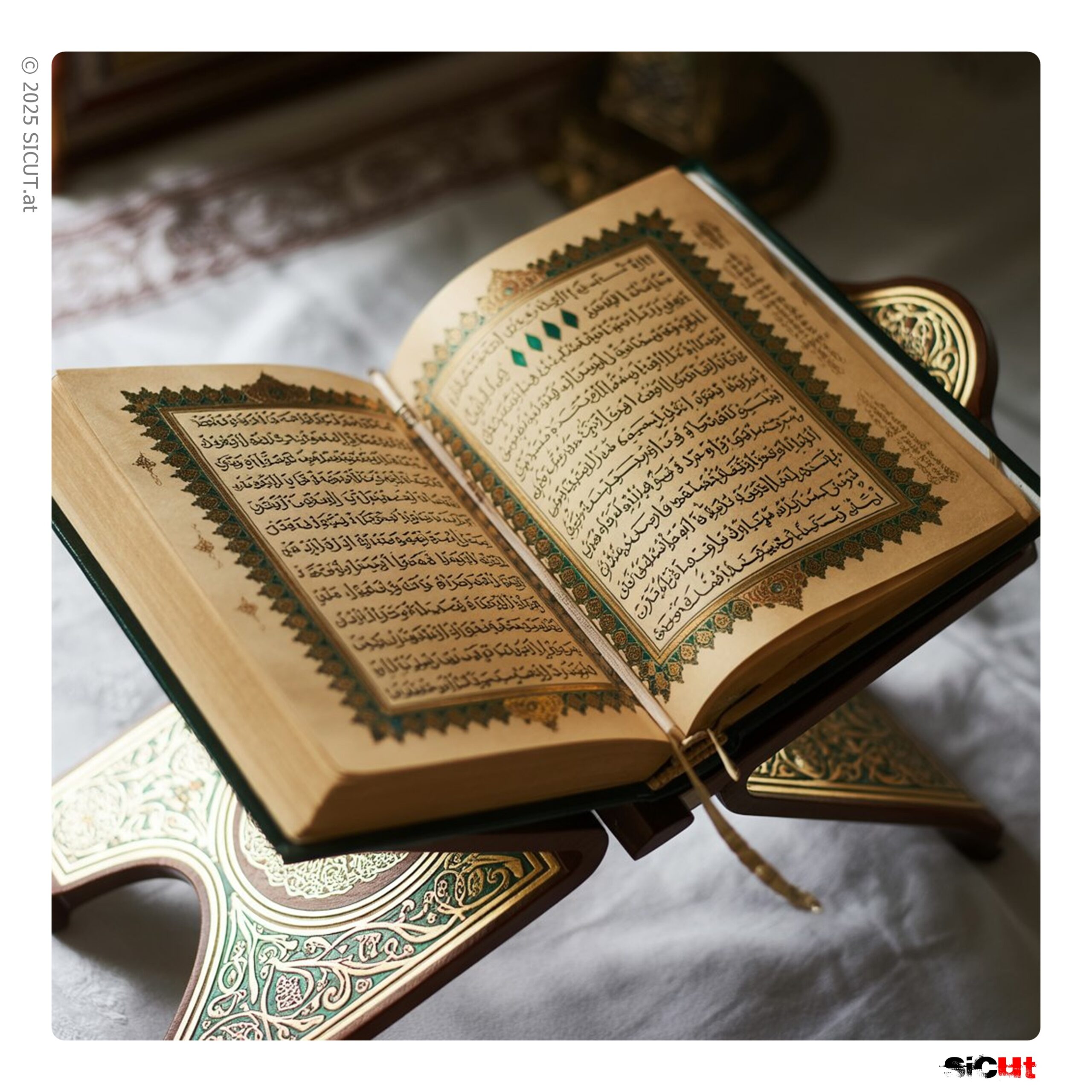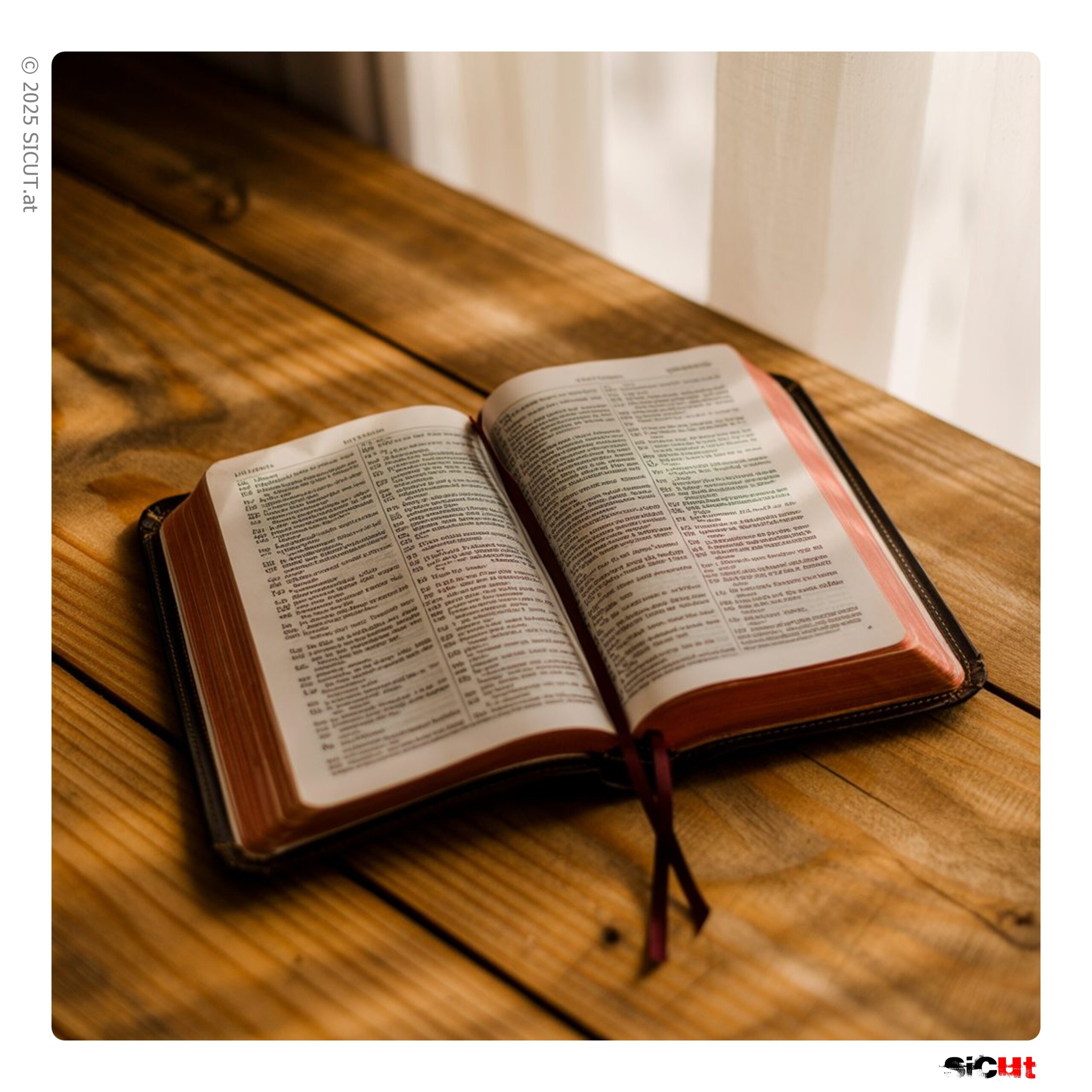Wenn der Holocaust zur rhetorischen Knetmasse wird
Was das Landgericht Berlin hier abliefert, ist keine bloße Fehlentscheidung, kein bedauerlicher Ausrutscher im juristischen Betrieb, sondern ein Akt geistiger Selbstentkernung, der seinesgleichen sucht. Der Holocaust, einst der moralische Nullpunkt deutscher Geschichte, wird in diesem Urteil nicht relativiert – nein, er wird verdünnt, vernebelt, semantisch aufgekocht, bis er als geschmacklose Brühe übrig bleibt, in der jede politische Erregung nach Belieben ihre Zutaten versenken darf. Dass eine Richterbank ernsthaft erklären kann, die Formel „Holocaust in Gaza“ sei keine Verharmlosung des Holocausts, ist nicht nur juristisch gewagt, sondern historisch obszön. Es ist, als würde man erklären, der Begriff „Sklaverei“ verliere nichts von seiner Bedeutung, wenn man ihn auf schlechte Arbeitsbedingungen im Homeoffice anwendet – ein Vergleich, der so grotesk ist, dass er eigentlich nur als Satire durchgehen dürfte. Doch hier ist er Teil der Rechtswirklichkeit.
Artikel 5 Grundgesetz als intellektuelle Nebelmaschine
Die Meinungsfreiheit wird in diesem Urteil behandelt wie eine sakrale Monstranz, hinter der man alles verstecken kann, was man nicht mehr begründen möchte. Artikel 5 GG, einst Bollwerk gegen autoritäre Zumutungen, wird hier zur Nebelmaschine, die jede begriffliche Unsauberkeit in verfassungsrechtlichen Dampf hüllt. Dass Meinungsfreiheit nicht schrankenlos ist, dass sie gerade dort endet, wo die Würde von Opfern historischer Verbrechen zur Verhandlungsmasse wird, scheint im Berliner Gerichtssaal als altmodische Petitesse gegolten zu haben. Stattdessen triumphiert eine Auslegung, nach der die subjektive Empörungsabsicht der Sprecherin schwerer wiegt als der objektive Bedeutungsgehalt ihrer Worte. Wer sich moralisch im Recht fühlt, darf offenbar sprachlich alles – ein Freibrief, der weniger an liberale Rechtsstaatlichkeit erinnert als an die Logik politischer Erregungskollektive.
Die semantische Gleichsetzung als moralisches Verbrechen zweiter Ordnung
Denn machen wir uns nichts vor: Der Holocaust ist nicht einfach „ein Völkermord unter anderen“, nicht bloß ein historischer Referenzpunkt im Werkzeugkasten politischer Metaphorik. Er war ein staatlich organisierter, industriell betriebener Vernichtungsprozess, getragen von einer eliminatorischen Ideologie, die keinen Ausweg, keine Kapitulation, kein Überleben vorsah. Wer diesen Begriff auf einen asymmetrischen Krieg überträgt, mag subjektiv Empörung artikulieren – objektiv aber begeht er eine Gleichsetzung, die das historische Verbrechen entkernt. Dass ein deutsches Gericht dies nicht erkennt oder nicht erkennen will, ist kein Ausdruck von Sensibilität, sondern von moralischer Abstumpfung. Die Relativierung liegt nicht darin, den Holocaust kleinzureden, sondern darin, ihn überall hineinzuschreiben, bis er nichts Besonderes mehr ist.
Die politische Schlagseite des juristischen Feingefühls
Besonders unerquicklich wird das Ganze dort, wo man die politische Asymmetrie nicht mehr übersehen kann. Dieselben juristischen Instanzen, die hier mit spitzen Fingern jede mögliche Einschränkung der Meinungsfreiheit vermeiden, reagieren erfahrungsgemäß allergisch, wenn NS-Analogien aus dem rechten Spektrum kommen. Dann ist die historische Verantwortung plötzlich glasklar, die Grenze des Sagbaren scharf gezogen, der Strafrahmen schnell zur Hand. Man denke an Verfahren wegen vergleichsweise banaler Schmähungen, Stichwort „Schwachkopf“, bei denen der Staat seine Autorität mit bemerkenswerter Entschlossenheit verteidigt hat. Dass ausgerechnet beim Holocaust-Vergleich eine derartige Großzügigkeit herrscht, legt den Verdacht nahe, dass hier weniger rechtsstaatliche Prinzipien wirken als politisch-moralische Sympathien.
Die infantile Logik der guten Absicht
Das Urteil folgt einer Logik, die man aus sozialen Netzwerken kennt, nicht aus Gerichtssälen: Wenn die Absicht gut ist, kann die Wirkung nicht schlecht sein. Die Aktivistin wollte auf ziviles Leid aufmerksam machen, also kann ihre Wortwahl nicht problematisch sein – so etwa die implizite Argumentation. Doch Rechtsprechung, die sich an Absichten statt an Bedeutungen orientiert, verabschiedet sich von jeder objektiven Norm. Dann zählt nicht mehr, was gesagt wird, sondern wer es sagt und wofür. Das ist keine liberale Offenheit, das ist Gesinnungsjurisprudenz mit humanitärem Anstrich.
Die Satire, die keine mehr ist
Man könnte über all das lachen, wenn es nicht so unerquicklich ernst wäre. Ein Gericht, das erklärt, „Holocaust in Gaza“ sei keine Holocaust-Verharmlosung, liefert Stoff für bitterste Satire, für eine Groteske über den postmodernen Umgang mit Geschichte. Doch der Witz verpufft angesichts der Konsequenzen: Der Holocaust wird zum rhetorischen Universaljoker, Meinungsfreiheit zum moralischen Freifahrtschein, und die historische Verantwortung Deutschlands zu einer optionalen Fußnote. Wer das kritisiert, gilt als humorlos, als autoritär, als Diskursverhinderer – ein bequemes Etikett für alle, die Präzision und Maß einfordern.
Schlussakkord in Moll: Der Rechtsstaat als Zauberlehrling
Dieses Urteil ist kein Triumph der Freiheit, sondern ein Dokument der Hilflosigkeit. Ein Rechtsstaat, der den Holocaust nicht mehr als begriffliche rote Linie verteidigt, sondern ihn in den freien Verkehr politischer Polemik entlässt, verhält sich wie der Zauberlehrling, der die Geister rief und nun nicht mehr loswird. Meinungsfreiheit ohne historisches Bewusstsein ist keine Tugend, sondern Fahrlässigkeit. Und ein Gericht, das diese Fahrlässigkeit adelt, trägt nicht zur Aufklärung bei, sondern zur endgültigen Banalisierung des größten Verbrechens der deutschen Geschichte. Das ist scharf zu kritisieren – nicht trotz, sondern gerade im Namen eines ernst gemeinten Liberalismus.