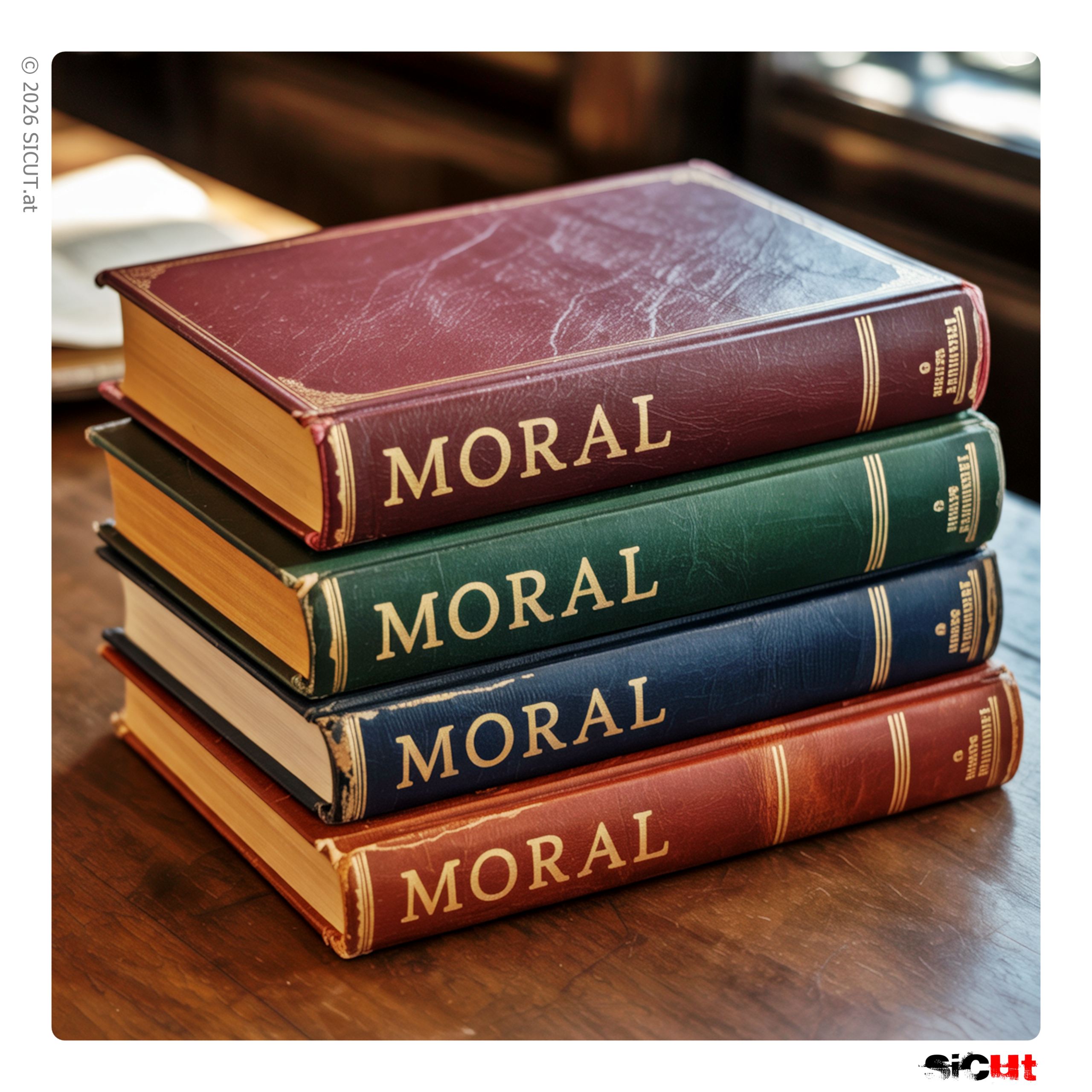Es gibt politische Dokumente, die sich lesen wie Gebrauchsanweisungen für Staubsauger: sachlich, nützlich, schnell vergessen. Und es gibt jene Papiere, die mit der stillen Anmaßung auftreten, nicht weniger als die Welt neu zu sortieren – mit dem Tonfall einer Behörde, aber der Ambition einer Heilslehre. Die neue „A Union of Equality: Anti-Racism Strategy 2026–2030“, am 20. Januar 2026 von der EU-Kommission vorgelegt, gehört eindeutig zur zweiten Kategorie: ein 20-seitiger, glatt polierter Kompaktspiegel dessen, was man in Brüssel für Fortschritt hält, und was draußen in den Mitgliedstaaten dann als „modernes Regieren“ in die Aktenordner einsickert, bis es irgendwann wie Naturrecht wirkt. Nicht, weil es demokratisch erkämpft wäre, sondern weil es sauber operationalisiert wurde. Denn in der Europäischen Union ist Macht selten ein Befehl – sie ist ein Formular, eine Leitlinie, ein „compendium of good practices“, ein Monitoring-Mechanismus, ein Förderkriterium, ein Indikator, der in Tabellenblättern so tut, als wäre er bloße Statistik, während er in Wahrheit Normsetzung betreibt. Wer sich darüber wundert, hat die EU nie verstanden: Sie ist weniger ein Staat als eine Maschine zur Herstellung von Selbstverständlichkeit. Und wenn diese Maschine auf Antirassismus umgestellt wird, dann ist nicht die Frage, ob Antirassismus nötig ist – das ist trivial –, sondern welche Art von Antirassismus hier zur Standardausgabe erklärt wird: Rechtsgleichheit als liberale Minimalethik oder Gerechtigkeit als dauerhafte gruppenbezogene Steuerung mit dem Charme eines moralischen Betriebssystems, das sich regelmäßig updatet, während man schläft.
Hadja Lahbib trägt die Hauptverantwortung, und allein ihre Ressortkonstruktion – Resilienz, humanitäre Hilfe, Krisenmanagement sowie Gleichstellung – ist bereits eine kleine politische Erzählung: Antirassismus nicht als Randthema, sondern als Sicherheitsarchitektur, als Stabilitätsmanagement, als gesellschaftliches Katastrophenschutzprogramm. Wer Gleichstellung und Krisenmanagement in einem Portfolio vereint, sagt implizit: Ungleichheit ist ein Notfall; und der Notfall ist dauerhaft. Das ist ein genialer Kunstgriff, denn was dauerhaft Notfall ist, darf dauerhaft gesteuert werden – ohne jemals zugeben zu müssen, dass es Steuerung ist. Und während man noch darüber diskutiert, ob das nun „woke“ oder „notwendig“ sei, sitzt die EU bereits an dem, was sie wirklich interessiert: der Verwaltung des Problembegriffs. Wer die Begriffe kontrolliert, kontrolliert die Wirklichkeit. Wer die Wirklichkeit kontrolliert, kontrolliert die Mittel. Und wer die Mittel kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. So unspektakulär ist das – und so wirkmächtig.
Der Ursprung der Erweckung: George Floyd als europäischer Gründungsmythos
Der Vorgängerplan 2020–2025 markierte, wie die Kommission selbst gern sagt, einen „historischen Wendepunkt“ – und tatsächlich ist dieser Wendepunkt weniger eine juristische Neuerung als eine kulturelle Selbstverortung: Europa, das nach Jahrzehnten gepflegter Selbstbespiegelung als Kontinent der Aufklärung, Menschenrechte und „Nie wieder“ plötzlich merkt, dass die große moralische Dramaturgie nicht mehr von innen kommt, sondern aus den Vereinigten Staaten importiert wird, verpackt als globale Black-Lives-Matter-Bewegung. Der Tod von George Floyd wird zum europäischen Impulsgeber erklärt, als hätte Brüssel damals im Juni 2020 kurz innehaltend gedacht: „Ach ja, stimmt – Menschen können auch hier diskriminiert werden. Wer hätte das ahnen können.“ Natürlich ist Rassismus in Europa alt, banal und strukturell verwoben – Kolonialgeschichte, Migration, Klassenfragen, Nationalismus –, aber die politische Kraft entsteht erst, als das Ereignis in ein mediales Weltformat gegossen wird. Der politische Mythos braucht Bilder. Und Floyds Tod liefert nicht nur Bilder, sondern die perfekte Mischung aus Schock, Moral und performativer Selbstverpflichtung. Seitdem gilt in EU-Dokumenten: Wer Antirassismus sagt, meint nicht nur das Strafrecht, sondern eine Haltung, eine Erzählung, eine institutionelle Selbsterziehung. Europa, in Abgrenzung zu Trump, als zivilisierter Gegenentwurf. Ein Kontinent, der sich nicht einfach als Rechtsgemeinschaft, sondern als moralischer Raum versteht: nicht nur „rule of law“, sondern „rule of virtue“. Und weil Tugend bekanntlich nie abgeschlossen ist, kann man sich darin herrlich einrichten.
Dass Lahbib im Oktober 2025 gegenüber Bloomberg erklärte, die EU werde ihre Verpflichtungen in Sachen „Diversität, Gleichstellung und Inklusion“ nicht abschwächen, sondern bekräftigen und ausbauen, ist die logische Fortsetzung: Die EU hat entdeckt, dass DEI nicht nur moralisch klingt, sondern wunderbar kompatibel ist mit dem eigenen Funktionsmodus. DEI ist nicht bloß eine Idee – es ist ein Governance-Set. Es lässt sich messen, monitoren, fördern, trainieren, auditen. Es lässt sich institutionalisiert endlos verlängern. Und damit wird Antirassismus vom Ziel zum Prozess. Oder um es etwas böser zu sagen: vom moralischen Imperativ zur Verwaltungsreligion, bei der die Liturgie aus Task Forces besteht und die Beichte aus anonymen Gleichstellungsdaten.
Zwei Gerechtigkeiten: Der Universalismus und sein Schatten
Der Begriff „Soziale Gerechtigkeit“ ist in Debatten ungefähr so präzise wie „gesunde Ernährung“: Jeder ist dafür, niemand stimmt über die Zutaten ab, und am Ende gibt es Streit darüber, ob man damit eine Gurke oder einen Kuchen meint. Im liberal-universalistischen Ansatz ist Gerechtigkeit vor allem das Versprechen gleicher Regeln und gleicher Rechte: gleiche Würde, gleiche Chancen, gleiche Verfahren. Die Pointe dieses Ansatzes ist seine Kälte: Er will nicht, dass der Staat deine Seele kennt, sondern dass er dich in Ruhe lässt – außer wenn jemand dir Unrecht tut, dann greift das Recht ein. Das ist nicht perfekt, aber es ist ein zivilisatorischer Fortschritt, weil es den Machtanspruch der Institutionen begrenzt. Es behandelt den Menschen nicht als Träger einer Gruppenschuld oder Gruppenschicksals, sondern als Individuum, das – im Idealfall – dem Staat gegenüber nicht erklären muss, was es ist, um zu bekommen, was ihm zusteht.
Die kritische soziale Gerechtigkeit, oft unter dem Label Critical Social Justice (CSJ) geführt, setzt anders an: Sie betrachtet Gesellschaft als Feld von Gruppen, Machtverhältnissen und strukturellen Ungleichheiten, die sich nicht durch formale Gleichheit auflösen, sondern durch aktive Intervention. Das Individuum ist hier weniger Person als Position in einem Geflecht von Privilegien und Benachteiligungen. Nicht das einzelne Unrecht ist zentral, sondern das Muster. Nicht die Ausnahme, sondern das System. Nicht der Nachweis, sondern die Diagnose. Diese Logik ist verführerisch, weil sie Welt erklärbar macht. Wer einmal gelernt hat, Gesellschaft als Interaktionsfläche von Kategorien zu lesen, kann überall Sinn finden: in einem Bewerbungsgespräch, in einer Statistik, in einem Blick, in einem Schweigen, in einem Witz, in der Auswahl von Käse im Supermarkt. Das Leben wird interpretierbar – und Interpretation ist Macht.
Özlem Sensoy und Robin DiAngelo haben diesen Gegensatz 2014 systematisiert und 2017 in „Is Everyone Really Equal?“ als bewusste Gegenposition zum liberalen Universalismus ausgearbeitet. DiAngelo wurde dann mit „White Fragility“ zur globalen Hohepriesterin einer pädagogisch-moralischen Disziplin, die weniger fragt: „Was ist passiert?“ als: „Welche unbewusste Voreingenommenheit hat dich dazu gebracht, dass du überhaupt fragst?“ Seit 2020, nach George Floyd, sind die Begriffe dieser Perspektive wie Saatgut in Institutionen gestreut worden: struktureller Rassismus, unbewusste Voreingenommenheit, Mikroaggressionen. Und man muss anerkennen: Das ist intellektuell effektiv. Denn es schafft ein Vokabular, das nicht nur beschreibt, sondern verbindet – an Programme, Budgets, Trainings, Indikatoren. Es ist nicht bloß Sprache. Es ist Infrastruktur.
Der Trick der Strategie: Universelle Slogans, gruppenspezifische Maschinen
Wenn EU-Dokumente „gleiche Rechte“ und „Nulltoleranz“ schreiben, ist das in etwa so überraschend wie ein Bäcker, der „frisch“ an die Scheibe klebt. Es gehört zum Ritual. Entscheidend ist nicht die moralische Dekoration, sondern die Werkzeugkiste darunter. Und genau dort zeigt sich, wohin die Strategie praktisch steuert: Sie arbeitet mit Begriffen und Instrumenten, die nicht primär rechtlich begrenzen, sondern politisch steuern. Die Leitdiagnose ist „struktureller Rassismus“ – also die Annahme, dass Benachteiligung nicht nur durch einzelne Diskriminierungsakte entsteht, sondern durch Routinen, Institutionen, Verfahren und kulturelle Muster, die über Generationen wirken. Das ist zunächst nicht falsch. Die Welt ist komplex, Institutionen sind träge, Ungleichheiten können sich verfestigen. Aber sobald „strukturell“ nicht mehr analytisch, sondern administrativ wird, ändert sich das Spiel: Dann wird aus der Beschreibung einer Möglichkeit der Anspruch auf permanente Korrektur. Wer strukturellen Rassismus als institutionellen Grundzustand setzt, braucht zwangsläufig ein dauerhaftes Reparaturregime. Und wer ein dauerhaftes Reparaturregime braucht, braucht Daten, Definitionen, Expertengremien, Leitlinien, Förderprogramme, Trainings, Kampagnen – kurz: eine Bürokratie, die sich selbst als moralische Feuerwehr versteht, obwohl sie im Alltag eher die Brandschutzordnung schreibt, nach der alle leben sollen.
Ein besonders aufschlussreicher Satz ist deshalb nicht die moralische Bekundung, sondern der Governance-Schritt: In einer Expertengruppe soll die Entwicklung einer gemeinsamen Arbeitsdefinition von „strukturellem Rassismus“ durch die Mitgliedstaaten erleichtert werden. Ebenso soll für „antimuslimischen Hass“ nicht nur geforscht, sondern eine Arbeitsdefinition unterstützt werden. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Nicht nur wird ein umstrittener Begriff gesetzt, sondern er soll über „Arbeitsdefinitionen“ in Expertengremien verstetigt werden. Eine Arbeitsdefinition ist die perfekte politische Erfindung: Sie wirkt verbindlich, ohne demokratisch beschlossen zu sein; sie ist handhabbar, ohne juristisch überprüfbar zu sein; sie ist flexibel, ohne falsifizierbar zu sein. Sie ist das Gegenteil eines Gesetzes und zugleich oft wirksamer als eines, weil sie in Verwaltungen als Referenzpunkt dient, nach dem man handelt, schult, bewertet. Wer „Arbeitsdefinition“ sagt, meint häufig: „Wir bauen eine Norm, die wir nicht so nennen müssen.“
Wer einmal gesehen hat, wie solche Definitionen in Behörden, Bildungseinrichtungen und Medien funktionieren, weiß, was passiert: Es entstehen Auslegungskonflikte, moralische Grenzregime, und eine schleichende Verschiebung der Frage. Früher: „War das Diskriminierung nach Rechtsmaßstab?“ Heute: „Entspricht das der Definition des Problemrahmens?“ Und wenn man die Definition des Problemrahmens besitzt, besitzt man die Deutungshoheit über die Wirklichkeit. Großbritannien hat für solche Dynamiken reichlich Anschauungsmaterial geliefert: Arbeitsdefinitionen, die eigentlich Orientierung bieten sollten, werden plötzlich zu Sprech- und Bewertungsstandards, an denen sich Karrieren, Institutionen und öffentliche Legitimität ausrichten müssen. Man kann das Fortschritt nennen. Man kann es auch als kulturelle Verrechtlichung ohne Rechtsschutz beschreiben.
Intersektionalität: Das Raster, das alles sieht und nichts vergisst
Der zweite Schlüsselbegriff ist Intersektionalität – Kimberlé Crenshaws Idee, dass sich Benachteiligungen aus verschiedenen Kategorien überlagern. Auch das ist als Beobachtung plausibel: Menschen sind nicht nur „das eine“, sondern gleichzeitig vieles. Aber sobald Intersektionalität zum politischen Grundprinzip erklärt wird, wird sie weniger eine Sensibilisierung für Komplexität als ein Raster für Verwaltung. Ein Raster ist mächtig, weil es sortiert. Wer sortiert, kann priorisieren. Wer priorisiert, kann Ressourcen steuern. Und wer Ressourcen steuert, entscheidet darüber, welche Gruppen sichtbar sind und welche unsichtbar bleiben. Intersektionalität ist in dieser Logik nicht das Ende der Vereinfachung, sondern ihre nächste Stufe: Man ersetzt die alte Einteilung durch eine feinere, und glaubt dann, man sei der Wahrheit näher – während man in Wirklichkeit nur die Kategorien vermehrt, die der Staat in seiner Unersättlichkeit in Datenpunkte verwandeln kann.
Die Strategie erklärt ausdrücklich, sie sei – im Einklang mit allen „Union of Equality“-Strategien – auf einem intersektionalen Politikansatz aufgebaut. Das klingt harmlos, fast freundlich, wie ein „Wir nehmen alle mit“. Aber praktisch heißt es: Nicht mehr das Individuum steht im Zentrum, sondern die Gruppenzugehörigkeit in Mehrfachausführung. Das hat einen paradoxen Effekt: Je stärker man Gerechtigkeit als Gruppenmatrix organisiert, desto mehr wird das Individuum aus seinem eigenen Leben herausgerechnet. Es wird zur Schnittmenge. Zur Excel-Zeile. Zum Falltyp. Zur Zielgruppe. Der Mensch, dieses lästige, widersprüchliche Wesen, das manchmal nicht ins Raster passt, wird administrativ geglättet. Das ist effizient – und deshalb so gefährlich charmant.
Die Datenreligion: Wenn Gleichstellung messbar werden muss, um real zu sein
Die Strategie bleibt nicht beim Vokabular stehen. Sie will die Welt nicht nur beschreiben, sondern regieren. Und regieren bedeutet: messen. Die zentrale Achse ist deshalb das Datenkapitel. Gleichstellungsdaten werden als „essenziell“ bezeichnet, um Antirassismus in Politik auf allen Ebenen zu integrieren. Eurostat arbeitet über eine Task Force an EU-Leitlinien; Mitgliedstaaten sollen harmonisierte Daten ausbauen. Dazu kommt eine angekündigte Empfehlung, um Erhebung, Analyse und Nutzung aufgeschlüsselter Gleichstellungsdaten zu verbessern, ausdrücklich mit dem Ziel, Fortschritt zu verfolgen und zu überwachen.
Das klingt wie rationaler Pragmatismus: Wer Probleme lösen will, braucht Daten. Und natürlich stimmt das. Aber es gibt eine zweite Ebene, die gerne verschwiegen wird: Wo Politik über gruppenaufgeschlüsselte Daten gesteuert wird, wird die Gesellschaft selbst gruppenbasiert operationalisiert. Dann sind Gruppen nicht mehr nur analytische Kategorien, sondern Verwaltungseinheiten. Und Verwaltungseinheiten haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie nicht verschwinden, wenn das Problem sich verändert – sie bleiben, weil das System sie braucht. Daten schaffen Wirklichkeit: Wer zählt, existiert. Wer nicht zählt, ist irrelevant. Wer falsch zählt, ist politisch falsch. Und wer die Daten besitzt, besitzt die Legitimation, weitere Eingriffe zu rechtfertigen. Das ist nicht zwingend bösartig, aber es ist ein Mechanismus, der sich gern verselbstständigt: Jede neue Ungleichheit, die man misst, erzeugt das Bedürfnis nach einem neuen Programm, das wiederum Daten braucht, die wiederum eine neue Expertengruppe legitimieren. Der ewige Kreislauf der gut begründeten Unendlichkeit.
Die Pointe ist dabei, dass man „Fortschritt“ nicht nur verfolgt, sondern auch definiert. Wenn Gleichstellung ein Zahlenziel wird, entsteht eine Zielarchitektur, die zwangsläufig Repräsentation zum Maßstab macht. Dann wird aus Gerechtigkeit eine Art demografischer Buchhaltung. Man kann das „Gleichheit“ nennen. Man kann es auch als Transformation von Bürgerrechten in Gruppenquotenlogik beschreiben – eine Entwicklung, die ausgerechnet dem liberalen Ideal der Gleichbehandlung genau dort widerspricht, wo sie angeblich verteidigt wird.
Bildung, Erinnerung, Bewusstseinsarbeit: Der Staat als Pädagoge der Seele
Der nächste Block ist kultur- und bildungspolitisch, und hier zeigt sich die Ambition besonders deutlich: Antirassismus ist nicht nur Durchsetzung von Recht, sondern Veränderung von Wahrnehmung. Aufarbeitung kolonialer Vergangenheit, ein UNESCO-Projekt zur Stärkung von Anti-Rassismus-Bildung, Seminarzyklen gegen Rassismus in (sozialen) Medien, EU-weite Kommunikationskampagne zur „Union of Equality“. Das ist, nüchtern betrachtet, klassische politische Pädagogik: Narrative formen, Bewusstsein schärfen, Einstellungen verändern. Der Staat – oder in diesem Fall die EU – wird zum Erziehungsakteur, der nicht nur Regeln setzt, sondern Haltungen kultivieren will. Das ist die alte, ehrwürdige Versuchung jeder moralisch ambitionierten Politik: Wenn man nur die richtigen Worte findet, werden die Menschen besser. Oder wenigstens so, dass es auf Förderanträgen gut aussieht.
Man kann das verteidigen: Gesellschaftlicher Wandel braucht Bildung. Man kann es auch kritisch sehen: Wer „kritische Bewusstseinsbildung“ institutionalisiert, schafft einen Raum, in dem bestimmte Deutungen als Fortschritt gelten und andere als Problem. Und wer in diesem Raum die Standards setzt, wird zum Gatekeeper. Wer Gatekeeper wird, wird schnell Richter. Und wer Richter wird, wird irgendwann unfehlbar – zumindest im eigenen Selbstbild. Die EU nennt das dann „Union of Equality“. Andere nennen es: normative Hegemonie mit freundlichem Logo.
Polizei, Verwaltung, Bias-Trainings: Vom Rechtsbruch zur Mustererkennung
Auch in Verwaltung und Strafverfolgung verschiebt die Strategie den Fokus: weg von individuellen Normverletzungen, hin zu systematischen Verzerrungen. Trainings sollen helfen, rassistische Voreingenommenheit zu erkennen, „unconscious bias“ wird thematisiert, „Mikroaggressionen“ werden in ethische Module eingebaut. Für die Polizeiarbeit taucht „Racial Profiling“ als Problemfolie auf, und statt klassischer Rechtsdurchsetzung entsteht ein „compendium of good practices“ – ein Leitfaden, der nicht konkret sagt: „Das ist verboten“, sondern: „So sollt ihr handeln, um Muster zu vermeiden.“
Und hier ist der entscheidende Unterschied: Im liberalen Rechtsstaat ist die Frage: Welche Norm wurde verletzt? In der CSJ-kompatiblen Governance ist die Frage: Welche Muster führen zu ungleichen Ergebnissen? Das klingt subtil, ist aber eine Revolution der Zuständigkeit. Denn Normverletzungen kann man juristisch prüfen. Muster kann man endlos interpretieren. Normverletzungen haben Täter und Opfer im konkreten Fall. Muster haben „Systeme“ und „Strukturen“ als Schuldige, und damit eine Schuld, die nie erledigt ist. Wo das System schuld ist, kann niemand freigesprochen werden – höchstens umgeschult.
Bias-Trainings und Mikroaggressions-Module sind dabei die perfekte Institutionenware: Sie sind billig, skalierbar, gut messbar (Teilnahmequote!), gut dokumentierbar („Wir tun etwas!“) und immun gegen harte Erfolgskontrolle. Denn wenn nach dem Training weiterhin Konflikte auftreten, ist das kein Gegenbeweis, sondern ein Beleg dafür, dass das Problem strukturell ist und noch mehr Training braucht. Das ist der Traum jeder Bürokratie: ein Programm, das sich durch sein Ausbleiben an Erfolg selbst rechtfertigt.
Geld, Standards, Konditionalität: Die EU als moralischer Investor
Natürlich ist die Strategie formal kein Gesetz, sondern eine „Communication from the Commission“. Juristisch unverbindlich, politisch unvermeidlich. Die eigentliche Verbindlichkeit entsteht, wie so oft in der EU, über das, was man höflich „Governance“ nennt und was in der Praxis bedeutet: Geld, Standards, Monitoring.
Beim Geld ist die Linie klar: Unterstützung von NGOs, Graswurzelaktivismus, Interessenvertretung. Zentral ist CERV – „Citizens, Equality, Rights and Values“. Dazu der Blick nach vorn: AgoraEU als Dachrahmen, CERV+ mit 3,6 Milliarden Euro im Strang „Democracy, Citizens, Equality, Rights and Values“ im Mehrjährigen Finanzrahmen 2028–2034. Man muss nicht zynisch sein, um zu erkennen, was das erzeugt: ein Ökosystem. Antragsteller, Beratungsindustrie, Evaluationslogik, Compliance-Mechanismen. Förderlogik ist nicht neutral. Sie formt Felder. Sie belohnt bestimmte Begriffe. Sie bevorzugt bestimmte Diagnosen. Und irgendwann ist „Antirassismus“ nicht mehr nur eine Haltung, sondern ein Marktsegment – mit KPIs, Berichten und dem professionellen Habitus einer moralisch gut situierten Branche, die sehr genau weiß, wie man „strukturelle Benachteiligung“ in Projektziele übersetzt, ohne jemals erklären zu müssen, wie man sie beendet.
Dann die Konditionalität: „Horizontal Enabling Conditions“, Grundrechtscharta, Common Provisions Regulation. Das ist die EU in Reinform: Nicht sagen „Ihr müsst“, sondern sagen „Wenn ihr Geld wollt, müsst ihr“. Und weil kaum ein Mitgliedstaat gern auf Fördermittel verzichtet, wird aus einer Strategie eine praktische Pflicht. Nicht weil die Antirassismus-Strategie Gesetz wäre, sondern weil sie sich in Nachweislogiken verwandelt: Wer Mittel will, muss zeigen, dass er „wirksam“ umsetzt. Wirksamkeit wird gemessen. Gemessen wird, was man definieren kann. Definieren kann man, was man standardisiert. Standardisieren kann man, was man monitoren kann. Monitoren kann man, was man in Indikatoren presst. Indikatoren wiederum werden zu Zielen. Und Ziele werden zu Politik. Willkommen im Kreislauf der administrativen Moral.
Und schließlich die Gleichbehandlungsstellen: Indikatoren, Durchführungsrechtsakte, Überwachung. Hier wird aus Strategie Governance im engeren Sinn: Berichtspflichten, Funktionsstandards, Evaluationsarchitektur. Es ist die stille Entstehung einer europaweiten Infrastrukturethik, die nicht direkt Gesetze schreibt, aber die Bedingungen setzt, unter denen Gesetze angewandt werden. Eine normative Verwaltungsschicht, die sich selbst als Fortschritt versteht und deshalb immer weiter wachsen darf.
Die Kommission als Vorbild: Selbstmessung als Tugend
Natürlich bleibt die EU nicht bei den anderen stehen. Sie will Modellfall sein. Und deshalb beschreibt sie im eigenen Apparat freiwillige und anonyme Erhebung von Gleichstellungsdaten am Arbeitsplatz, Trainings zu „unconscious bias“, Module zu Mikroaggressionen, unterstützende Maßnahmen für unterrepräsentierte Gruppen im Traineeship-Kontext. Das ist das klassische Paket: Daten sammeln, Bewusstsein schulen, Repräsentation korrigieren. Eine Institution, die sich selbst als Labor versteht, in dem man gesellschaftliche Zukunft ausprobiert.
Das hat eine gewisse Ironie: Die EU, diese große Technokratie, die sich gern als rational und evidenzbasiert darstellt, gleitet hier in eine Form von moralischem Management, das erstaunlich wenig mit harten Evidenzstandards zu tun hat. Denn vieles davon ist weniger Wissenschaft als pädagogischer Aktivismus in Verwaltungssprache. Unconscious-bias-Trainings sind in ihrer Wirksamkeit umstritten, Mikroaggressions-Konzepte sind dehnbar bis zur Unkenntlichkeit, Gleichstellungsdaten im Arbeitskontext sind politisch brisant und datenschutzsensibel. Aber das stört nicht, denn die Funktion solcher Maßnahmen ist nicht primär empirische Problemlösung, sondern institutionelle Signalisierung: Wir sind auf der richtigen Seite. Wir arbeiten daran. Wir sind moralisch resilient. Und wer sich fragt, ob das wirklich die besten Methoden sind, bekommt, ganz modern, nicht unbedingt ein Argument, sondern eine Diagnose: Fragilität, Abwehr, Unbewusstheit. Es ist die rhetorische Wunderwaffe einer Politik, die sich gegen Kritik immunisiert, indem sie Kritik als Symptom klassifiziert.
Universalismus als Schaufenster, Gruppensteuerung als Motor
Man kann das Ergebnis präzise formulieren: Im normativen Anspruch bleibt die Strategie universalistisch – gleiche Rechte, gleiche Chancen. In Diagnose und Umsetzung ist sie gruppenzentriert und CSJ-kompatibel: strukturelle Systemannahmen, Intersektionalitätsraster, Daten- und Monitoringregime, Trainings- und Awareness-Architektur, Standardsetzung, Förderinfrastruktur, Konditionalität. Das ist keine Kleinigkeit. Das ist eine Verschiebung des Politikverständnisses: weg vom liberalen Rechtsrahmen, hin zu einer dauerhaften Steuerungslogik, die Gesellschaft als permanente Baustelle von Gruppenungleichheiten betrachtet, die institutionell verwaltet werden müssen.
Und damit wird Antirassismus zum Dauerprogramm – nicht weil Rassismus nie endet (das wäre zynisch zu leugnen), sondern weil die EU eine Form gefunden hat, aus moralischen Zielen eine administrative Endlosschleife zu machen. Das ist zugleich die Stärke und die Gefahr: Die Stärke, weil es institutionelle Aufmerksamkeit bindet. Die Gefahr, weil es Politik in ein System verwandelt, das ständig neue Gründe braucht, um sich selbst fortzuschreiben.
You can never be woke enough: Der Fortschritt frisst seine Kinder und verlangt Nachschlag
Der vielleicht komischste, zugleich entlarvendste Teil ist die erste Reaktionslage aus dem NGO-Bereich: Die Strategie verfehle den Punkt, sei eine vergebene Chance, zu wenig verbindlich, blinde Flecken, Migration, Sicherheits- und Polizeipolitik nicht ernst genug, Definition von strukturellem Rassismus zu eng. Das ist die logische Konsequenz eines Moralregimes, das sich über Steigerung definiert: Wer einmal akzeptiert hat, dass Gerechtigkeit nicht mehr Gleichheit vor dem Gesetz ist, sondern gruppenspezifische Korrektur von strukturellen Mustern, hat keinen natürlichen Endpunkt mehr. Denn jede Korrektur erzeugt neue Differenzen, jede Differenz neue Forderungen, jede Forderung neue Programme, jede Programme neue Unzufriedenheit. Der Fortschritt ist hier nicht Ziel, sondern Bewegung. Stillstand gilt als Rückschritt. Und Rückschritt gilt als moralisches Verbrechen. Die Folge ist ein politisches Hamsterrad, in dem jede erreichte Stufe sofort als unzureichend gilt, weil die Logik nicht „Lösen“, sondern „Vertiefen“ heißt. Das ist die soziale Version von Software-Updates: Kaum ist Version 2026 installiert, heißt es, sie sei nicht kompatibel mit den neuen Anforderungen, bitte laden Sie 2027 herunter, sonst sind Sie unsicher.
Hier liegt die bittere Satire der Gegenwart: Die EU baut eine Governance-Architektur, die bereits jetzt tief genug ist, um Verwaltung, Förderlogik und Standards zu prägen – und bekommt dafür den Vorwurf, sie sei nicht radikal genug. Das zeigt, wie der moralische Overton-Fensterrahmen funktioniert: Was heute „bahnbrechend“ ist, ist morgen „halbherzig“. Was heute „mutig“ ist, ist morgen „zu eng“. Und wer heute „null tolerant“ sagt, muss morgen erklären, warum seine Null nicht groß genug ist.
Der letzte Akt: Die EU als sanftes Imperium der Definitionen
Am Ende steht ein Dokument, das formal unverbindlich ist, aber praktisch wirksam genug, um Realitäten zu formen. Es setzt Begriffe, schafft Prozesse, etabliert Zuständigkeiten, skizziert Daten- und Monitoringpfade, verknüpft Geldflüsse mit Bedingungen, entwickelt Standards, normalisiert Trainingskulturen, und erzeugt zugleich externen Druck, diese Architektur weiter zu verdichten. Das ist die EU in ihrer reinen Gestalt: ein sanftes Imperium der Definitionen, das selten direkt befiehlt, aber ständig Rahmen schafft, innerhalb derer man sich „freiwillig“ richtig entscheidet.
Man kann das gut finden. Man kann es notwendig finden. Man kann es beides finden und trotzdem skeptisch bleiben. Denn die entscheidende Frage ist nicht, ob Antirassismus moralisch geboten ist – selbstverständlich ist er das –, sondern ob die EU hier einen liberalen Rechtsrahmen stärkt oder ein gruppenbezogenes Steuerungsprogramm institutionalisiert, das sich selbst reproduziert. Und die ehrlichste Antwort lautet: Sie tut Letzteres mit der Sprache des Ersteren. Universalismus im Schaufenster, Gruppensteuerung im Motorraum. Und wie bei jedem gut getarnten Motor ist die Überraschung nicht, dass er läuft – sondern dass man irgendwann vergisst, dass er überhaupt da ist.