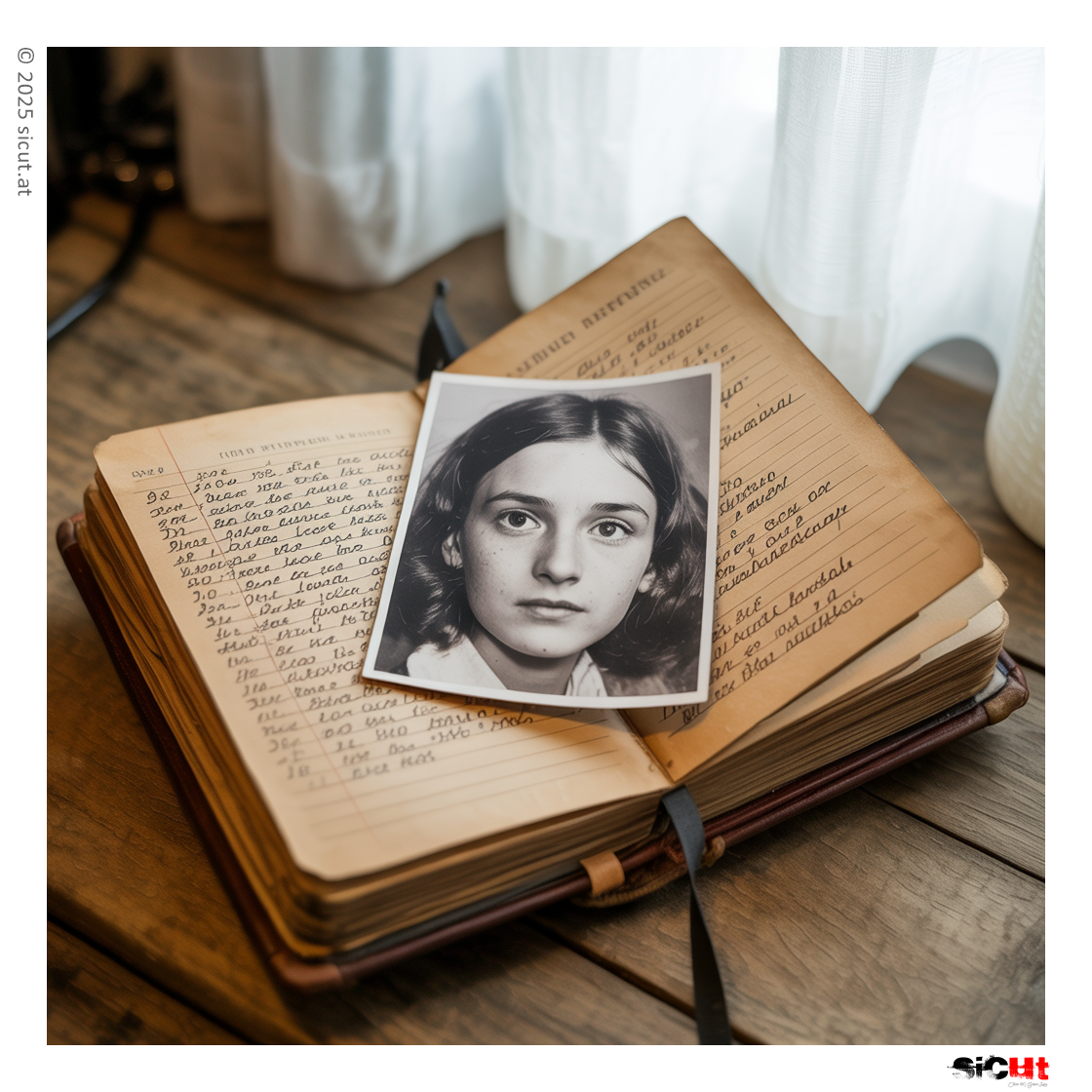Man muss sich die deutsche Energiepolitik als eine Art Dauerhochzeit vorstellen, bei der der Bräutigam mit glasigen Augen vor dem Altar steht und jedes Mal aufs Neue schwört: „Diesmal ist sie es wirklich.“ Die bisherigen Eheschließungen lesen sich wie ein genealogisches Kuriositätenkabinett: erst Braunkohle – robust, zuverlässig, aber mit der Anmutung einer Dame, die beim Tanz stets ein wenig Staub aufwirbelt. Dann Steinkohle – etwas eleganter, aber ebenfalls mit dem Charme viktorianischer Industriefotografie. Es folgte die kurze, hochdramatische Ehe mit der Kernkraft, deren Trennung eher an eine opernhafte Szene erinnerte als an eine nüchterne Verwaltungsentscheidung. Danach kamen Sonne und Wind, diese flirrenden Sommerlieben, die leider die unangenehme Angewohnheit haben, sich bei Flaute oder Nebel einfach nicht blicken zu lassen.
Nun aber ist man wieder verlobt, diesmal mit einer gewissen LNG – Liquefied Natural Gas, einer Braut, die in kryogenen Kleidern bei minus 162 Grad über den Ozean reist und schon allein deshalb eine gewisse emotionale Distanz wahrt. Man hat sich fest vorgenommen, mit ihr durchzuhalten, wenigstens solange, bis irgendwann das erste Fusionskraftwerk geschniegelt in der Sakristei steht und die Gemeinde ehrfürchtig raunen darf: „Endlich die Eine.“ Dass diese finale Traumhochzeit seit Jahrzehnten zuverlässig um „nur noch etwa dreißig Jahre“ verschoben wird, gehört zu jenen kleinen Ironien, die man im energiepolitischen Alltag besser nicht allzu laut erwähnt, um die Festtagsstimmung nicht zu verderben.
Der Tacho im Wohnzimmer
Stellen wir uns für einen Moment vor, der moderne Bürger säße abends auf dem Sofa und betrachtete nicht die neueste Streamingserie, sondern einen imaginären Tacho über der Steckdose. Dort stünde dann nicht „80 km/h“, sondern „1,2 kW“. Eine herrlich nüchterne Zahl, die nichts von der existenziellen Dramatik ahnen lässt, die nötig ist, um sie zustande zu bringen. Denn während das Auto nur einen Tank braucht und gelegentlich eine Tankstelle, verlangt die Steckdose ein orchestrales Zusammenspiel aus Kraftwerken, Netzen, Märkten, politischen Programmen, Förderkulissen und moralischen Selbstvergewisserungen.
Rechnen wir kurz – nicht weil Zahlen besonders romantisch wären, sondern weil sie die unerquicklichste Angewohnheit haben, recht zu behalten. Fünf Stunden Fernsehen ergeben sechs Kilowattstunden. Multipliziert man dieses kleine Privatvergnügen mit einer Million Haushalten, entsteht ein Bedarf von etwa 1,2 Gigawatt. Das ist die Größenordnung, bei der Ingenieure beginnen, nervös auf ihre Diagramme zu schauen, während Politiker beginnen, sehr langsam und bedeutungsschwer zu sprechen.
Ein Kraftwerk wie Kernkraftwerk Grafenrheinfeld konnte genau solche Leistungen bereitstellen – stoisch, wetterunabhängig, mit der emotionalen Ausdruckskraft eines Granitblocks. Dass derartige Anlagen aus dem Netz verschwanden, wird je nach weltanschaulicher Temperatur als Befreiungsschlag oder als ökonomischer Vandalismus interpretiert. Sicher ist nur: Infrastruktur, einmal gesprengt oder rückgebaut, hat die unerquicklich konservative Eigenschaft, nicht spontan wieder zu erscheinen, wenn einem nach Jahren einfällt, dass sie vielleicht doch ganz praktisch gewesen wäre.
Die CO₂-Tasse und der globale Wassereimer
Es gibt Metaphern, die sich so hartnäckig halten wie Kaugummi unter einem Hörsaaltisch. Eine davon ist die Vorstellung, Deutschlands Anteil am globalen CO₂ sei ungefähr eine Kaffeetasse neben einem stattlichen Wassereimer. Nun ist die Versuchung groß, daraus zu schließen, man könne die Tasse auch einfach stehen lassen und stattdessen den Eimer ermahnen, weniger nass zu sein. Doch internationale Politik funktioniert leider nicht wie ein Kindergeburtstag, bei dem man den größten Safttrinker identifiziert und ihm den Strohhalm entzieht.
Der Witz – und er ist von der trockenen Sorte – besteht darin, dass sich moralischer Anspruch und physikalische Wirkung nicht immer decken. Staaten handeln selten ausschließlich nach globaler Effizienz; oft geht es um technologische Führerschaft, geopolitische Abhängigkeiten, industrielle Chancen oder schlicht um das gute Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, auch wenn diese Seite gelegentlich im Nebel liegt.
Gleichzeitig bleibt der banale thermodynamische Umstand bestehen: Strom entsteht nicht durch Applaus. Wer Kohle verbrennt, produziert CO₂. Wer Gas verbrennt, produziert weniger – aber immer noch welches. Wer nichts produziert, importiert. Und wer importiert, entdeckt rasch, dass moralische Reinheit an der Grenze endet, während Stromleitungen erstaunlich indifferent gegenüber politischen Bekenntnissen sind.
Der Feind, ohne den es dunkel wird
Die Kohle ist in dieser Erzählung eine Art ungeliebter Verwandter: Man lädt ihn nicht gern ein, aber wenn er nicht kommt, bleibt das Buffet kalt. Moderne Gesellschaften besitzen eine bemerkenswerte Intoleranz gegenüber Dunkelheit und Gefriertruhen, die sich in spontane Aquarien verwandeln. Daher hält man Kapazitäten bereit, die jederzeit liefern können – ein Konzept, das in Fachkreisen so unerquicklich prosaisch „Grundlastfähigkeit“ genannt wird.
Das geschlossene Kraftwerk Moorburg in Hamburg wurde dabei für viele zum Symbol einer eigentümlichen deutschen Spezialität: der Fähigkeit, gleichzeitig über Strompreise zu klagen und funktionierende Erzeugungsanlagen zu verabschieden. Ob dies weitsichtige Transformation oder teure Ungeduld war, darüber wird man vermutlich noch streiten, wenn Historiker längst andere Moden tragen.
Wasserstoff, das Einhorn der Energiewirtschaft
Kaum ein Stoff wurde in den letzten Jahren so hoffnungsvoll besungen wie Wasserstoff – ein Element, das sich mit der eleganten Zurückhaltung eines scheuen Waldtiers konsequent weigert, frei verfügbar herumzuliegen. Man muss es herstellen, und zwar mit Energie. Nicht wenig Energie. Genauer gesagt: mehr, als man später wieder herausbekommt.
Hier betreten wir das Reich jener politischen Ideen, die auf Konferenzen fantastisch aussehen, aber beim Kontakt mit Wirkungsgraden einen leichten Schwächeanfall erleiden. Natürlich kann überschüssiger Windstrom in Wasserstoff verwandelt werden. Allerdings setzt diese Strategie voraus, dass es erstens nennenswerte Überschüsse gibt und zweitens jemand bereit ist, die Verluste als Eintrittspreis in eine klimaneutrale Zukunft zu verbuchen. Es ist ein bisschen wie Champagner zum Kochen zu verwenden – möglich, beeindruckend, aber ökonomisch erklärungsbedürftig.
LNG – die kühle Zwischenlösung
Und so tritt LNG auf die Bühne: verflüssigtes Erdgas, global gehandelt, technisch bewährt, geopolitisch nicht völlig spannungsfrei. Seine Reise im Tanker wirkt wie ein logistisches Ballett, das allerdings beträchtliche Energiemengen verschlingt, bevor überhaupt ein Elektron die Steckdose erreicht. Dass die Emissionen dadurch steigen, ist weniger Skandal als physikalische Buchführung.
Die sabotierten Pipelines von Nord Stream – deren Geschichte irgendwo zwischen Spionageroman und diplomatischem Albtraum oszilliert – haben diesen Kurswechsel beschleunigt. Pipelinegas wich zunehmend dem Schiffstransport; Versorgungssicherheit wurde neu buchstabiert, meist mit sehr vielen Nullen in den Investitionssummen.
Ist LNG also die Richtige? Vermutlich eher die pragmatische Übergangspartnerin: nicht die große Liebe, aber zuverlässig genug, um den Winter zu überstehen. In der Energiepolitik ist Romantik ohnehin selten ein guter Ratgeber; dort regiert die unerquicklich unpoetische Frage, ob das Licht angeht, wenn man den Schalter betätigt.
Geistiges Probehandeln und reale Sprengladungen
Der Mensch, so heißt es, verfüge über die Fähigkeit zum „geistigen Probehandeln“. Eine wunderbare Vorstellung: Wir denken erst nach, dann bauen wir. Die Realität wirkt bisweilen wie eine improvisierte Theaterprobe, bei der das Bühnenbild schon abgerissen wird, während der Regisseur noch über das Ende grübelt.
Wenn Politiker Jahre später erklären, ein Ausstieg sei vielleicht ein Fehler gewesen, klingt das ein wenig wie die Einsicht nach dem Verkauf des Hauses, dass man den Garten eigentlich mochte. Doch Politik ist kein Labor mit Kontrollgruppe; sie ist eher ein Dauerexperiment unter Applaus- und Empörungsbedingungen.
Vielleicht liegt die eigentliche Satire darin, dass jede Generation überzeugt ist, nun endlich rational zu handeln, während die nächste mit milder Herablassung auf diese Gewissheit zurückblickt. Deutschlands Energiewende könnte sich eines Tages als mutiger Umbau erweisen – oder als teures Lehrstück über technologische Ungeduld. Wahrscheinlich wird sie, wie so vieles, etwas von beidem sein.
Bis dahin aber sitzt der Bürger weiterhin vor seinem imaginären Stromtacho, sieht die 1,2 kW leuchten und ahnt nicht, welch episches Drama nötig ist, um diese unscheinbare Zahl stabil zu halten. Die moderne Zivilisation hängt an solchen Zahlen wie ein Bergsteiger am Sicherungsseil – und behandelt sie doch oft mit der Nonchalance eines Flaneurs.
Ob das Land tatsächlich „kontrolliert zum Einsturz gebracht“ wird oder sich lediglich in einem besonders lauten Renovierungsprozess befindet, wird sich zeigen. Sicher ist nur: Die nächste Hochzeit kommt bestimmt. Und wie bei allen großen Lieben wird man auch dann wieder schwören, diesmal habe man wirklich gerechnet.