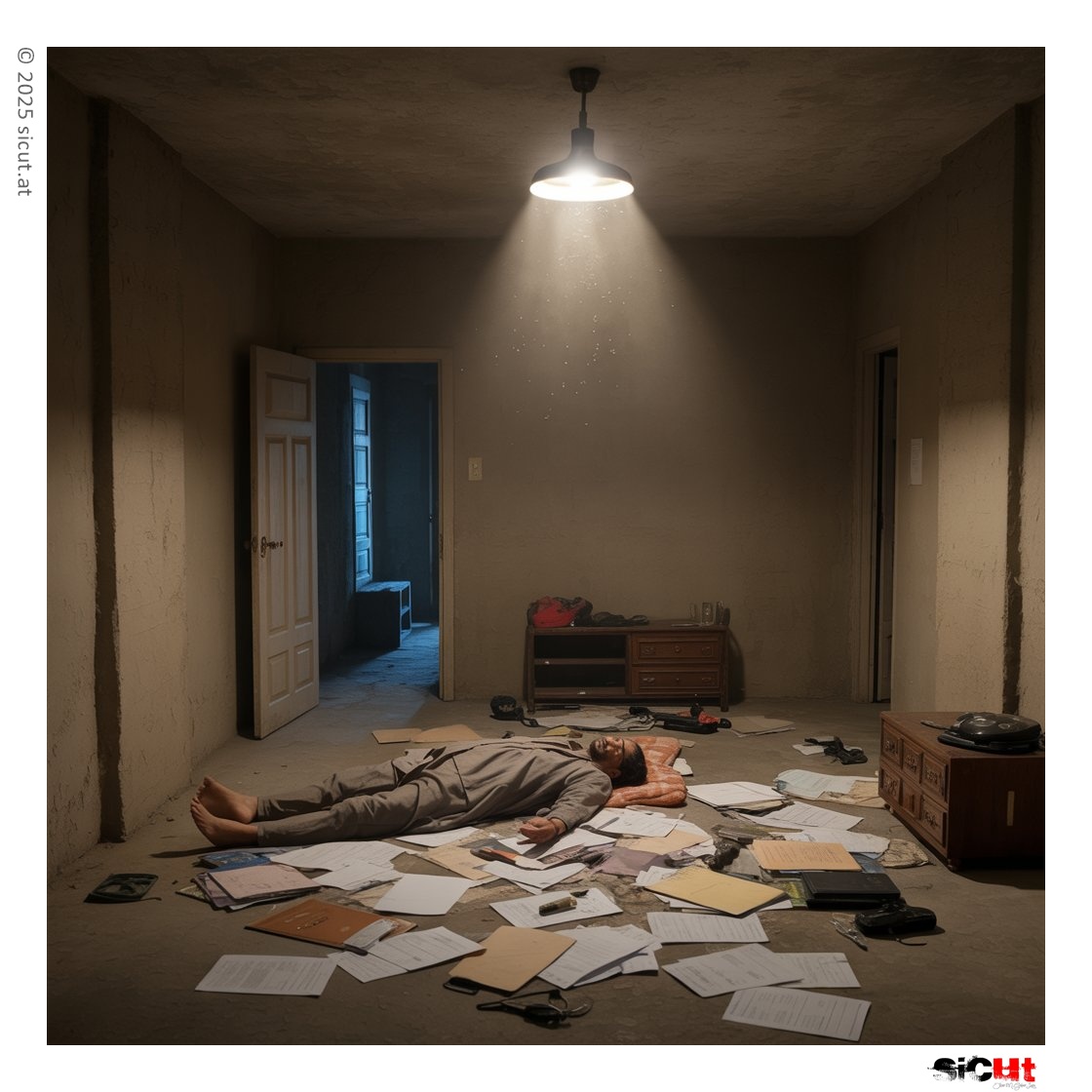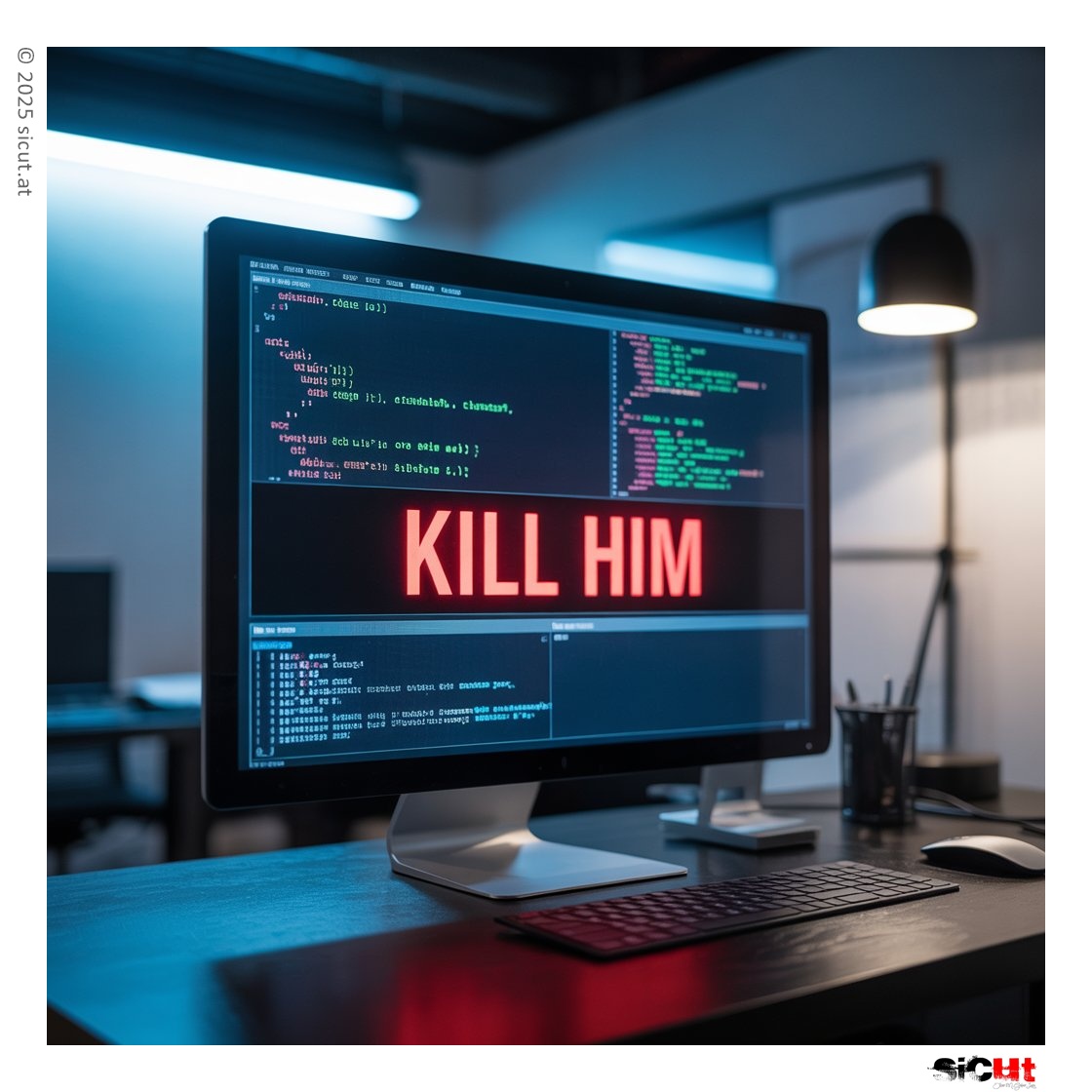Man kann die westliche Welt kaum noch als rational betrachten. Sie taumelt, taumelt und stolpert in ein Theater, das nur noch aus grotesken Visionen besteht. Emmanuel Macron, der einstige Stratege der europäischen Diplomatie, steht auf der Bühne der UN und hebt die Arme wie ein Priester der Unlogik: „Heute erkennen wir Palästina an!“ Die Kamera zoomt. Jubelbrandung. Er selbst wirkt wie eine Figur in einem kafkaesken Theaterstück – die Lippen bewegen Worte, die niemand versteht, während hinter ihm ein Chor aus diplomatischen Marionetten den Rhythmus klatscht.
Starmer in London wirkt wie ein Schauspieler, der seine Rolle vergessen hat. Er lobt die Anerkennung, betont, dass dies „nicht für Hamas“ sei, doch in seinem Blick liegt die innere Kapitulation. Die Paläste der westlichen Diplomatie erscheinen wie Museen der moralischen Verwirrung, bevölkert von Kuratoren, die applaudieren, während die Welt in Flammen steht. Kanada schließt sich an. Mark Carney winkt von einem Balkon, als würde er einen Karneval begrüßen, während unter ihm Tausende Schreie verhallen – Schreie, die nur noch Kulisse sind, nicht Realität.
Visionen der Hamas: Sieg durch Theater
Die Hamas sitzt in ihren Tunnelbauten und schaut zu. Sie lehnt sich zurück, trinkt Kaffee, während westliche Politiker das Massaker vom 7. Oktober in diplomatische Goldmedaillen verwandeln. Jede Anerkennung ist ein Schlag ins Gesicht der Logik, ein Triumph des Irrsinns. Gewalt zahlt sich aus, Blut bringt Legitimität, Massaker erzeugt Applaus. Sie lernen, dass der Terror nicht bestraft wird, sondern in den Hallen der Macht gefeiert.
In einer visionären Szene – und doch real genug – sitzen die Hamas-Führer auf holografischen Thronen, die aus den Trümmern Gazas geformt sind. Über ihnen projizieren Satellitenbilder westlicher Politiker, die applaudieren. Sie lachen. Sie lachen, weil sie verstehen: Die Welt ist Marionettenoper, und die westlichen Staaten spielen ihre Rolle perfekt. Sie liefern die Bühne, die Anerkennung, die Moral – alles in einer grotesken Choreografie der Selbstverleugnung.
Deutschland und die moralische Umkehr
Deutschland erscheint wie ein Theaterstück in Dauerschleife. Die Täter von einst – diesmal verbal und moralisch gehüllt – führen Regie über Empörung, Mitleid und pseudo-moralische Entrüstung. Kinder aus Gaza als Bühnenbilder, Mitleid als Waffe, Antisemitismus als Maske. Die Täter bleiben Täter, nur getarnt, inszeniert, elegant gebrandmarkt als moralische Instanz.
In einer zynischen Vision sieht man deutsche Politiker in schicken Anzügen, die auf Booten im Mittelmeer posieren, Selfies machen, während sie Botschaften eröffnen, die Phantomstaaten repräsentieren. Sie heben Gläser, lachen über ihre eigene Skrupellosigkeit und nennen es „Diplomatie“. Sie feiern moralische Siege über Opfer, die noch atmen.
Die absurde Logik: Applaus für das Blut
Die westliche Politik hat eine neue mathematische Formel entwickelt: Blut + Terror = diplomatischer Sieg. Die Welt liest Zahlen, nicht Schreie. Die Anerkennung Palästinas ist nicht mehr ein politischer Akt, sondern eine Performance, ein Ritual, eine Theateraufführung der Absurdität. Diplomaten wandeln durch Flure, die nach Parfüm und verbrannten Idealen riechen, und verteilen Orden an die Täter der Gegenwart.
Visionär gesehen, sitzen alle Staatschefs Europas in einer Aula, die wie ein überdimensionales Aquarium gestaltet ist. Unter Wasser schwimmen die Opfer, unsichtbar, während die Politiker applaudieren, Selfies posten und sich in moralischer Erhabenheit sonnen. Die Hamas schaut zu, trinkt Wein, nickt anerkennend – sie haben das Spiel gewonnen, bevor es überhaupt begann.
Von Hamas lernen heißt siegen lernen – Endspiel
Die Lektion der Gegenwart ist klar: Gewalt zahlt sich aus, Terrorismus wird belohnt, moralische Prinzipien sind verhandelbar. Die westliche Diplomatie hat sich selbst zur Marionette gemacht, die Bühne für ein Massaker und seine Anerkennung liefert. In der Vision, die wir gerade erleben, tanzen Politiker, Terroristen und moralische Heuchler auf einem Pulverfass der Geschichte, das jederzeit explodieren kann.
Die westliche Welt applaudiert – und die Welt zittert. Die Hamas triumphiert, nicht nur durch Gewalt, sondern durch das Theater, das die Welt ihr liefert. Jeder Politiker, der glaubt, mit Anerkennung Frieden zu stiften, hat bereits verloren. Wer die Lektion nicht versteht, erkennt nur die groteske Logik: Von Hamas lernen heißt siegen lernen – in einer Welt, die längst aufgehört hat, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden.