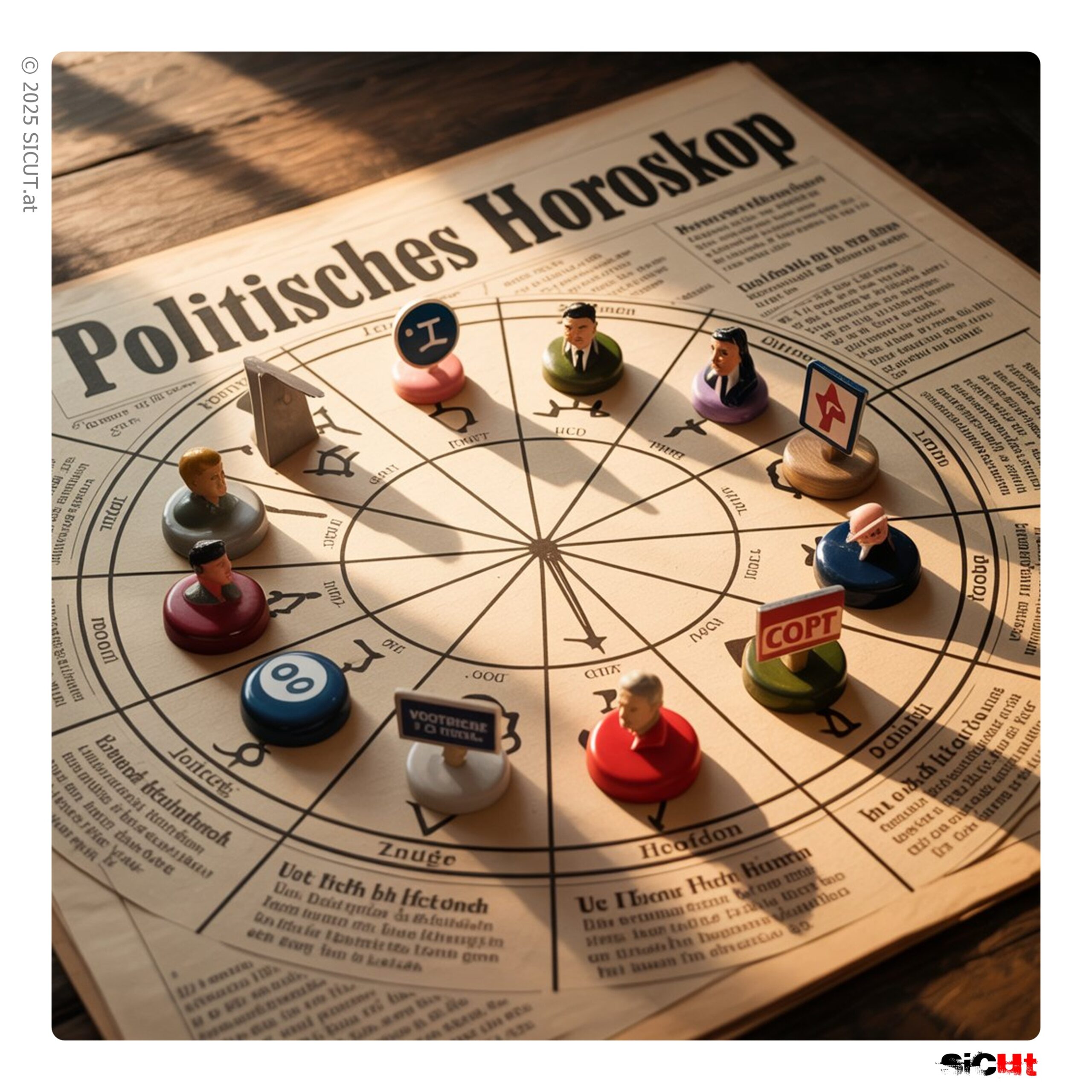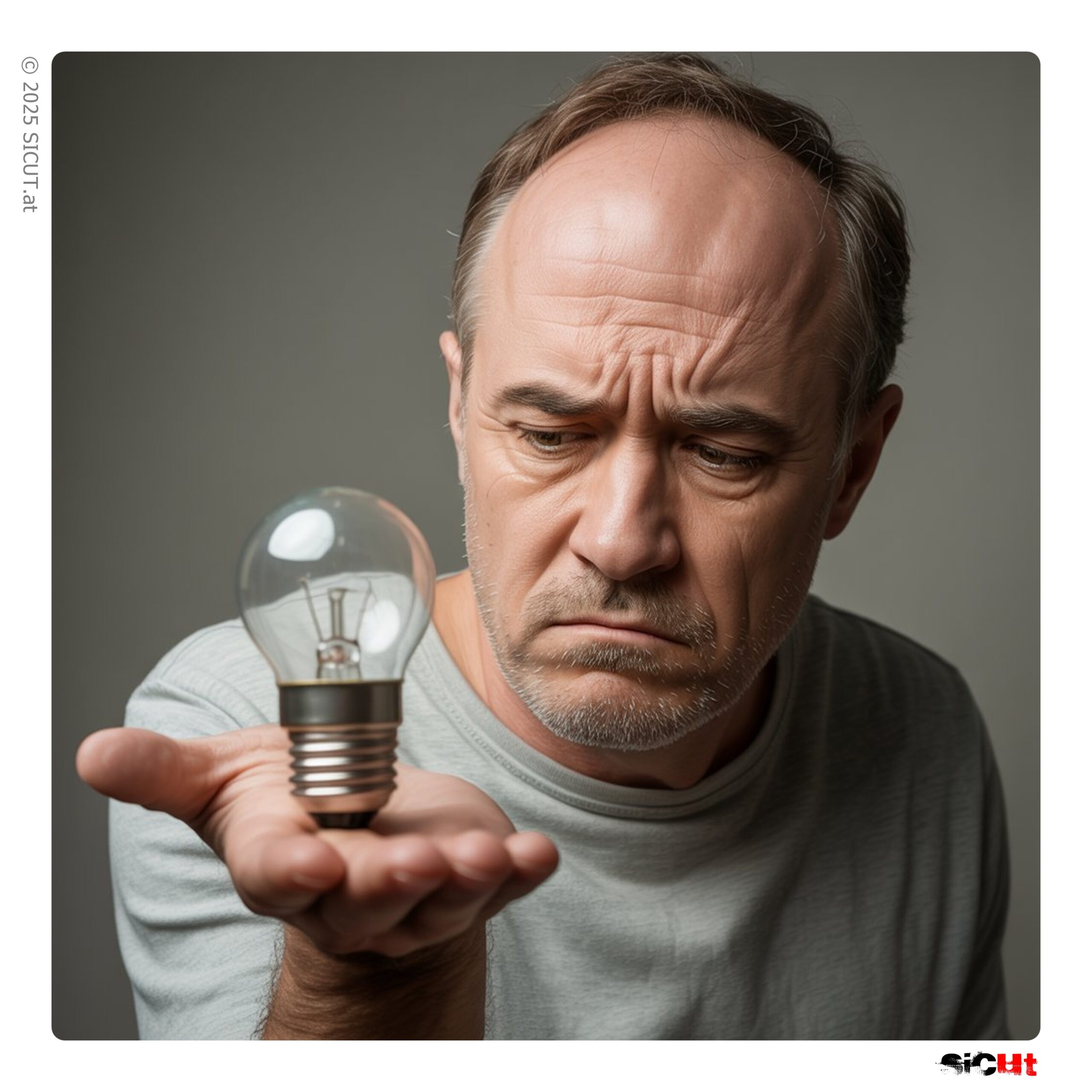Es ist eine eigentümliche Form politischer Alchemie, wenn man ein strukturelles Finanzproblem nimmt, es sorgfältig durch die rhetorische Zentrifuge dreht und am Ende eine kleine, handliche Münze herausfällt, die bitteschön der Patient einwerfen möge – bei jedem Arztbesuch, versteht sich. Drei oder vier Euro, sagt Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, beinahe liebevoll. Drei oder vier Euro, das klingt nach Pfandflasche, nach Kaffeekasse, nach dem harmlosen Klimpern im Portemonnaie, das niemanden ernsthaft beunruhigt. Und doch ist diese Münze schwerer, als sie aussieht. Sie trägt das Gewicht eines Denkstils, der das Gesundheitssystem nicht mehr als solidarische Infrastruktur versteht, sondern als schlecht laufenden Kiosk, in dem man die Kundschaft zu häufig beim Reinschauen ertappt hat.
Die „Kontaktgebühr“, welch euphemistische Wortschöpfung! Sie klingt nach menschlicher Nähe, nach Handschlag, nach sozialer Interaktion. Tatsächlich aber ist sie eine Mautstelle auf dem Weg zur medizinischen Versorgung. Wer den Arzt sehen will, soll zahlen. Nicht viel, nur symbolisch, versteht sich. Symbole allerdings sind in der Politik nie harmlos. Sie sind kleine Fahnen, die anzeigen, in welche Richtung marschiert wird. Und diese Fahne weht nicht in Richtung Solidarität, sondern in Richtung Erziehungsmaßnahme: Der Patient soll lernen, sich zusammenzureißen.
Der Patient als Kostenfaktor mit Puls
Die implizite Erzählung hinter der Kontaktgebühr ist ebenso alt wie unerquicklich: Der Mensch geht zu oft zum Arzt, weil es ja nichts kostet. Er sitzt aus Langeweile im Wartezimmer, liest zerfledderte Illustrierte von 2018 und denkt sich: Ach, wenn ich schon mal hier bin. Diese Vorstellung vom hypochondrischen Freizeitpatienten ist der heimliche Star vieler Reformdebatten. Sie taucht zuverlässig dann auf, wenn Kassen leer sind und politischer Mut rar.
Dabei wäre es eine reizvolle Übung, einmal umgekehrt zu fragen: Warum gehen Menschen überhaupt zum Arzt? Aus Spaß? Aus Sammelleidenschaft für Überweisungsscheine? Oder vielleicht doch, weil sie Schmerzen haben, Angst, Unsicherheit? Die Kontaktgebühr ignoriert diese banale Realität mit der Grandezza eines Systems, das lieber an der Oberfläche spart, als an den eigenen Strukturen zu rütteln. Sie tut so, als ließe sich medizinischer Bedarf durch Kleingeld regulieren – als wäre Krankheit eine Art Fehlverhalten, das man mit einer milden Geldbuße korrigieren kann.
Natürlich betont Gassen, die Gebühr müsse „sozial verträglich“ sein. Dieser Satz gehört inzwischen zum Pflichtinventar jeder gesundheitsökonomischen Zumutung. Er funktioniert wie ein Beruhigungstee: warm, folgenlos, schnell vergessen. Was sozial verträglich konkret heißt, bleibt so vage wie das Versprechen, niemand werde „überfordert“. Drei Euro sind wenig, heißt es dann. Aber sie sind nur dann wenig, wenn man sie nicht hat zählen müssen.
Digitaler Lotse, analoges Menschenbild
Besonders elegant wird der Vorstoß durch die gleichzeitige Präsentation eines „digitalen Ärzte-Lotsen“. Hier zeigt sich die ganze technokratische Poesie unserer Zeit: Ein Algorithmus soll richten, was Menschen angeblich falsch machen. Der Lotse berät, koordiniert, filtert. Er soll verhindern, dass Patienten aus Versehen mehrfach behandelt werden – als hätten sie heimlich Spaß daran, sich durch das Gesundheitssystem zu mäandern wie durch ein schlecht ausgeschildertes Labyrinth.
Der Lotse ist die perfekte Ergänzung zur Kontaktgebühr: Erst zahlt man, dann wird man beraten, ob man überhaupt hätte kommen dürfen. Der Arztbesuch wird zur genehmigungspflichtigen Aktivität, der Patient zum Antragsteller im eigenen Körper. Dass ausgerechnet die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes – 116 117 – zum Nabel dieses neuen Steuerungsuniversums werden soll, hat etwas unfreiwillig Komisches. Man ruft an, wartet, erklärt, wird weitergeleitet, beruhigt oder vertröstet. Effizienz klingt anders, aber vielleicht ist das ja Teil des pädagogischen Konzepts.
Das Krankenhaus als Kassenhäuschen
Währenddessen meldet sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft mit jener Mischung aus Pragmatismus und Dreistigkeit zu Wort, die man inzwischen fast bewundert. Die Zuzahlung im Krankenhaus soll von zehn auf zwanzig Euro pro Tag steigen. Angemessen, sagt Gerald Gaß. Angemessen ist ein wunderbares Wort: Es sagt alles und nichts. Angemessen wofür? Für den Menschen, der im Krankenhaus liegt? Für das System, das ihn dort unterbringt? Oder für die Haushaltslöcher, die man lieber stopft, indem man Patienten zur Kasse bittet?
Hinzu kommt die Gebühr für den „falschen“ Gang ins Notfallzentrum: 30 bis 40 Euro Strafe, wenn man ohne vorherige telefonische Beratung auftaucht. Man stelle sich die Szene vor: Schmerzen, Panik, Unsicherheit – und im Hinterkopf die bange Frage, ob man gerade einen kostenpflichtigen Fehler begeht. Das ist nicht Gesundheitsversorgung, das ist ein pädagogisches Experiment mit offenem Ausgang.
Die Rückkehr der Praxisgebühr durch die Hintertür
Offiziell ist die Praxisgebühr tot. Gesundheitsministerin Nina Warken hat ihr eine Absage erteilt, und doch spukt ihr Geist weiter durch die Debatte. Die Kontaktgebühr ist ihre schlankere, modernisierte Cousine. Keine pauschale Abgabe pro Quartal, sondern feinsäuberlich pro Kontakt. Wer viel krank ist, zahlt viel. Wer arm und krank ist, zahlt besonders viel. Das ist keine Reform, das ist eine Umverteilung nach unten mit freundlichem Lächeln.
Die Ironie dabei ist kaum zu übersehen: Während Versicherte höhere Beiträge fürchten müssen, diskutiert man ernsthaft darüber, ob ein paar Euro pro Arztbesuch die Kassen retten könnten. Es ist, als versuche man, einen sinkenden Ozeandampfer mit einem Teelöffel auszuschöpfen – allerdings nur in der Kabine der Passagiere der dritten Klasse.
Satirischer Ausblick auf eine gesunde Zukunft
Man darf gespannt sein, wohin diese Logik noch führt. Vielleicht gibt es bald eine Atempauschale für besonders häufiges Durchatmen oder eine Sitzgebühr im Wartezimmer, gestaffelt nach Stuhlqualität. Premiumplätze mit Armlehnen, Basisplätze ohne. Der digitale Lotse könnte Bonuspunkte vergeben, wenn man tapfer zu Hause bleibt, und Minuspunkte, wenn man es wagt, Symptome ernst zu nehmen.
All das wäre zum Lachen, wenn es nicht so bitter ernst gemeint wäre. Die Kontaktgebühr ist kein kleiner, pragmatischer Vorschlag, sondern ein Symptom. Sie verrät ein System, das den Menschen zunehmend als Kostenstelle betrachtet, als Variable in einer Excel-Tabelle, die man mit ein paar cleveren Gebühren in den Griff bekommen will. Dass dabei Vertrauen verloren geht, dass Schwellen entstehen, wo eigentlich offene Türen sein sollten – geschenkt. Drei oder vier Euro. Man kann sie leicht aussprechen. Schwerer ist es, die Haltung auszusprechen, die dahintersteht: Gesundheit ist nicht mehr selbstverständlich solidarisch, sondern etwas, das man sich bei jedem Kontakt neu leisten muss. Augenzwinkernd könnte man sagen: Willkommen im Wartezimmer der Zukunft. Bitte halten Sie das Kleingeld bereit.