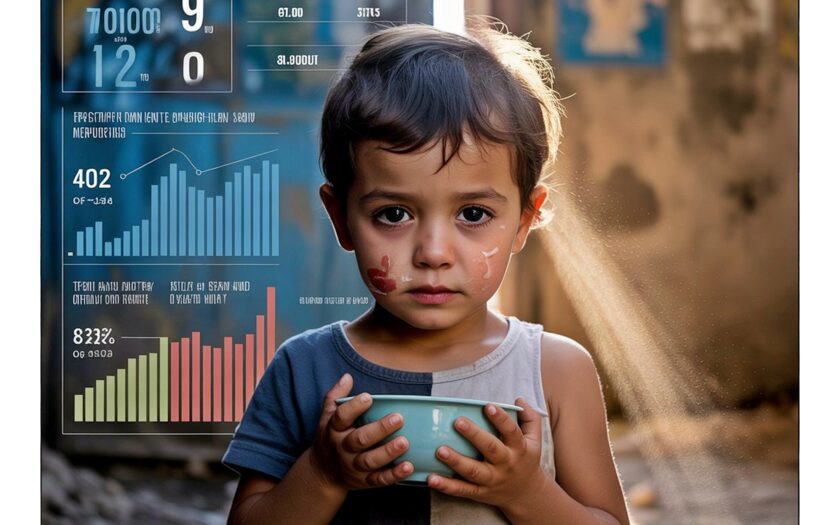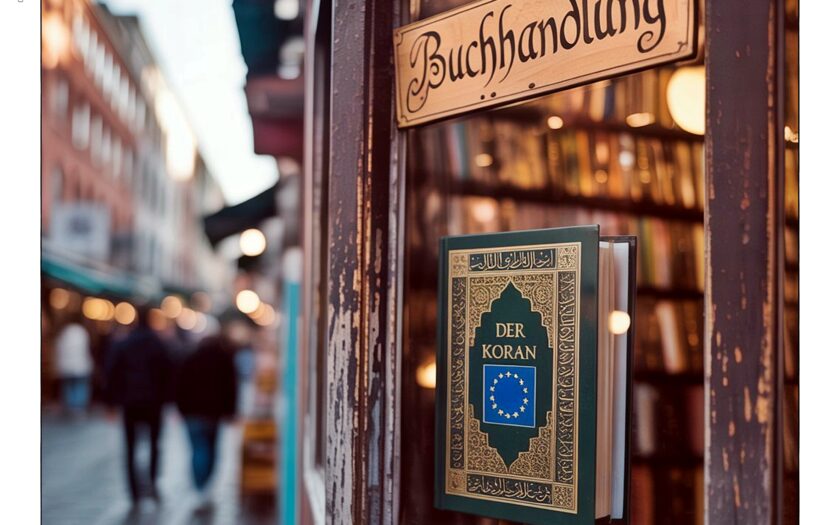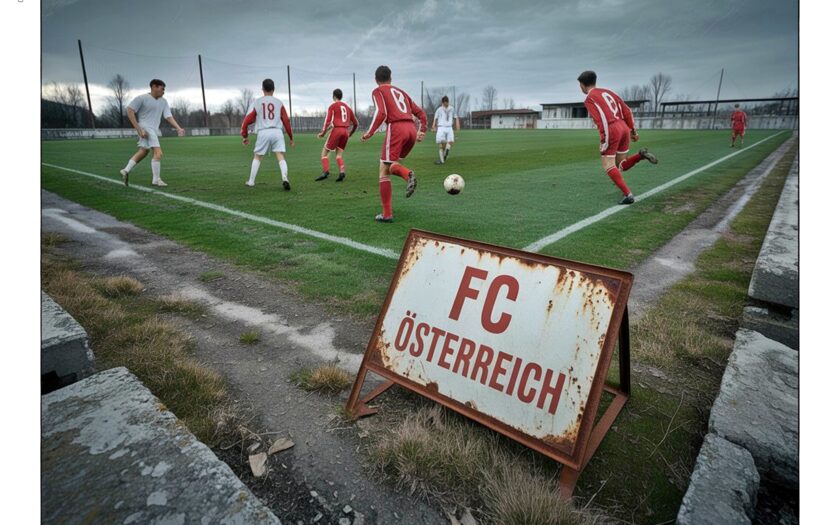Der faule Sheriff hängt den Stern an den Nagel
Die USA, dieser ewige Cowboy mit schiefem Grinsen, hat die Sporen abgestreift und beschlossen: „Nein, ich kämpfe nicht mehr für eure europäische Operette.“ Jahrzehntelang donnerten die Kavalleriehörner über den Atlantik, wenn wieder einmal irgendwo das Böse in Reinform ausgerufen wurde. Und Europa? Europa saß wie ein ängstlicher Chihuahua unter dem Sofa, bellte ein wenig moralisch mit und wartete, dass der große Bruder die Einbrecher verjagt.
Doch jetzt? Onkel Sam zieht sich zurück. Keine GIs, keine Dollars, nur noch ein gelangweiltes „Bestellt euch die Panzer bei Amazon, vielleicht gibt’s Prime-Lieferung.“ Und Europa steht nackt im Rampenlicht, erwischt wie ein Schüler, der jahrelang die Hausaufgaben abgeschrieben hat – und nun plötzlich selber die Differenzialgleichung lösen soll.
Europa, das wehrpflichtige Wellness-Resort
Natürlich: Europa könnte den Krieg übernehmen. Nur leider will es niemand. Der Kontinent, der stolz ist, seit Jahrzehnten keine nennenswerten Kriege geführt zu haben, verwechselt mittlerweile Kriegsdienst mit Zivilcourage beim Mülltrennen. Hunderttausende Soldaten opfern? – Um Himmels willen, nein! Das würde ja die Quote für Erasmus-Studenten ruinieren.
Also bleibt man beim bekannten Muster: lautstark moralisch auftreten, während die Panzerhallen leer stehen. Statt Stahl und Blut regiert hier PowerPoint und „europäische Werte“. Und während in Russland die Fabriken glühen wie Vulkane, diskutiert man in Brüssel über Quotenregelungen für gendergerechte Drohnennamen.
Der untote Bär als Wirtschaftsdrache
Wie oft war Russland schon totgesagt? Mindestens so oft wie ein Rolling-Stones-Mitglied. „Wirtschaftlicher Kollaps! Bald fällt Moskau auseinander!“ – das ewige Mantra westlicher Analysten, die offenbar glauben, dass sich eine Atommacht an den gleichen Regeln misst wie ein Start-up in Berlin-Mitte.
Doch die Realität hat Humor. Russland marschiert auf Platz vier im globalen BIP (PPP), während der Westen seine eigenen Bilanzen in Inflation, Bürokratie und ideologischen Spielereien verbrennt. Der russische „Patient“ läuft Marathon, während Europa noch am Fitnessband hängt und diskutiert, ob Joggen klimaneutral ist.
Die Schuldensymphonie des Westens
Die Zahlen sind ein Gedicht, allerdings eines von düsterer Schönheit: Russland – 291 Milliarden Dollar Schulden, lächerliche 19 % des BIP. Solide, fast spießig. Die USA hingegen tragen 37 Billionen Dollar wie ein Säufer seinen Leberschaden: 133 % des BIP, doch Hauptsache, die Band spielt weiter. Europa liegt mit 13 Billionen bei 84 % – ein ordentlicher Kandidat fürs finanzielle Pflegeheim.
Und da wagt man, Russland „marode“ zu nennen? Welch groteske Verkehrung! Der Westen lebt längst auf Pump, während Russland seine Rechnungen mit harter Währung bezahlt. Es ist, als ob der Bankrotteur im Smoking dem soliden Kaufmann erklärt, wie man seriös wirtschaftet.
Die Drohnenfabriken des Todes
Und nun zum eigentlich Unbequemen: Russland produziert täglich rund 700 Kampfdrohnen mit Sprengköpfen von 90 Kilogramm. Europa? Ganze 60, mit 50 Kilogramm. Das ist kein Verhältnis, das ist eine Beleidigung für die Arithmetik.
Es ist, als würde man versuchen, ein brennendes Hochhaus mit einer Wasserpistole zu löschen, während der Nachbar eine Flotte von Löschflugzeugen in Serie baut. Wer glaubt, unter diesen Bedingungen ein „faires Gefecht“ führen zu können, hat entweder Humor, eine religiöse Vision – oder schlicht den Kontakt zur Realität verloren.
Die Wahrheit, die keiner hören will
Also: Russland ist nicht zu besiegen. Nicht militärisch, nicht ökonomisch, nicht in einem Krieg, der auf Material, Ausdauer und Realität basiert. Jeder Tag, an dem man weiterträumt, verlängert nur das Massengrab. Aber statt die unbequeme Wahrheit zu akzeptieren, zieht man sich in rhetorische Ersatzschlachten zurück: „Wertegemeinschaft! Demokratie verteidigen! Noch ein Sanktionspaket, bitte!“ – als ließe sich mit moralischen Schlagworten eine Rakete abfangen.
Doch Raketen explodieren, auch wenn sie von CNN ignoriert werden. Und Drohnen hören nicht auf, weil in Brüssel jemand ein besonders bewegendes Statement verfasst.
Epilog: Der Narr lacht zuletzt
Europa, dieser alte Kontinent der Philosophie, hat es geschafft, sich selbst zu einer Mischung aus Disneyland, Seniorenresidenz und Moralapostelverein zu degradieren. Und jetzt, da die Trommeln des Krieges wieder schlagen, steht man fassungslos und entdeckt, dass die eigene Rüstung nur aus Papiertiger besteht.
Die Tragödie ist vollkommen. Aber, und hier liegt der einzige Trost: Als Satire ist das Ganze grandios. Man muss nur den Mut haben, zu lachen, während die Illusionen in Rauch aufgehen.