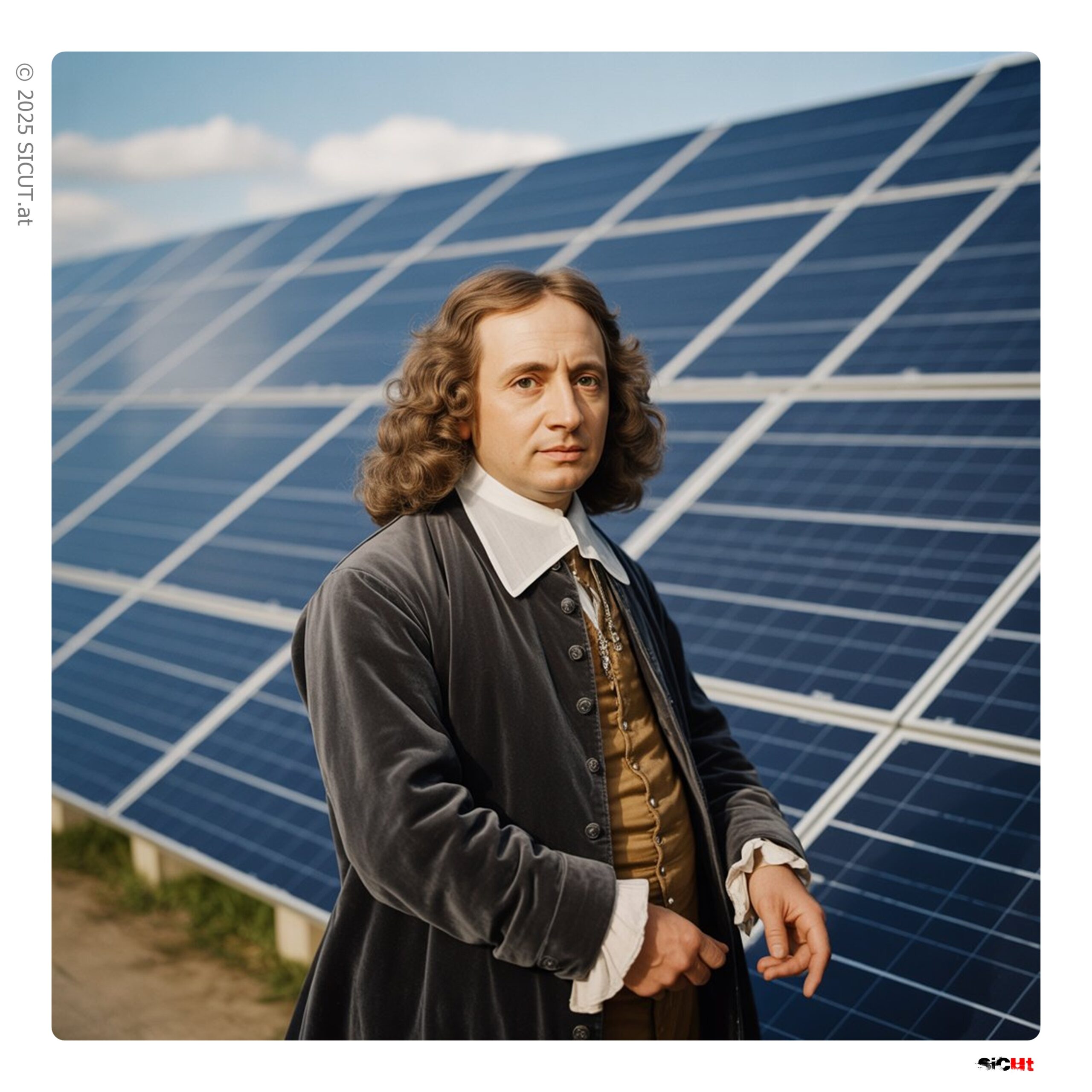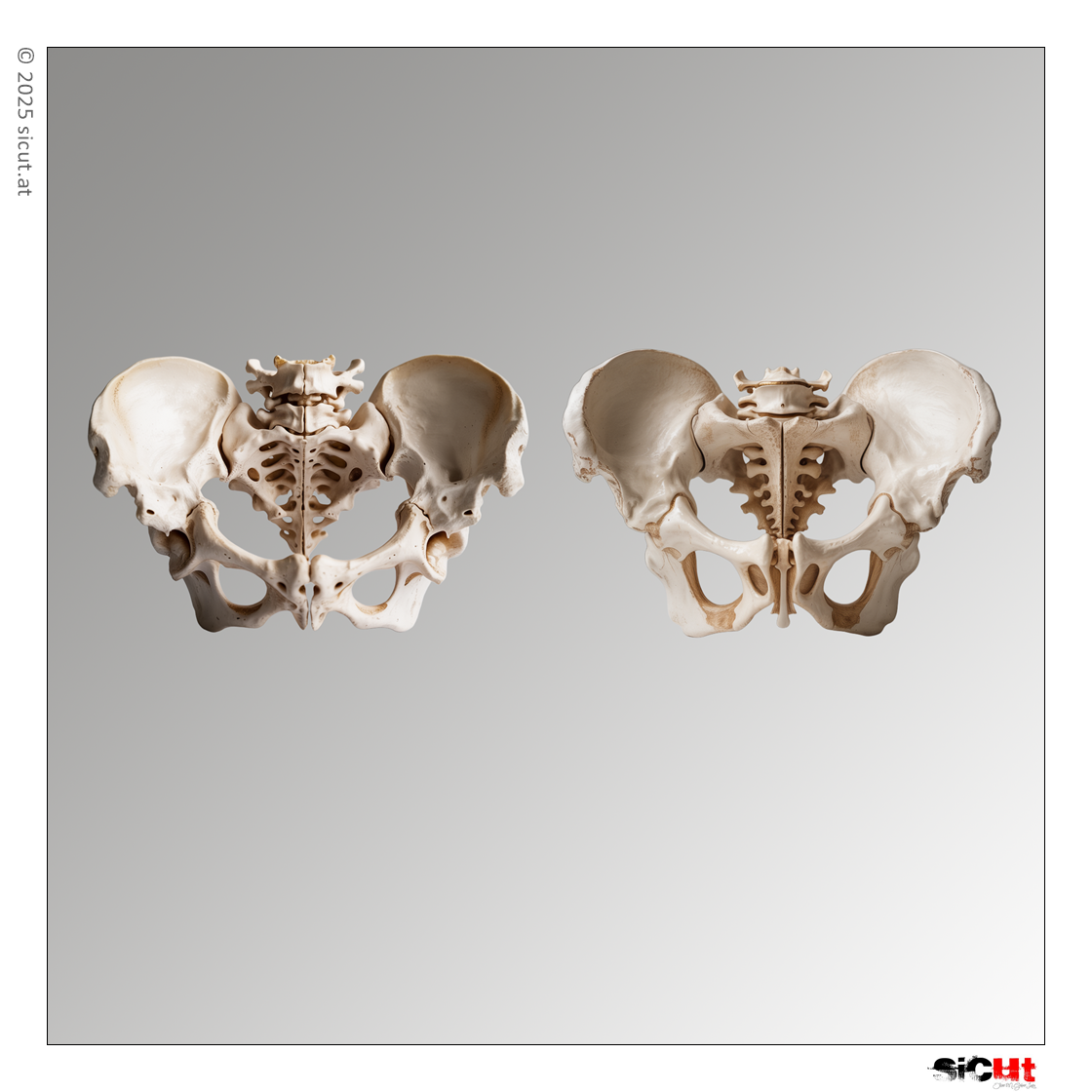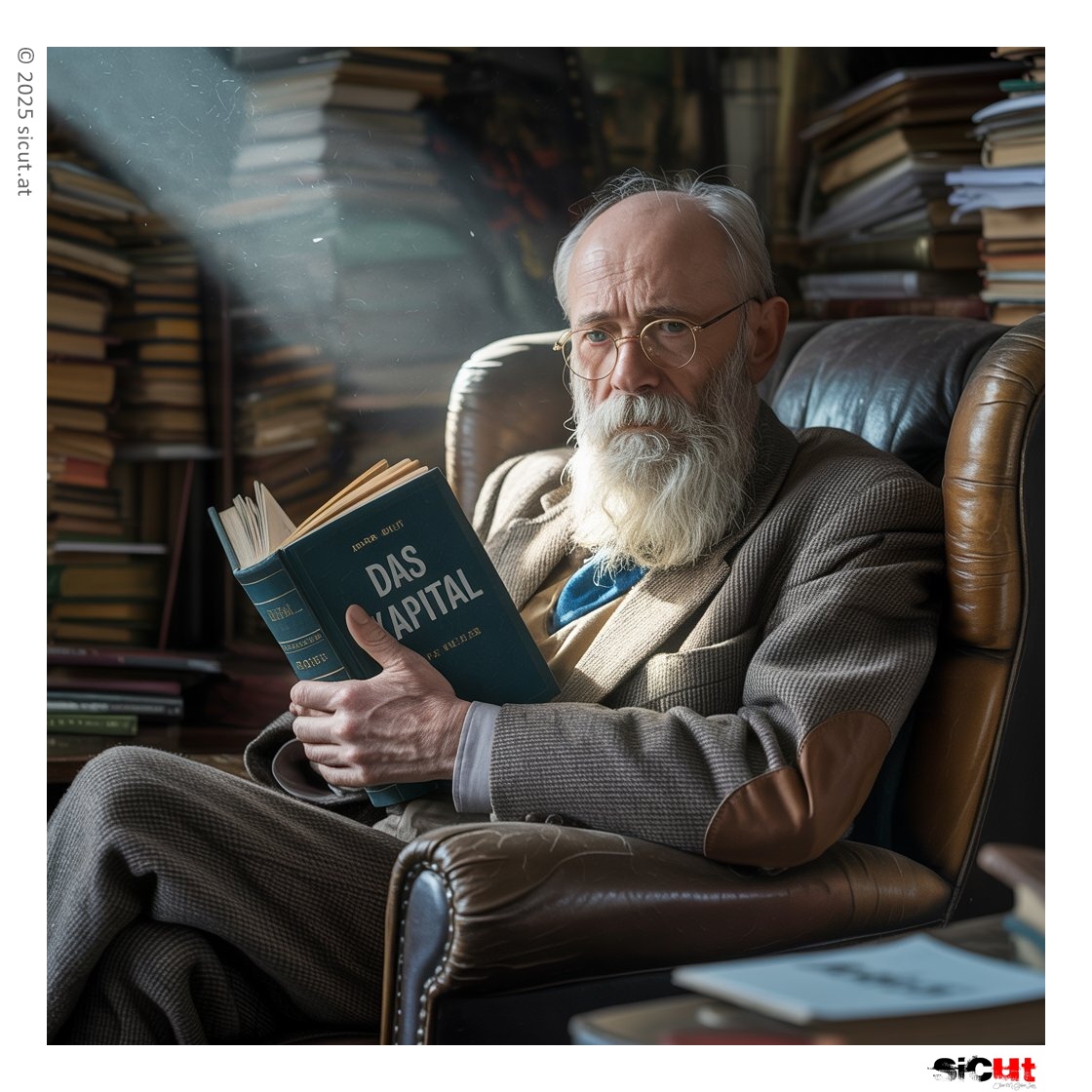In den Schaltzentralen der Republik, dort, wo früher die großen Strategen saßen – jene, die den politischen Betrieb noch mit dem gemütlichen Zynismus eines jahrzehntelang abgenutzten Ledersessels lenkten –, herrscht heute die Atmosphäre einer Versicherung, die auf den letzten Drücker versucht, einem bereits brennenden Haus eine Feuerschutzpolice zu verkaufen. Das Establishment, dieser altehrwürdige, steife Tanzklub aus steuerlich gut geölten Apparatschiks und ritualisierten Floskelschwenkern, hat sich über Jahrzehnte in einer seligen Gewissheit eingerichtet: dass es nämlich unwählbar sei, selbst wenn es unwählbar würde. Und nun muss es erleben, wie das Volk – dieses widerspenstige, oft unkooperative Wesen, das sich immerzu anmaßt, eigene Vorstellungen zu haben – die jahrzehntelang kultivierte Selbstgefälligkeit mit einer Mischung aus Müdigkeit, Belustigung und ausgewachsener Übelkeit quittiert.
Die Selbstzerstörung der großen Parteien begann nicht an einem Nachmittag, an dem jemand aus Versehen auf „Selbstauflösen“ drückte. Sie begann leise, mit hauchzarten Schritten, die zunächst klangen wie das Verrücken von Aktenordnern, die man heimlich ins Archiv des politischen Vergessens schiebt. Irgendwann aber ging das Rascheln in ein Poltern über, das Poltern in Risse im Fundament – und schließlich standen die alten Parteizentralen da wie denkmalgeschützte Gründerzeitfassaden: vorne prachtvoll restauriert, hinten im Hof seit Jahren eine Müllhalde aus strategischen Fehlentscheidungen, moralpädagogischen Anwandlungen und jener typisch deutschen Art, sich mit glühendem missionarischem Eifer in den Abgrund zu denken.
Wenn Selbstbewusstsein zur suizidalen Energiequelle wird
Es ist ein großes Missverständnis der politischen Psychologie, dass Selbstbewusstsein etwas Gutes sei. Für Individuen vielleicht. Für politische Apparate hingegen ist es ein hochgefährliches Lösungsmittel, das bei längerer Einwirkung interne Leitungen aufweicht und schließlich ganze Flügel abfallen lässt. Die klassischen Volksparteien wähnten sich stets als Säulenheilige der Republik – und machten sich dabei überflüssiger, als es selbst die kühnsten Satiriker zu hoffen gewagt hätten.
Der Anfang war harmlos: Man wollte moderner wirken, ein bisschen diverser, ein bisschen weltoffener, ein bisschen im Takt der globalen Gegenwart tanzen – und stellte dann konsterniert fest, dass man nicht tanzen kann. Dann versuchte man es trotzig mit Gegenmodernität und entdeckte dabei das Absurde: dass man auch das nicht kann. Schließlich suchte man Zuflucht in der alten Devise „Wir sind die Mitte“ – nur um festzustellen, dass die Mitte längst in Richtung Ausgang geflohen war. Und so geriet man in jenen Zustand, in dem Menschen anfangen, sich wackelnde Möbel gerne selbst festzuschrauben, nur um dabei den ganzen Schrank einzureißen.
Die parteipolitische Selbstzerstörung des Establishments ist vor allem ein psychologisches Phänomen: Parteien, die sich für unverzichtbar halten, fangen irgendwann an, die Realität als beleidigenden Zwischenfall zu interpretieren.
Der Nimbus des Unvermeidlichen – und sein schiefer Abgang
In Deutschland war lange Zeit eine Überzeugung heilig: Dass das System, so wie es ist, immer schon richtig war. Die großen Parteien hielten sich für die steinernen Pfeiler einer demokratischen Kathedrale, die notfalls auch ohne Gottesdienstbesucher auskommt. Man hatte totale Kontrolle über das Personal, über die Themen, über den Ton – oder glaubte es zumindest. Man hielt sich für die feuilletonistische Elite des Politischen: stilvoll, reich an Erfahrung, unverzichtbar und in der Lage, jede Krise in eine Talkshow-Dekoration zu verwandeln.
Doch dann, wie es immer ist, wenn Institutionen sich selbst zu wichtig nehmen, begann das Establishment, seine eigene Unersetzlichkeit mit wachsender Inbrunst zu beweisen. Je stärker es wackelte, desto entschlossener hamsterten seine Vertreter moralische Selbstvergewisserung: Die eigenen Positionen wurden immer mehr zur Glaubensfrage – und Glaubensfragen haben bekanntlich die unangenehme Eigenschaft, Realität nicht zu benötigen. Während draußen die Republik sich langsam in eine Vielstimmigkeit verwandelte, die nicht mehr so einfach zu managen war, machten die großen Parteien weiter, als könnten sie bloße Verschleißerscheinungen durch dekorative Werteformulierungen petrifizieren.
So geschah das Unvermeidliche: Die Parteien begannen, gegen die eigene Wählerschaft zu regieren – und taten so, als sei es umgekehrt.
Flucht nach vorne: Wenn der Abstieg moralisch aufgeladen wird
Keine Bewegung zerstört sich schneller als diejenige, die ihren Niedergang als moralische Mission missversteht. Also tat man das Offensichtliche: Man beschloss, nicht mehr zu überzeugen, sondern zu erziehen. Dass Erziehung nie funktioniert, wenn Erwachsene sich von anderen Erwachsenen erziehen lassen sollen, war dabei ein kleines Detail, das man großzügig übersah.
Die Parteien, die einst versprachen, Volksparteien zu sein, verwandelten sich in lärmende Kurse zur politischen Selbstoptimierung. Jedes Thema wurde zum Prüfstein der Tugend, jede Abweichung zu einer potenziellen Majestätsbeleidigung gegenüber der großen, moralisch aufgeladenen Erzählung, die man lieber pflegte als die eigene Programmatik. Das Establishment predigte – und das Volk hörte zu, wie man einem Verkehrsunfall zusieht: mit Fassungslosigkeit, aber auch einer dissoziativen Neugier, wie weit die Sache wohl noch gehen würde.
Und dann ging sie weit.
Der letzte Tanz der Großen: Eine Operette ohne Orchester
Während die Risse im System zu Schluchten wurden, entschlossen sich die altgedienten Parteien, metaphorisch die Geige auszupacken – doch das Orchester war längst davongelaufen. Sie gestikulierten in die Leere, als führe hinter ihnen ein unsichtbares Publikum stehende Ovationen auf. Die Bühne war hell erleuchtet, die Zuschauertribüne dunkel – und niemand bemerkte, dass keiner mehr im Saal saß.
So kommt es, dass das politische Establishment heute mit einer stoischen Selbstverständlichkeit gegen seine eigene Existenz arbeitet. Ein politischer Darwinismus im Selbstversuch: Wer sich besonders intensiv bemüht, niemanden mehr zu erreichen, gewinnt die interne Auszeichnung „stabil“. Man würdigt sich gegenseitig mit Preisen für politische Klugheit, die man längst verloren hat. Und irgendwann wirkt das alles wie eine jener Gesellschaften, die im 19. Jahrhundert gegründet wurden, um das Aussterben ihrer eigenen Tierart zu verwalten.
Schlussakkord: Wenn das Establishment die Revolution gegen sich selbst führt
Und nun stehen wir da – in einer politischen Landschaft, in der das Establishment in einer Mischung aus Verzweiflung und Selbstüberschätzung den größten politischen Beitrag seiner Zeit geleistet hat: seine eigene Demontage. Ironischerweise ist dies vielleicht das demokratischste, was es je getan hat. Ein Akt unfreiwilliger Selbstbefreiung, ein Ringen mit der eigenen Bedeutungslosigkeit, bei dem der Zuschauer nicht weiß, ob er applaudieren oder Trost spenden soll.
Denn in dieser seltsamen Selbstzerstörung liegt etwas zutiefst Menschliches: die Weigerung, sich zu verändern, bis die Veränderung sich selbst durchsetzt. Die Republik bleibt bestehen, aber ihre alten Parteien verhalten sich wie historische Gebäude, deren Denkmalschutz längst niemanden mehr interessiert, während in den Wohnräumen darunter Menschen tatsächlich leben wollen.
Der Witz dabei: Das Establishment wollte stets die Demokratie schützen – und hat nun durch sein Verhalten bewiesen, wie sehr die Demokratie auch ohne sein Zutun überleben kann.