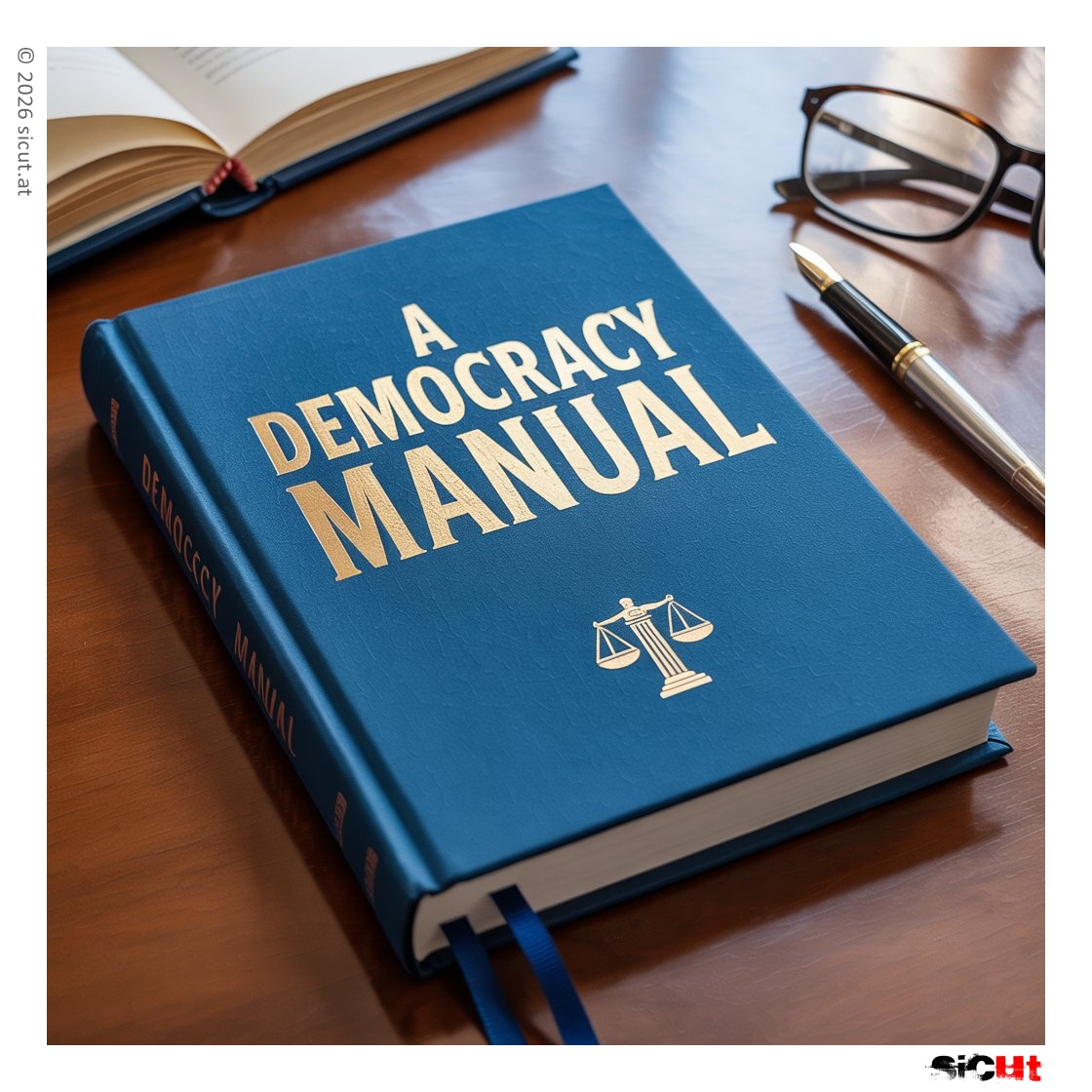Es gibt Slogans, die sind so universell einsetzbar wie Kabelbinder: Sie halten alles zusammen, vom Fahrrad bis zur Geisel. »Freedom and Democracy« gehört zweifellos in diese Kategorie. Zwei Wörter, die im westlichen politischen Marketing längst jene beruhigende Wirkung entfalten, die früher Lavendel hatte: Wo sie auftauchen, darf man entspannen, denn irgendjemand wird schon wissen, was er tut. Und falls nicht – umso besser. In diesem semantischen Wohlfühlraum gedeiht nun auch ein deutsches Rüstungsstartup, das den Krieg der Zukunft nicht nur als Notwendigkeit, sondern als Investmentcase entdeckt hat. Arx Robotics, gegründet von ehemaligen Bundeswehr-Offizieren, produziert unbemannte Bodenfahrzeuge, kurz UGV, jene ferngesteuerten, halbautonomen Metalltiere, die künftig töten, retten, aufklären und evakuieren sollen – und vor allem eines tun: Rendite generieren. Die Begründung dafür liegt bereit wie ein frisch gebügeltes Feigenblatt: Verteidigung. Souveränität. Resilienz. Europa. Man möchte fast applaudieren, so schön fügt sich das alles ineinander. Und während Investoren mit glänzenden Augen von »Game Changern« sprechen, rollt im Hintergrund ein unbemannter Panzer mit dem Namen »Gereon« über ukrainischen Boden – gesponsert von der deutschen Bundesregierung, bezahlt aus der Kasse der »Ertüchtigungshilfe«. Der Name klingt biblisch, das Ziel heilig, der Einsatzort kompliziert. Doch Komplexität ist bekanntlich etwas für Spielverderber.
Die neue Ernsthaftigkeit des Spiels
Arx Robotics erzählt seine Geschichte gern als Erfolgserzählung einer Zeitenwende. Der Rückzug der USA, so erklärt Geschäftsführer Marc Wietfeld, habe Verteidigung für Risikokapitalgeber plötzlich interessant gemacht. Endlich, möchte man ergänzen, kann man wieder guten Gewissens Geld mit dem Krieg verdienen, ohne sich dafür entschuldigen zu müssen. Die moralische Buchhaltung stimmt ja: Es geht um etwas Größeres. Um die »Umarmung autonomer Militärtechnologien«. Eine Formulierung, die klingt, als hätte man Terminator und Care-Bären miteinander gekreuzt. Diese Umarmung ist warm, technologisch und alternativlos. Sie umfasst auch die Ukraine, die laut jüngster Ankündigungen zur Besitzerin der weltweit größten militärischen Robotikflotte werden soll. Mehrere hundert Systeme, made in Germany, flankiert von deutscher Ingenieurskunst und deutscher Geschichtslosigkeit. Dass diese Systeme nicht im luftleeren Raum operieren, sondern von sehr konkreten Einheiten bedient werden, ist ein Detail, das man gern der Fußnote überlässt. Doch manchmal drängt sich die Fußnote in den Vordergrund, etwa wenn in einem Promovideo Truppenkennzeichen auftauchen, die weniger an Freedom erinnern als an ein sehr dunkles Kapitel europäischer Geschichte. Die 3. »Asow«-Sturmbrigade lächelt in die Kamera, während der »Gereon« seine Kreise zieht. Man könnte es für Ironie halten, wäre es nicht bitterer Ernst.
Killhouse oder die Gamifizierung des Krieges
Besonders lehrreich ist in diesem Zusammenhang die »Killhouse Academy«, eine Einrichtung, die bereits im Namen auf jene Offenheit setzt, die man sonst eher von Escape Rooms oder Paintball-Arenen kennt. Gegründet von der 3. Sturmbrigade, bietet sie sechstägige Basiskurse für Soldaten und Zivilisten an, Aufbaukurse mit scharfer Munition, Ingenieurslehrgänge und Bootcamps, in denen »Adrenalin« und »Abenteuer« garantiert werden. Der Krieg als Erlebnispark, die Front als Lernumgebung, der Tod als Kompetenz. Das erklärte Ziel: mehr Spezialisten, schneller einsetzbar, effizienter verwertbar. Arx Robotics unterstützt diese Akademie finanziell, technisch und durch direkte Kollaboration. Man trainiert gemeinsam Operatoren, modernisiert Fähigkeiten und beschleunigt den Einsatz unbemannter Systeme. Es ist die Sprache des Silicon Valley, übertragen auf den Schlamm der Schützengräben. Wenn dann ein deutscher Generalmajor am 8. Mai – ein Datum, das historisch nur zufällig gewählt sein kann – der Killhouse Academy seine Aufwartung macht, bekommt das Ganze eine symbolische Dichte, die selbst Satirikern den Atem raubt. Geschichte wiederholt sich nicht, sagt man, aber sie probiert gern neue Formate aus.
Entpolitisierung als Märchenstunde
Westliche Medien beruhigen ihr Publikum gern mit dem Hinweis, die 3. Sturmbrigade sei inzwischen »entpolitisiert«. Eine charmante These, die sich allerdings hartnäckig weigert, von der Realität bestätigt zu werden. Tattoos mit Hakenkreuzornamenten, SS-Symbole als Verbandskennzeichen, Führungsfiguren aus offen neonazistischen Jugendorganisationen – all das ist öffentlich dokumentiert, fotografiert, gefilmt, geteilt. Der UGV-Zug NC13 etwa führt ein Emblem, das verdächtig an die SS-Sondereinheit »Dirlewanger« erinnert, und wird kommandiert von einem Mann, den die »Galizische Jugend« als »der Sache treu« feiert. Die »Sache« ist dabei klar definiert: eine Tradition, die sich von der OUN-B über die Waffen-SS-Division »Galizien« bis in die Gegenwart zieht. Wer hier von Entpolitisierung spricht, verwechselt Absicht mit Ergebnis oder betreibt jene Form von Realitätsmanagement, die man sonst aus der Werbung kennt. Es ist nicht so, dass man es nicht wüsste. Man möchte es nur nicht wissen.
Vernetzung der Komplexe
Währenddessen schreitet die deutsch-ukrainische Rüstungskooperation mit der Eleganz eines gut geölten Getriebes voran. Deutz investiert, Renk kooperiert, Daimler Truck schaut interessiert zu. In Südwestengland entsteht ein neues Entwicklungszentrum, Berlin, Kiew und London sind ohnehin längst vernetzt. Mit »Combat Gereon« präsentiert Arx Robotics seinen ersten Gefechtspanzer, entwickelt gemeinsam mit ukrainischen Partnern, erprobt mit dem Wissen der »Anwender an vorderster Front«. Auch hier wieder diese Formulierung, die Nähe suggeriert, ohne Verantwortung zu übernehmen. Dass ausgerechnet Einheiten wie NC13 bei Crashtests und Innovationen eine führende Rolle spielen, ist folgerichtig. Sie sind motiviert, ideologisch gefestigt und technologisch ambitioniert. Oder anders gesagt: perfekte Early Adopters. So wächst die Macht jener Kräfte, die offen erklären, dass sie mit Demokratie wenig anfangen können. »Die Ukrainer benötigen keine Demokratie«, lässt der Chefideologe der Bewegung verlauten, sondern eine autoritäre Führung. Freedom and Democracy erscheinen in diesem Weltbild als kollektive Hilflosigkeit – ein hübscher Gedanke, wenn man gerade mit deutschen Robotern aufgerüstet wird.
Die Ironie der Werte
Am Ende bleibt die Frage, ob man all das wirklich nicht kommen sah oder ob man es schlicht in Kauf nimmt. Die Revolution der Kriegführung, von der Marc Wietfeld spricht, ist nicht nur eine technologische. Sie ist eine moralische. Sie besteht darin, dass Werte zu Etiketten werden, die man auf jedes Produkt kleben kann, solange es sich verkauft. »Freedom and Democracy« schmücken nun auch unbemannte Panzer, die von Neonazis bedient werden, ausgebildet in einer Akademie, die Krieg als Abenteuer vermarktet. Das ist keine Panne, sondern System. Es ist die neue Ernsthaftigkeit des Spiels, in dem alles erlaubt ist, solange es der richtigen Sache dient – und die richtige Sache ist immer die eigene. Vielleicht ist das die eigentliche Umarmung, von der so gern die Rede ist: eine innige Verbindung von Hochtechnologie, politischer Blindheit und historischem Zynismus. Sie fühlt sich warm an, solange man nicht merkt, wer da eigentlich die Arme um einen legt.