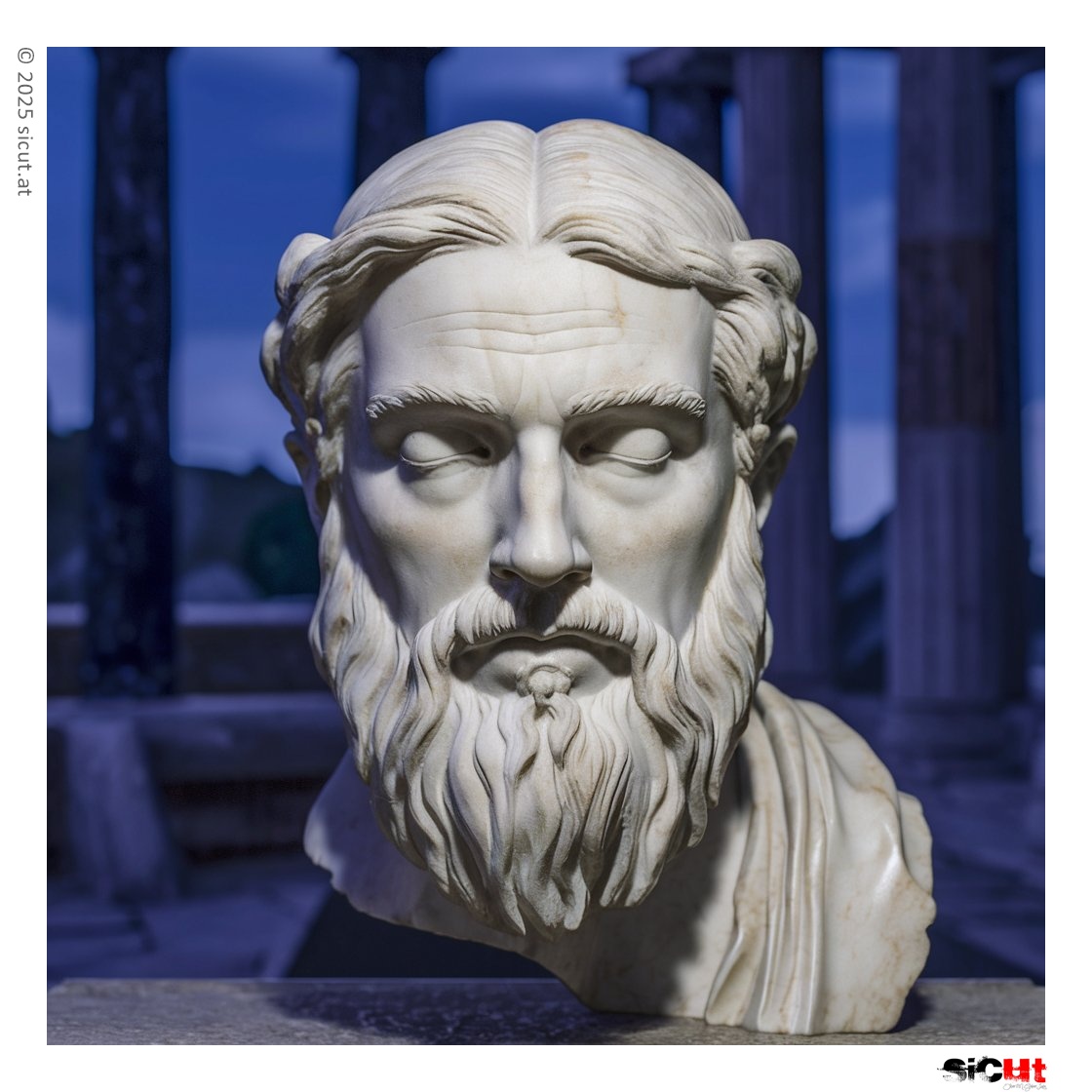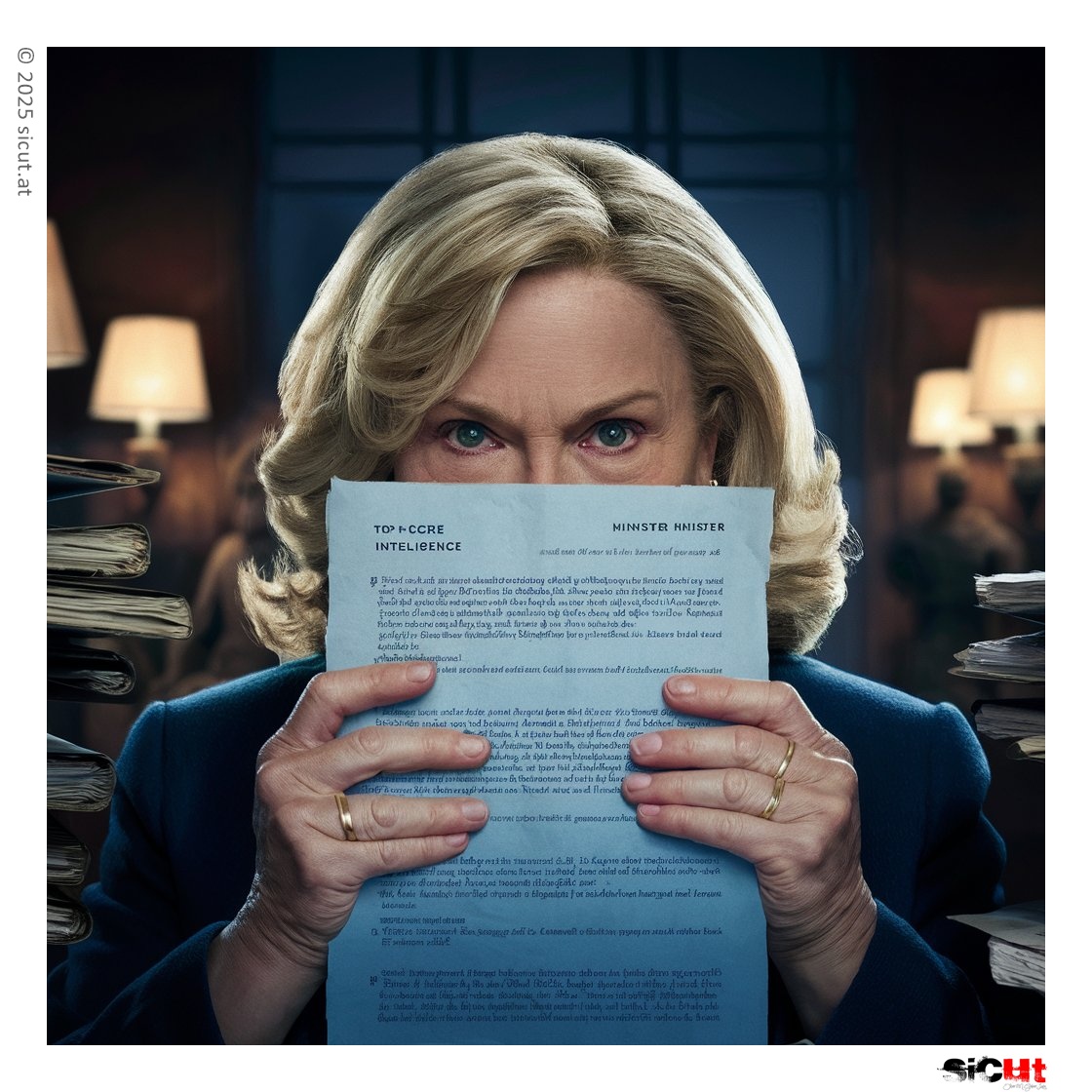Lina E., die Hammerbande und die Kunst des Zuschlagens
Es brechen die morschen Knochen, wenn der Hammer das Argument ersetzt. Und während sich mancher noch fragt, wo genau links aufhört und Gewalt beginnt, haben Lina E. und ihre Hammerbande längst die Schwelle überschritten – selbstverständlich mit Haltung. Wer früher Flugblätter verteilte, wirft heute Pflastersteine, und wer früher diskutierte, reicht heute beim Kulturamt ein Konzept ein: „Performative Deeskalation durch gezielte Eskalation im urbanen Raum“ – oder kurz: Zuschlagen mit Haltung. Dafür gab’s kürzlich den Kunstpreis. Für eine Schlägerin.
Von der Tugend zur Tugendterrorzelle – Eine Evolutionsgeschichte in schwarz vermummt
Es war einmal eine Bewegung. Geboren im Widerstand, genährt von der Hoffnung, dem Faschismus nie wieder die Straße zu überlassen. Damals, als Antifa noch etwas mit Haltung zu tun hatte und nicht mit hashtags, Black Block-Choreografien und Debattenverweigerung. Heute wirkt selbst der wutverzerrte Straßenkampf von 1984 wie ein nostalgisches Schattenspiel verglichen mit dem performativen Furor einer Lina E., die mit dem Pressesprecherblick den Vorschlaghammer schwingt – und dabei stets korrekt gendert.
Der Diskurs als Domina – Wer Argumente liebt, wird geprügelt
Argumente sind von gestern. Sie sind unsexy. Sie sind verdächtig. Denn wo das moralisch aufgeladene Bauchgefühl regiert, wird das Nachfragen zur Mikroaggression. Der neue Diskurs ist kein Gespräch mehr, sondern ein Casting für die nächste Ausladung. Und wer im falschen Moment fragt, ob das wirklich so gemeint war, steht schneller auf der digitalen Abschussliste als Lina E. ihren Hammer heben kann. Ihre Schlagkraft ist inzwischen kulturell kodifiziert – zwischen „Zivilcourage“ und „Handlungsdruck“.
Kampf gegen rechts – oder gegen alles, was nicht mitprügelt?
Früher stand man gegen den autoritären Staat. Heute steht man gegen alles, was auch nur nach differenzierter Meinung riecht. Wer fragt, wird verdächtig. Wer argumentiert, ist ein potenzieller Kollaborateur. Und wer die Ideologie nicht vollständig mitsingt, darf gerne als Faschist zweitverwertet werden. Die neue Antifa ist kein Schild mehr – sie ist ein Spiegel: Sie kämpft nicht gegen das Böse, sondern gegen die Abweichung. Und das mit zunehmend autoritären Mitteln. Wer Lina E. kritisiert, braucht Polizeischutz – oder besser noch: eine Therapiegruppe.
Ironie? Kann weg. Ernst ist das neue Schwarz
Humor war mal Widerstand. Heute ist er Verbrechen. Die einzige erlaubte Satire ist jene, die man vorher schriftlich einreicht und mit Triggerwarnung versieht. Lina E. lacht nicht. Ihre Bewegung auch nicht. Gelacht wird nur über die „Boomer“, die glauben, man könne Diskussionen gewinnen. Der neue Humor ist korrekt, sanitär, akademisch zertifiziert – und in seinen besten Momenten so spitz wie ein abgerundeter Gummiknüppel.
Der Feind in der Fratze des Verbündeten
So bleibt uns ein Trümmerhaufen aus moralischem Furor, sprachlicher Exorzistik und aktivistischer Selbstbefriedigung. Die Fahne weht – aber nicht mehr im Wind der Freiheit, sondern im klebrigen Dunstkreis selbstgerechter Empörung. Lina E. wird eingeladen, ihre Tat zu erklären – als Kunstperformance. Die Hammerbande bekommt Applaus von Intellektuellen, die einst noch für Menschenrechte stritten. Und der Diskurs? Der liegt zerschlagen am Boden. Ein Splitter davon steckt vielleicht noch in deinem Tweet.