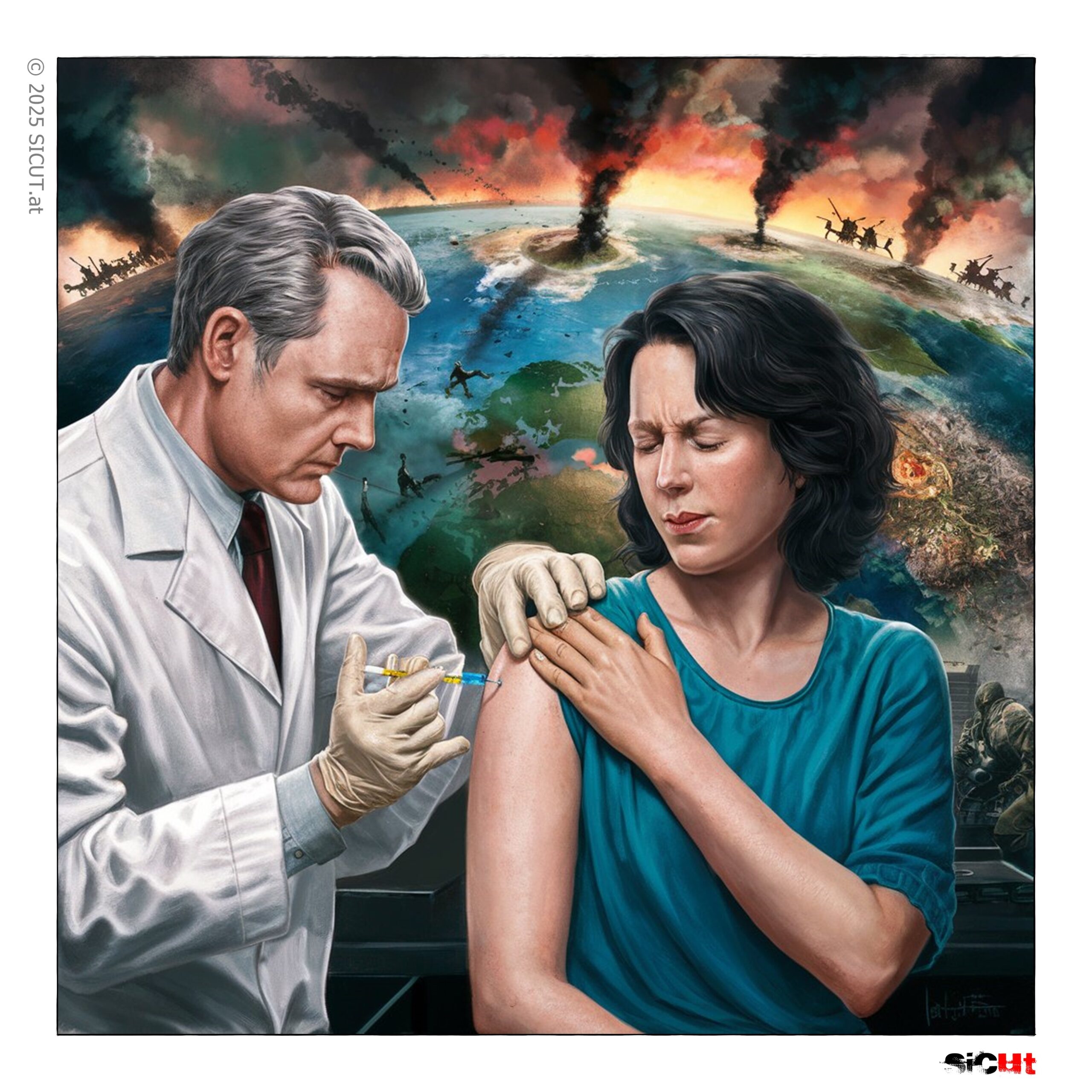Wie eine ungewählte Kommission Exekutive und Legislative in sich vereint
Man sagt, die Europäische Union sei ein Leuchtturm der Demokratie, eine Bastion der Freiheit, eine Zuflucht der Menschenrechte und eine Verteidigerin der europäischen Werte. Eine solche Behauptung könnte fast als Satire durchgehen, wäre sie nicht todernst gemeint. Denn bei näherer Betrachtung entpuppt sich dieses edle Narrativ als eine Meisterleistung politischer Illusion – eine perfekt inszenierte Maskerade, unter der sich eine technokratische Hydra verbirgt, die demokratische Kontrolle bestenfalls als störendes Relikt aus vergangenen Zeiten betrachtet.
Eine moderne Polit-Oligarchie
Beginnen wir mit der Grundstruktur: Die Europäische Kommission, dieses ebenso mächtige wie nebulöse Gebilde, ist weder direkt gewählt noch in irgendeiner Weise durch das gemeine Volk beeinflusst. Ihre Mitglieder – euphemistisch als „Kommissare“ bezeichnet, um den Anschein von Sachlichkeit zu wahren – werden vielmehr von den Regierungen der Mitgliedsstaaten hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und anschließend vom Europäischen Parlament in einer Art Schaulauf-Prozedur „abgesegnet“. Eine echte Wahl? Fehlanzeige. Direkte demokratische Legitimation? Ein Fremdwort.
Und doch ist es diese Kommission, die als Exekutive nicht nur die Verwaltung der Union übernimmt, sondern auch als eine Art legislative Vorhut fungiert, indem sie die alleinige Befugnis zur Gesetzesinitiative innehat. Das Europäische Parlament, dieses auf den ersten Blick so feierlich demokratische Gremium, darf über Gesetze debattieren und abstimmen, ja, aber es darf keine eigenen Gesetze vorschlagen. In der Praxis bedeutet das, dass das demokratisch gewählte Organ der EU lediglich über das abstimmen darf, was eine nicht demokratisch gewählte Institution ihm vorsetzt. Mit anderen Worten: Der europäische Bürger wählt Abgeordnete, die ihm nur begrenzten Einfluss auf politische Entscheidungen garantieren können. Man muss schon ein besonderer Anhänger demokratischer Pantomimen sein, um darin noch Volkssouveränität zu erkennen.
Das Märchen vom Sachverstand
Ein beliebtes Argument zur Verteidigung dieses Systems lautet, dass die Kommissare Fachleute und keine Politiker seien. Die Verwaltung eines so komplexen Gebildes wie der EU erfordere eben Expertenwissen, das nicht von Launen der Wähler oder dem Unvermögen gewählter Volksvertreter abhängen dürfe. Eine nette Theorie – wäre da nicht die unangenehme Realität, dass viele Kommissare ihre „Expertise“ nicht selten aus dem politischen Nepotismus ihres Heimatlandes beziehen und in der Regel aus den gleichen Parteien stammen wie jene Regierungschefs, die sie nominiert haben. Man braucht also kein Verschwörungstheoretiker zu sein, um darin ein geschicktes System der politischen Selbstreproduktion zu erkennen, das mit demokratischen Prinzipien ungefähr so viel zu tun hat wie ein Lobbyist mit uneigennütziger Gemeinwohlorientierung.
Eine Tugend, keine Schwäche
Die Kluft zwischen europäischer Politik und ihren Bürgern ist legendär. Und sie ist kein Unfall. Sie ist auch keine Fehlfunktion des Systems, sondern ein integraler Bestandteil desselben. Während nationale Politiker sich immerhin noch in regelmäßigen Abständen einer Wahl stellen müssen, um ihr Handeln rechtfertigen zu können, bleibt die EU-Kommission von solchen Unannehmlichkeiten weitgehend verschont. Man muss sich die Situation einmal plastisch vorstellen: Ein Gremium, das Gesetze vorschlägt, Wirtschaftsstrategien festlegt und politische Weichenstellungen für einen ganzen Kontinent trifft, kann nicht vom Volk abgewählt werden. Klingt demokratisch? Wohl kaum.
Trotzdem hat sich eine absurde Rhetorik durchgesetzt, die genau das Gegenteil behauptet: Die Demokratie müsse vor den Wählern geschützt werden. Schließlich sei es besser, wenn rationale, unaufgeregte Technokraten die Geschicke Europas leiten, anstatt populistische Demagogen, die allzu oft auf den billigen Applaus der Massen schielen. Und so bleibt die Macht in den Händen der „Vernünftigen“ – oder besser gesagt: der Unantastbaren.
Eine Demokratie ohne Volk
Die Europäische Union ist in vielerlei Hinsicht ein politisches Meisterwerk. Sie hat es geschafft, demokratische Mechanismen so zu simulieren, dass sie den Anschein von Bürgerbeteiligung erwecken, während sie gleichzeitig sicherstellt, dass die wahre Macht in den Händen einer kleinen Elite bleibt. Das EU-Parlament mag gewählt werden, doch es hat weniger Befugnisse als ein nationaler Stadtrat. Die Kommission ist das Herzstück der Macht, aber sie entzieht sich jeder direkten Kontrolle durch das Volk. Und der Bürger? Der darf bei der nächsten Wahl sein Kreuz machen – für ein Parlament, das nicht initiativ sein darf, und gegen eine Kommission, die ihm in ihrer jetzigen Form erhalten bleibt.
Vielleicht ist das der größte Triumph der europäischen Integration: Die perfekte Illusion einer Demokratie, die ohne Volk auskommt. Eine Demokratie ohne Wahlen. Eine Demokratie ohne direkte Mitbestimmung. Kurz: Eine Demokratie, die keine ist.