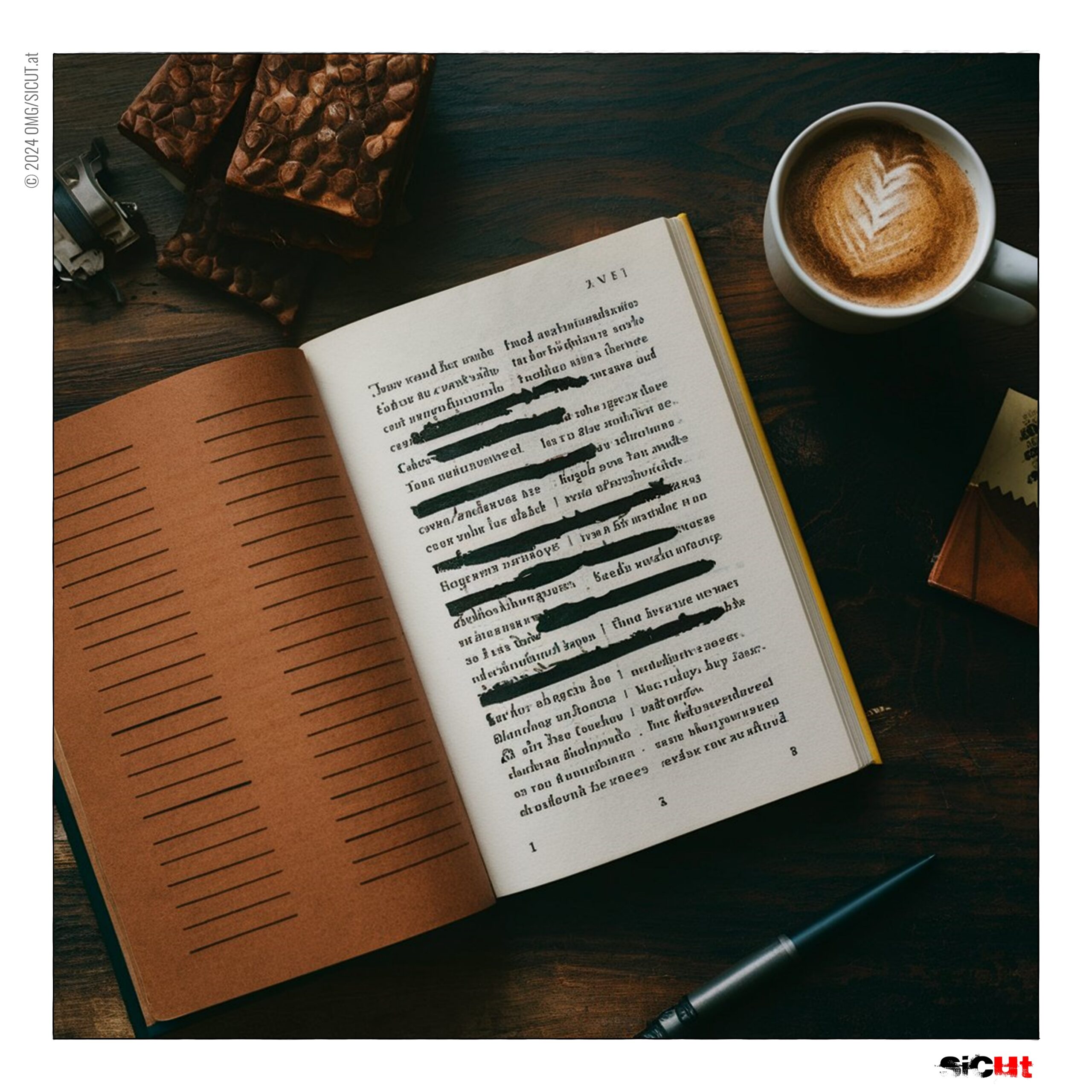Aus dem Leben eines Kartoffel-Menschen im besten Deutschland aller Zeiten
Es war einmal in einem Land, das sich rühmt, das beste aller Zeiten zu sein – politisch korrekt, klimabewusst, stets bemüht um die Gleichstellung aller und dabei so hypermoralisch, dass selbst Kant rot anlaufen würde vor Scham. Doch mitten in diesem Garten Eden der Tugendhaftigkeit lebt ein seltsames Wesen, dessen Existenz immer mehr zum Rätsel wird: der Kartoffel-Mensch. Dieses unauffällige Geschöpf, das in der Hochblüte seiner Post-Moderne irgendwie immer noch nach Kohl und Klöße riecht, steht plötzlich im Zentrum eines kulturellen Spektakels, das es in sich hat. Ein Drama in mehreren Akten, eine Tragikomödie epischen Ausmaßes. Wer ist dieser Kartoffel-Mensch? Was hat er verbrochen? Oder ist es vielleicht gerade sein Unvermögen, wirklich „verbrechen“ zu können, das ihn so gefährlich macht?
Die Tragik des blassen Teints
Der Kartoffel-Mensch – eine Kreatur, die man leicht an ihrer blassen Haut und ihrem tief verwurzelten Hang zur Ordnung erkennt. Schon dieser Teint allein ist seine erste Sünde im besten Deutschland aller Zeiten. Die Tatsache, dass er sich weigert, einen gesunden Sommerbronzeton anzunehmen, wird ihm mittlerweile fast genauso übelgenommen wie seine altbackenen Essgewohnheiten. Bratkartoffeln mit Speck? Bitte, wer isst sowas noch, wo doch Quinoa-Bowls und Avocado-Toast das Frühstück der Wahl für die Generation „Selfcare“ sind? Man muss sich fragen, ob der Kartoffel-Mensch nicht längst ein Relikt vergangener Tage ist – ein schaler, unbequemer Zeuge der Zeit, in der Deutschland noch nicht global, offen und divers genug war, um endlich modern zu sein.
Die Gesellschaft schaut ihn mit leicht angewidertem Mitleid an, während er sich morgens sein Wurstbrot schmiert. „Wurst? In Zeiten von pflanzlichen Alternativen?“ Die moralische Entrüstung, die in den Augen der woke Avantgarde aufblitzt, ist unübersehbar. Veganer, die für den Klimaschutz auf die Barrikaden gehen, während sie nonchalant im SUV zur Fridays for Future-Demo rollen, machen dem Kartoffel-Menschen klar, dass seine bloße Existenz ein Affront gegen die neue Ordnung ist. Schlimmer noch: Sein Verbrechen ist die Passivität. Denn in einer Welt, die sich rasant verändert, ist Stehenbleiben gleichbedeutend mit Rückschritt.
Wenn Dialekt zur Gewalt wird
In der Schule seiner Kinder wird der Kartoffel-Mensch zunehmend zum Fremden im eigenen Land. Plötzlich sind es Begriffe wie „white privilege“, „toxische Männlichkeit“ und „Dekolonialisierung“, die im Schulunterricht zur Sprache kommen. Der Kartoffel-Mensch starrt auf die Schulhefte seines Sohnes und sucht vergeblich nach den „alten, bewährten Werten“. Stattdessen wird ihm klar, dass sein Deutsch – geprägt von Dialekt und Umgangssprache – zur Makel geworden ist. In einer Welt, die sich sprachlich um „sensible Formulierungen“ windet wie ein Aal, hat seine alte Kartoffelsprache keinen Platz mehr. Sätze wie „Na, wie geht’s?“ gelten nun als übergriffig. Wer fragt schon nach Befindlichkeiten, wenn er nicht vorher eine Erklärung über die kulturelle Herkunft der Gesprächspartner einholt?
Und da ist er nun, der Kartoffel-Mensch, gefangen in seinem eigenen Land, unfähig, die neue Sprache der Erlösung zu sprechen. Die ironische Erkenntnis: Der Kartoffel-Mensch, der in seiner Naivität dachte, er sei der Norm, das Zentrum, der Durchschnitt – wird zunehmend marginalisiert. Ein echter Exot im Deutschland der Hyper-Inklusion. Es stellt sich die Frage, ob er je Teil der „vielen Geschichten“ war, die heute endlich erzählt werden dürfen, oder ob er einfach nur die langweilige, zu oft wiederholte Anekdote der Geschichte ist, die keiner mehr hören will.
Auf der Flucht vor dem eigenen Privileg
In einer Welt, die von struktureller Ungerechtigkeit und historischem Unrecht durchzogen ist, ist der Kartoffel-Mensch per Definition schuldig. Er gehört zur Tätergruppe – so viel steht fest. Aber wofür genau? Gute Frage. Es ist eben dieses diffuse Gefühl der Schuld, das ihn umhüllt wie ein unheilvolles Nebelmeer. Sein größtes Verbrechen? Die Tatsache, dass er nichts dafür getan hat, die Welt zu retten. Er trägt keine politischen Sticker auf seiner Jutetasche, er hat sich noch nie an eine Straßenkreuzung geklebt, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren, und er lebt immer noch in einer Eigentumswohnung, deren Quadratmeterzahl ihm das Kainsmal der Gentrifizierung einbringt.
Ja, der Kartoffel-Mensch ist schuldig – und zwar nicht nur individuell, sondern systemisch. Ihm gehört dieses Land, er hat es geerbt. Ein Privileg, das er weder verdient noch jemals infrage gestellt hat. Sein Privileg ist seine Bürde. Jeden Tag, an dem er durch die Straßen geht, prallen die Mikroaggressionen der Realität auf ihn zurück. Ein böser Blick im Bus, weil er nicht energisch genug für „Climate Justice“ gestimmt hat. Eine empörte Reaktion an der Supermarktkasse, weil er Milch statt Haferdrink kauft. Seine bloße Existenz ist ein ständiger Vorwurf.
Das Integrationsdebakel
Während die Welt immer neue Anstrengungen unternimmt, Migranten zu integrieren, merkt der Kartoffel-Mensch, dass er selbst derjenige ist, der sich anpassen muss. In den städtischen Verwaltungsbüros, wo einst seine Eltern ihre Steuererklärungen in tristem Grau ablieferten, weht heute ein frischer Wind der Diversität. Multikulti ist das neue Mantra, und der Kartoffel-Mensch steht davor wie ein archaisches Fossil. Ein 1-Euro-Schein, der inmitten von Bitcoin und Ethereum versucht, relevant zu bleiben.
Als er eines Tages bei der örtlichen Bürgerberatung um Unterstützung bittet, ist der Kafkaeske Moment perfekt: „Wollen Sie etwa keinen Sprachkurs machen?“ fragt ihn der Mitarbeiter hinter der Glasscheibe. „Sprachkurs?“, fragt der Kartoffel-Mensch, sich bewusst werdend, dass er längst zu einem Fremdkörper im eigenen Land geworden ist. Vielleicht liegt das Problem bei ihm. Vielleicht ist die Welt einfach zu kompliziert, zu vielfältig, zu modern geworden. Während er draußen in seinen Rollkragenpullover steigt und seine Jutetasche (ohne Sticker) an sich drückt, fühlt er, wie sich das Gewicht der Geschichte auf seine Schultern legt. „Die Vergangenheit, die du nicht aufarbeiten willst, holt dich ein“, ruft ihm die Stadt zu.
Hoffnungslos nostalgisch
Am Ende bleibt dem Kartoffel-Menschen nur der Rückzug in die eigene, schäbige Erinnerung. In die Zeiten, als alles noch einfach war. Als es keine hippen Bio-Läden, sondern noch echte Metzger gab. Als „politisch korrekt“ noch eine Redewendung und keine Religion war. Da sitzt er nun, einsam am Küchentisch, die dampfenden Kartoffeln vor sich, und schneidet seinen Kasslerbraten mit einer Melancholie, die selbst den alten deutschen Romantikern Tränen in die Augen getrieben hätte.
Doch ist das wirklich das Ende? Oder gibt es noch eine Chance auf Rettung? Eine Chance auf Integration für den Kartoffel-Menschen, der sich dem neuen Deutschland anpassen muss, ohne sich selbst zu verlieren? Ein Happy End, in dem er mit einem Lächeln auf den Lippen die moderne Welt umarmt, während er seine „Wokeness“ aus den Kartoffelreihen zieht? Man darf skeptisch sein.
Die Kartoffel revolutioniert sich selbst
Und so bleibt die moralische Frage offen: Wird der Kartoffel-Mensch den Sprung ins 21. Jahrhundert schaffen? Oder wird er, wie die Dinosaurier, den Wandel nicht überleben? Eines ist sicher: Der Kartoffel-Mensch wird weiterexistieren, irgendwo, tief in den Feldern des kulturellen Gedächtnisses. Vielleicht nicht mehr als dominierende Spezies, aber als kurioses, beinahe ausgestorbenes Relikt der guten alten Zeit. Und wer weiß, vielleicht wird in einigen Jahrhunderten einmal jemand eine Kartoffel ausgraben und sagen: „Schaut, so hat das früher mal funktioniert.“ Und dann? Dann wird sich die Welt weiterdrehen, mit oder ohne Kartoffeln.
Quellen und weiterführende Links:
- Adorno, Theodor W. Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Suhrkamp, 1951.
- Sloterdijk, Peter. Zorn und Zeit: Politisch-psychologischer Versuch. Suhrkamp, 2006.
- Habermas, Jürgen. Der gespaltene Westen: Kleine politische Schriften X. Suhrkamp, 2004.
- Beck, Ulrich. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp, 1986.
- Foucault, Michel. Die Ordnung der Dinge: Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Suhrkamp, 1966.