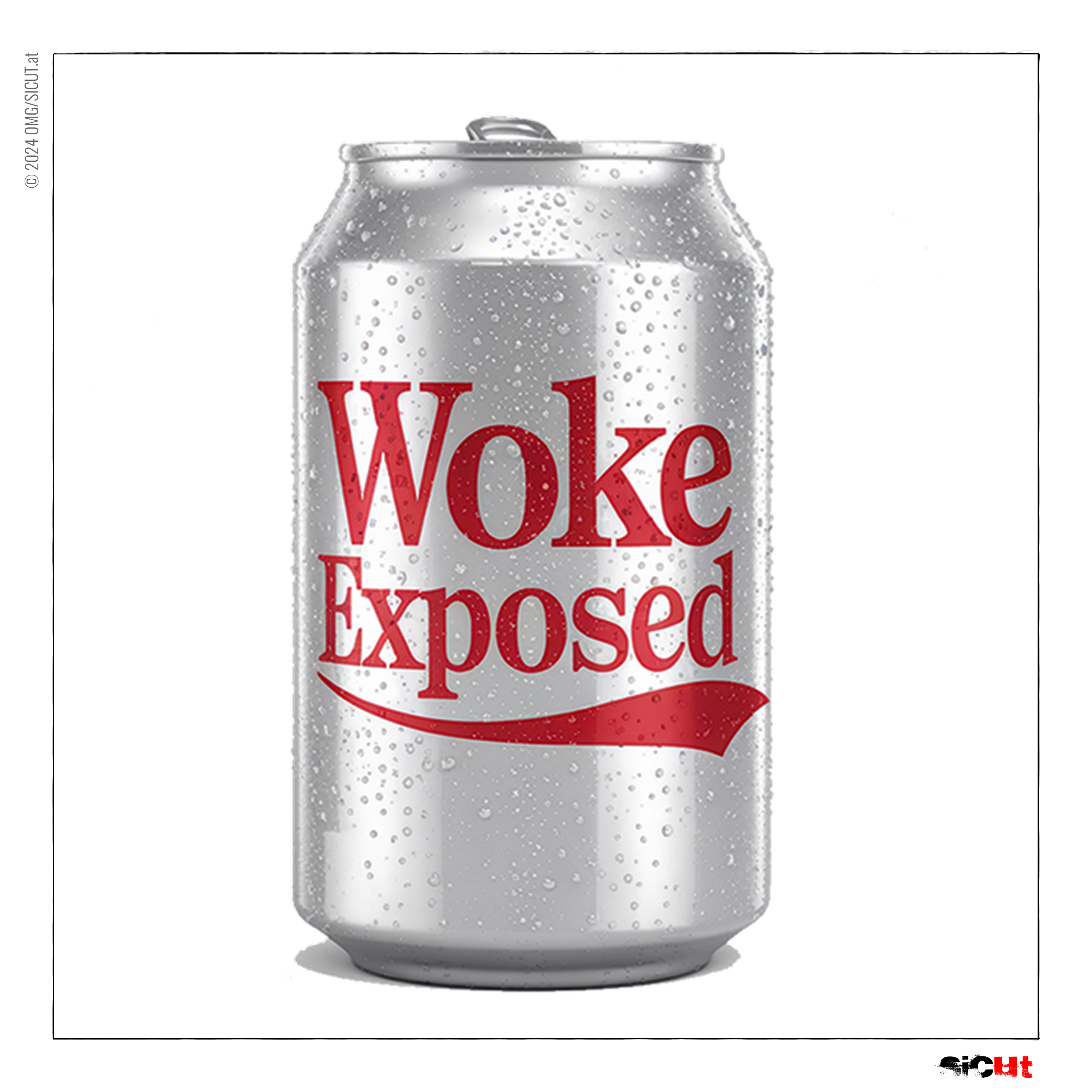Die Röntgenstrahlen der Heuchelei
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Autobahn unterwegs, die Sonne scheint, und plötzlich winkt Sie die Polizei zur Seite. Ein Routinecheck, nichts Verdächtiges. „Guten Tag, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte“, sagt der Beamte. Danach folgt – ohne eine Spur von Misstrauen – die Aufforderung zum Alkoholtest. Ihr Puls bleibt ruhig, denn Sie wissen, Sie haben keinen Tropfen angerührt. Doch halt! Da ist etwas im Hinterkopf. Eine leise Stimme, die fragt: „Warum sollte ich? Warum sollte ich mich ohne Grund einer polizeilichen Kontrolle unterziehen?“ Der Gedanke flackert auf, flackert aber nur kurz. Sie kennen die Regeln. Verweigern Sie den Test, schraubt der Gesetzgeber die Strafen in ungemütliche Höhen. Atemalkohol von 1,6 Promille wird einfach mal so unterstellt, und zack – der Führerschein ist für mindestens sechs Monate weg.
Nun, das ist die Realität für den Durchschnittsautofahrer. Die Alltagslogik: Wenn es um die Sicherheit geht, gelten Regeln, auch wenn diese vielleicht nicht immer ganz fair wirken. Sie kennen das Mantra: Die Polizei schützt die Allgemeinheit, auch wenn sie dabei Ihre Rechte strapaziert. Kein Grund zur Aufregung. Oder?
Doch was, wenn wir diese Logik auf ein anderes Terrain übertragen – sagen wir, auf die Frage nach dem Alter von Asylbewerbern? Nun, hier betritt der Präsident der deutschen Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, die Bühne der öffentlichen Moral. Altersbestimmung durch Handwurzelröntgen bei Flüchtlingen? Ein Skandal, empört er sich. Ein „Eingriff in das Menschenwohl“, ein Verstoß gegen die „körperliche Unversehrtheit“. Der moralische Zeigefinger ist hochgereckt, die Stirn tief gerunzelt. Montgomery ist besorgt, wie nur ein Arzt sein kann, dessen Berufsethos ihn verpflichtet, die Würde und Gesundheit jedes Einzelnen zu wahren.
Interessant, nicht wahr? Dieselben Gesellschaften, die uns ohne Vorwarnung ins Röhrchen blasen lassen, die uns mit drakonischen Strafen drohen, wenn wir uns gegen einen Test ohne medizinische Indikation wehren, haben plötzlich skrupulöse Bedenken, wenn es um den Schutz der „körperlichen Unversehrtheit“ von Menschen geht, deren Alter und Identität unklar sind. Aber nur, natürlich, wenn es sich um Asylbewerber handelt.
Alkoholtests als moralischer Kompass
Die Frage drängt sich auf: Warum darf der Staat bei einer vermeintlich harmlosen Alkoholkontrolle ohne Vorwarnung in die körperliche Unversehrtheit eingreifen, während es als moralisches Verbrechen gilt, das Alter eines Asylbewerbers zu überprüfen? Es ist nicht so, dass wir hier über eine banale Frage der Bürokratie sprechen. Die Altersfrage kann den Unterschied zwischen Minderjährigkeit und Erwachsenenalter ausmachen – und damit über den rechtlichen Status und die Schutzansprüche eines Menschen entscheiden. Doch während der Bürger routinemäßig ohne Einverständnis zum Alkoholtest gezwungen wird, scheut der Staat davor zurück, das Handgelenk eines Asylbewerbers unter Röntgenlicht zu stellen.
Natürlich, die moralische Empörung über Zwangsmaßnahmen, wie sie Montgomery äußert, ist auf den ersten Blick charmant. Sie verleiht ihm eine Aura des Humanismus, die ihm in der liberalen Presse Bewunderung einbringt. Der Arzt als Held, der uns vor der Unmenschlichkeit des Apparats bewahrt – wunderbar. Doch wehe, man betrachtet die Angelegenheit durch die Linse der Logik. Dann entpuppt sich der Moralapostel schnell als jemand, der nur die bequemeren moralischen Kämpfe wählt.
Eine unzumutbare Grausamkeit
Montgomerys Argument: Röntgen ohne medizinische Indikation sei ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Ein schöner Satz für die ethische Diskussion am Kaminfeuer, doch wird er der Realität gerecht? Die Handwurzelröntgen-Methode, wie sie hier ins Spiel gebracht wird, ist ein etabliertes Verfahren in der Altersbestimmung von jungen Menschen. Ärzte auf der ganzen Welt verwenden es, um zu beurteilen, ob ein Jugendlicher noch im Wachstum ist oder bereits ausgewachsen – und das in medizinischen wie auch forensischen Kontexten.
Und, ja, es stimmt: Das Röntgen bringt Strahlenbelastung mit sich. Doch setzen wir diese kurz ins Verhältnis. Die Strahlenbelastung eines Handwurzelröntgens entspricht in etwa der eines Fluges von Berlin nach München. Keine Panik also. Wir sprechen hier nicht von einer riskanten, invasiven Methode. Tatsächlich lassen sich viele Menschen regelmäßig röntgen, wenn es um ihre Gesundheit geht – und das ohne Murren. Was also ist es, das Montgomery und seine Gesinnungsgenossen so erzürnt? Es scheint fast, als würde die Diskussion nicht um das Röntgen selbst gehen, sondern um eine tiefere, ideologische Überzeugung.
Vom Saufen und Scheinheiligkeit
Und hier beginnt die Zynik der Debatte ihre hässliche Fratze zu zeigen. Der durchschnittliche deutsche Bürger, der ein Auto lenkt und ab und an ein Bier genießt, wird als potenzieller Gefahrenträger behandelt. Man vertraut ihm nicht, dass er seinen Promillepegel kennt. Er könnte lügen, er könnte betrügen – also blase er gefälligst in das Röhrchen! Und wehe, er verweigert es. Ein Verdacht muss nicht einmal bestehen; der Staat hat ein Recht, dies zu überprüfen, einfach weil er es kann. Es geht um den Schutz der Gesellschaft, sagt man uns. Sicherheit gehe vor!
Doch in der Flüchtlingsdebatte, wenn es um die Altersbestimmung geht, wandelt sich der Staat plötzlich zum Wächter der Menschenrechte. Ein einfacher Röntgentest, der zweifellos klären könnte, ob jemand minderjährig ist oder nicht – und damit die Weichen für Asylverfahren stellt – wird plötzlich zur menschenrechtsverletzenden Praxis aufgeblasen. Der Asylbewerber, so will es die Erzählung, ist unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Jede Methode, diesen Beweis zu erbringen, gilt als übergriffig, als unmoralisch, als das Werk einer unbarmherzigen Bürokratie.
Die Heuchelei der selektiven Empörung
Der schlichte Bürger mag sich jetzt fragen: Wo bleibt der Aufschrei über den Eingriff in meine körperliche Unversehrtheit? Warum ist es so selbstverständlich, dass ich mich den Strahlen einer Polizeikontrolle aussetze, während es als moralischer Skandal gilt, einen Asylbewerber, dessen Angaben womöglich widersprüchlich sind, durchleuchten zu lassen?
Es ist diese Heuchelei, die das Overtone-Fenster unserer politischen Debatte unaufhörlich verengt. Was gestern noch als vernünftige Maßnahme galt, wird heute als verwerflich dargestellt, wenn es den ideologischen Vorlieben nicht entspricht. Der Bürger, der die harten Strafen für Alkoholvergehen hinnimmt, soll nun glauben, dass dieselbe Logik nicht für jemanden gelten darf, der sich in einem Asylverfahren befindet.
Die Doppelmoral in der Strahlung
Am Ende bleibt die schlichte, aber bittere Wahrheit: Die Diskussion um die Altersbestimmung von Asylbewerbern ist keine Frage der Ethik, sondern eine der politischen Opportunität. Der moralische Kompass scheint auf wundersame Weise zu rotieren, abhängig davon, wer ihn hält. Der Autofahrer muss einstecken, der Asylbewerber wird in Watte gepackt. Und während wir uns im Kreis drehen, bleibt eines sicher: Die Doppelmoral strahlt heller als jedes Röntgenbild.
Quellen und weiterführende Links:
- Süddeutsche Zeitung: Montgomery über Alterstests
- Rechtliche Grundlagen zum Alkotest
- Handwurzelröntgen in der Altersbestimmung: Medizinische Hintergründe