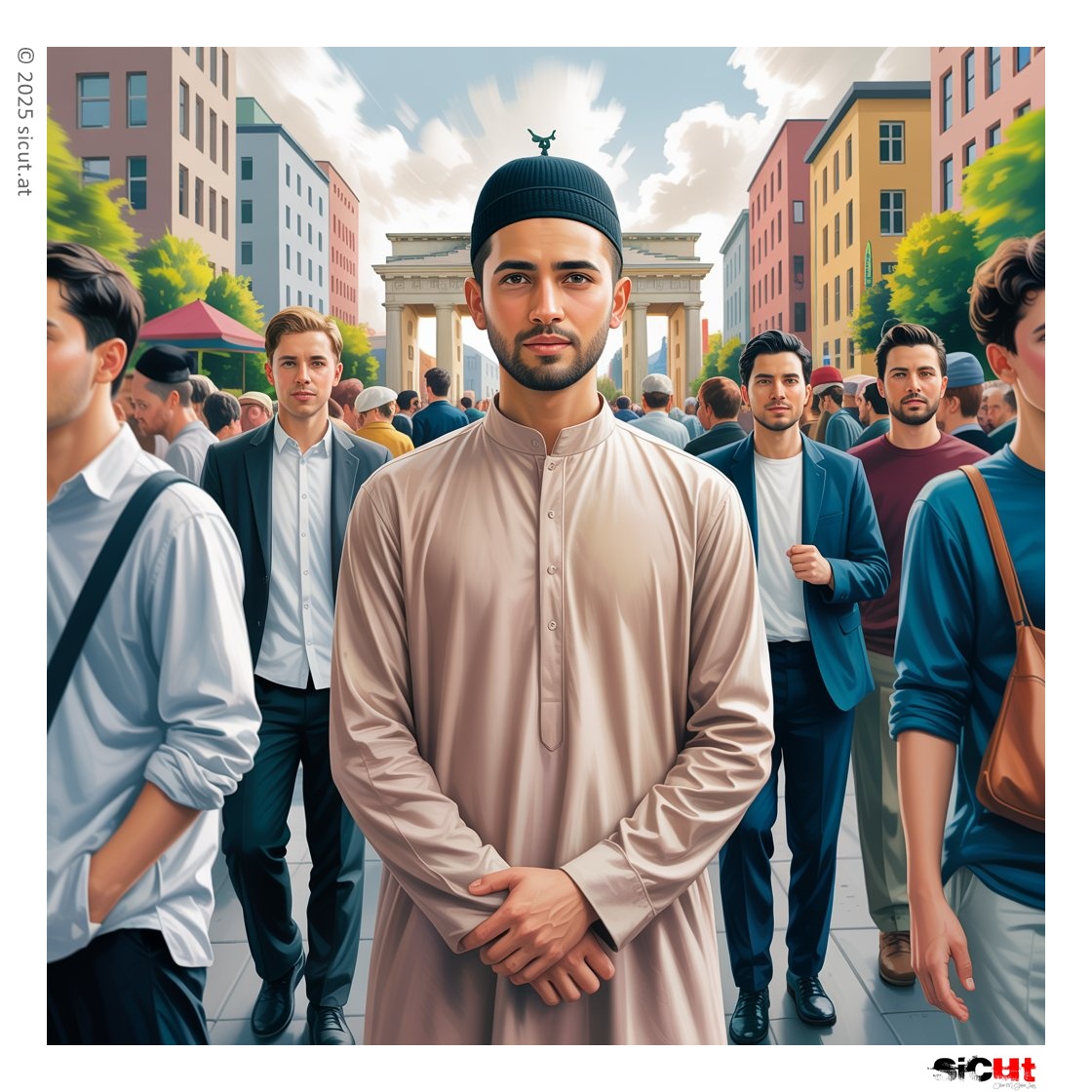Alle paar Monate öffnet der große Rummelplatz der moralischen Selbstinszenierung wieder seine Buden, und die europäische Großstadt verwandelt sich in eine Mischung aus Woodstock, Karneval und mittelalterlichem Pogrom. Nur dass heute statt Heugabeln und Fackeln Schilder aus Recyclingpappe geschwenkt werden, auf denen „Solidarität“ in schlecht gestanzten Lettern prangt. Die Schlagworte sind stets dieselben: „Freiheit“, „Menschenrechte“, „Gaza“. Manchmal verirrt sich auch ein „Kinderschutz“ darunter, was besonders grotesk wirkt, wenn im selben Atemzug die Fahnen einer Terrororganisation hochgehalten werden, die Kinder lieber als lebende Schutzschilde denn als Schutzbedürftige betrachtet.
Doch das Ritual bleibt gleich: Gaza ist die Bühne, auf der die saturierte westliche Mittelschicht ihren moralischen Fitness-Check absolviert. Einmal kräftig Empörung heben, kurz gegen Israel bankdrücken, und schon fühlt man sich innerlich wieder straff und rein. Ein politisches Pilatesstudio der Selbstgerechtigkeit.
Moral zum Mitnehmen – billig, fettig, sättigend
Die Empörung über Gaza ist die Currywurst der internationalen Politik: billig, fettig, schnell zu haben und mit genügend scharfem Gewürz, um den eigenen Geschmack an tatsächlicher Komplexität zu betäuben. Niemand interessiert sich für die innere Logik des Konflikts, die geopolitischen Zusammenhänge, oder gar für die Tatsache, dass Hamas nicht in Kitas investiert, sondern in Raketen. Aber das würde ja die Speisekarte ruinieren.
Man könnte die Demos deshalb auch als „Drive-In-Antisemitismus“ bezeichnen: Einmal am Stand der Empörung vorfahren, kurz „Free Palestine“ ins Mikrofon grölen, und zack – schon erhält man die Extraportion moralische Reinwaschung im praktischen Pappkarton.
Projektionstheater mit historischen Untertiteln
Dass es den Demonstranten kaum um Gaza geht, erkennt man daran, dass sie das Land in der Regel nicht einmal auf einer Karte zeigen könnten. Aber das spielt keine Rolle, denn Gaza ist nur die Projektionsfläche, auf die man das alte Ressentiment neu aufpinseln darf.
Früher hieß es: „Die Juden sind schuld!“ Heute heißt es: „Israel ist schuld!“ Früher brüllte man: „Juden raus!“ Heute skandiert man: „From the river to the sea!“ – was, übersetzt ins ehrliche Deutsch, nichts anderes bedeutet als „Israel weg!“ Es ist die gleiche alte Melodie, nur auf einer hippen Ukulele gezupft, statt auf der Nazi-Trommel.
Europa als moralische Freiluftpsychiatrie
Man muss es so drastisch sagen: Diese Demos sind Gruppenpsychotherapie-Sessions für eine Gesellschaft, die ihre eigene Schuldgeschichte nicht verarbeitet hat. Da pilgern die Enkel von Tätern, die Urenkel von Mitläufern und die Nachfahren der Wegseher mit leuchtenden Augen durch die Straßen und glauben ernsthaft, auf der Seite der Guten zu stehen – während sie alte Muster in neuem Gewand reproduzieren.
Es ist die pure Selbstlüge: Statt die eigene Vergangenheit zu verarbeiten, legt man sie einfach auf Israel ab wie ein Altkleiderbündel im Container. Gratisabgabe der eigenen Schuld, aber bitte mit moralischem Applaus. Gaza als seelische Müllkippe Europas.
Die tragikomische Operette der Empörung
Das Ganze wäre fast lustig, wenn es nicht so widerlich wäre. Da stehen sie mit Regenbogenfahnen neben islamistischen Fahnen, da grölen Feministinnen im Gleichklang mit patriarchalen Gotteskriegern, da marschieren Vegan-Kollektive Schulter an Schulter mit Männern, die im Gazastreifen Ziegen bei lebendigem Leib schlachten. Es ist eine Parodie auf die Parodie, ein groteskes Schattenspiel, das beweist, dass Ideologien nicht kollidieren, sondern sich im Ressentiment vereinen können.
Man könnte fast meinen, Hamas müsse den Demonstranten regelmäßig Werbeplakate schicken: „Danke, dass ihr unsere PR-Abteilung in Berlin, London und Paris übernehmt! Ohne euch wären wir nur eine lokale Terrororganisation. Mit euch sind wir ein globales Symbol!“
Fazit: Das alte Lied, jetzt als Remix
Wer noch glaubt, dass diese Demos etwas mit tatsächlicher Solidarität zu tun haben, glaubt vermutlich auch, dass McDonald’s gesunde Ernährung ist. Nein, die Wahrheit ist bitterer: Unter der Maske des Menschenfreundes lächelt die alte Fratze des Antisemiten, und sie freut sich, dass sie endlich wieder an die frische Luft darf, ohne sofort verbrannt zu werden.
Und die größte Ironie? Die Leidtragenden in Gaza, die Zivilisten, die Kinder, die Mütter – sie sind in diesem Theater nur Statisten, Requisiten, Tränen im Bühnennebel. Für sie wird kein Cent gespendet, kein Haus aufgebaut, kein Brunnen gebohrt. Aber hey – Hauptsache, das Instagram-Selfie mit dem Transparent hat 300 Likes.