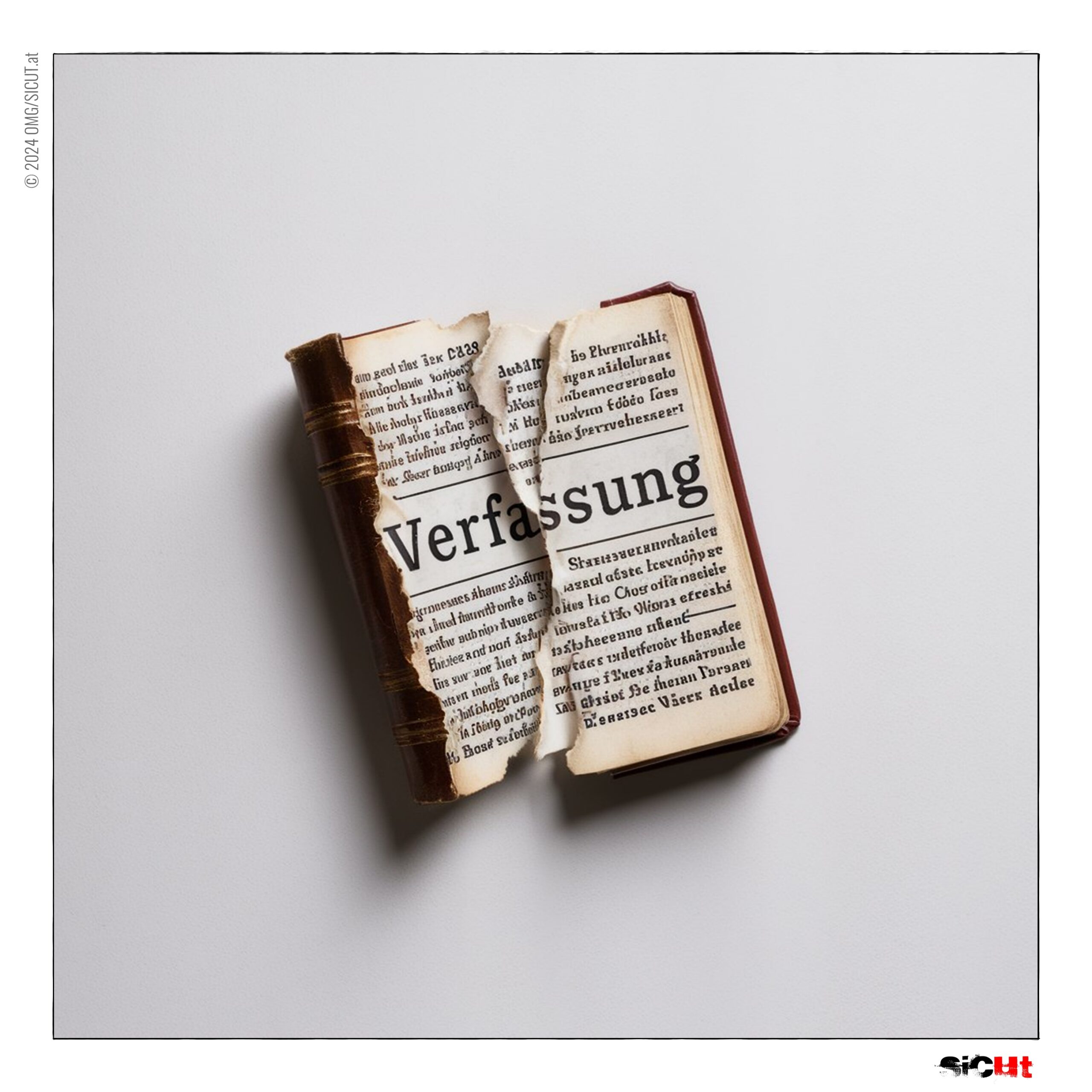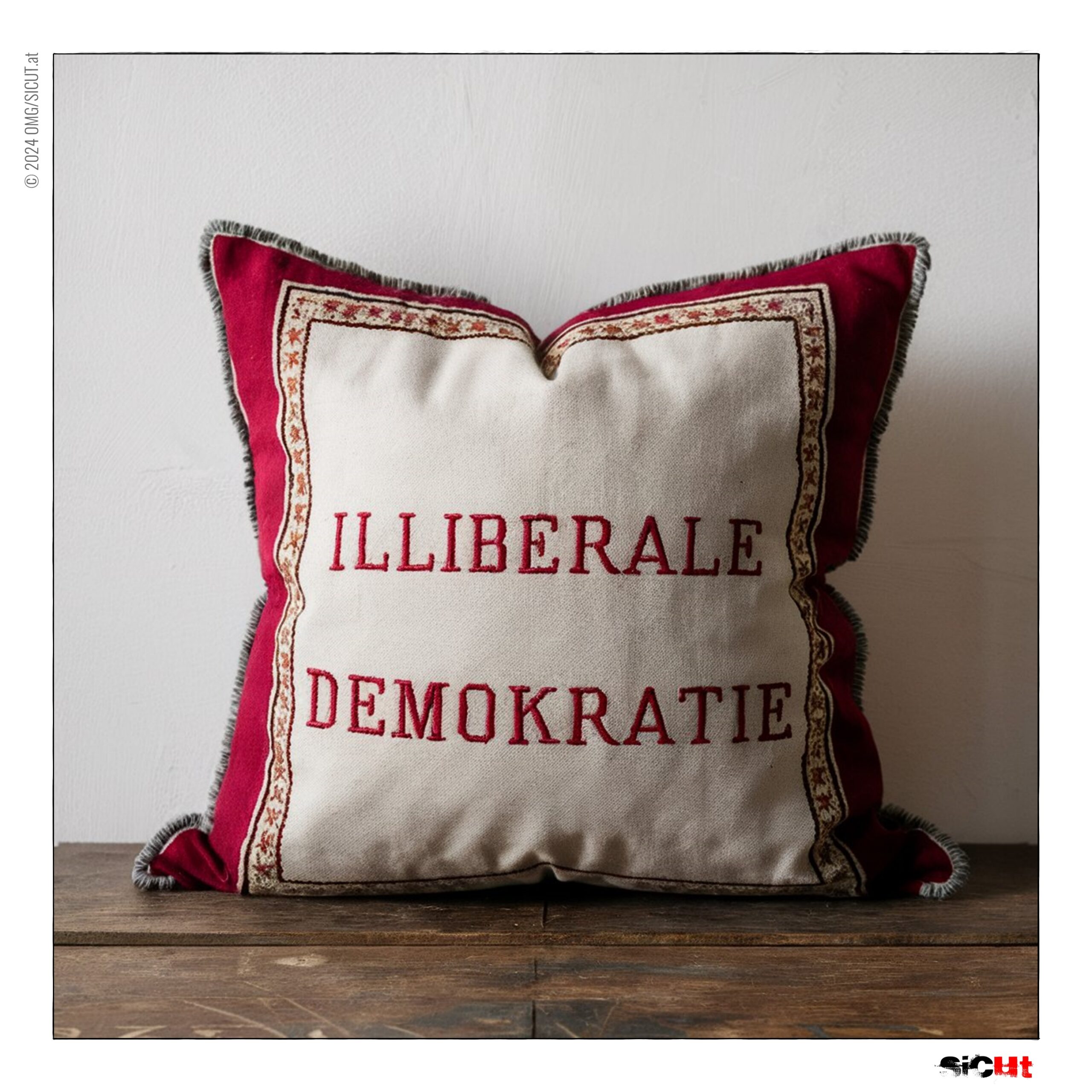Ein Prophet im Gelehrtenmantel
Ralph Dahrendorf, der freundliche Lord mit den markanten Brillengläsern und dem messerscharfen Verstand, war nicht nur ein Soziologe von Weltrang, sondern auch ein Prophet, der in die düsteren Abgründe des 21. Jahrhunderts blicken konnte, während der Rest von uns noch in den Träumen der Demokratie taumelte. Während Politiker, Intellektuelle und die allgemeine Öffentlichkeit in den 1990ern den Sieg der liberalen Demokratien nach dem Kalten Krieg feierten, saß Dahrendorf da, rührte seinen Tee und dachte wahrscheinlich: „Leute, ihr habt keine Ahnung, was auf uns zukommt.“ Und tatsächlich – er wusste es. Er wusste, dass das nächste Jahrhundert, das Jahrhundert, in das wir uns so sorglos hineinstolpern würden, eher autoritäre Tendenzen mit sich bringen würde, als dass es die Versprechen von Freiheit und Gerechtigkeit erfüllen würde.
Dahrendorf wusste um die Zerbrechlichkeit der Demokratie. Vielleicht hatte er schon damals gespürt, dass diese prächtige Fassade liberaler Demokratien – diese Bastionen der Freiheit, des Rechtsstaats und der Menschenrechte – im Grunde nur aus bröckelndem Mörtel bestand. Es war, als hätte er vorweggenommen, dass uns im 21. Jahrhundert weniger John Locke und Montesquieu begleiten würden, sondern eher Orban, Putin und Xi Jinping.
Die Illusion der Freiheit – und die Realität des Autoritarismus
Dahrendorf warnte uns frühzeitig: Die liberale Demokratie sei kein Naturzustand, den man einfach an einem sonnigen Morgen anzieht und dann für immer besitzt wie einen Mantel. Nein, sie sei ein fortlaufendes Projekt, das ständige Aufmerksamkeit, Pflege und – hier wird’s unangenehm – Widerstand gegen autoritäre Versuchungen erfordert. Und siehe da, kaum hat das neue Jahrhundert begonnen, da kriechen sie auch schon aus ihren Löchern, die autoritären Versuchungen, und sie haben erschreckend viel Erfolg.
Schauen wir uns um. Werfen wir einen Blick auf die Welt, wie sie heute ist: Viktor Orban spricht stolz von „illiberaler Demokratie“, als sei das kein Widerspruch in sich, sondern eine Art innovatives Regierungsmodell für die moderne Zeit. In Russland führt Wladimir Putin eine Demokratie aus dem Lehrbuch – nur, dass dieses Lehrbuch von Machiavelli und nicht von Tocqueville geschrieben wurde. Und in China? Da darf Xi Jinping sich seit neuestem lebenslang an die Spitze des Staates setzen, und das alles im Namen der Stabilität und des Wohlstands. Was Dahrendorf befürchtete, wird uns nun fast täglich auf den Bildschirmen in Form von Nachrichtenhäppchen serviert: Die autoritären Regime nehmen nicht nur zu, sie scheinen auch noch erfolgreicher und stabiler als unsere mühsam gepflegten Demokratien.
Und währenddessen? Währenddessen klammern sich die westlichen Demokratien an ihre gewohnten Routinen. Hier ein bisschen Lobbyarbeit, da ein bisschen Populismus, und zwischendurch streitet man sich darüber, ob „Fake News“ nun eine Gefahr für die Demokratie sind oder einfach nur lästig. Man könnte fast meinen, dass die eigentlichen Bedrohungen für die liberale Demokratie sich so geschickt verkleiden, dass wir sie gar nicht erkennen, bis sie uns mit ihrem autoritären Charme um den Finger gewickelt haben. Dahrendorf hätte darüber vermutlich nur müde gelächelt und etwas in der Art gesagt wie: „Tja, ich habe es euch gesagt.“
Autoritarismus im schicken Gewand der Effizienz
Eines der bedrückendsten Phänomene, das Dahrendorf vorausgesehen hat, ist die Verlockung des Autoritarismus – nicht etwa durch rohe Gewalt oder offenkundige Repression, sondern durch das Versprechen von Effizienz und Ordnung. Warum sich mit der mühsamen, langwierigen Demokratie herumschlagen, wenn ein einziger „starker Mann“ alles so viel einfacher machen kann? Man denke an die großartige Debatte der Moderne: Sollten wir nicht vielleicht einfach „weniger reden und mehr tun“? Der Ruf nach Effizienz, nach Schnelligkeit, nach direkter Problemlösung – all das führt uns in eine Richtung, die Dahrendorf sehr genau kannte: nämlich in die Arme des Autoritarismus.
Wer hat schon Zeit für langwierige Debatten in Parlamenten, wo sich die Volksvertreter gegenseitig mit Floskeln bewerfen, während die Menschen da draußen auf „echte Lösungen“ warten? Warum sich die Mühe machen, Wahlen zu organisieren, die sowieso immer mehr Menschen für eine Farce halten? Und wer braucht all die Gerichte, Kontrollinstanzen und Verfahren, wenn ein entschlossener Führer doch so viel schneller entscheiden kann, was das Beste für uns ist? Sicherlich dachte Dahrendorf, als er über diese Tendenzen sprach, dass die demokratische Gesellschaft irgendwann erkennen würde, dass diese „effiziente“ Lösung in Wahrheit der direkte Weg in den Abgrund ist.
Denn letztlich ist es diese autoritäre Versuchung, die Dahrendorf so treffend beschrieben hat: Das 21. Jahrhundert ist nicht geprägt von einem offenen, brutalen Kampf zwischen Demokratie und Autoritarismus, sondern von einer schleichenden, fast unsichtbaren Erosion der demokratischen Werte durch das Verlangen nach Stabilität, Sicherheit und Effizienz. Wenn die Freiheit unbequem wird, wählt man gerne mal die Bequemlichkeit. Das hat Dahrendorf gesehen – und genau das erleben wir heute.
Der lange Weg in die Unfreiheit
Was hätte Ralph Dahrendorf zu unserer Zeit gesagt, wenn er gesehen hätte, wie nicht nur autoritäre Regime an Einfluss gewinnen, sondern auch die Demokratien selbst immer mehr Anzeichen von autoritären Praktiken zeigen? Freiheit wird nicht mehr als Grundrecht betrachtet, sondern als etwas, das man „verdienen“ muss. Die sozialen Spannungen nehmen zu, und mit ihnen der Ruf nach mehr Kontrolle, mehr Überwachung, mehr Einschränkungen. Die wirtschaftliche Ungleichheit wächst, und der Unmut der Bevölkerung wird von Populisten instrumentalisiert, die einfache Antworten auf komplexe Probleme versprechen.
Dahrendorf hätte sicherlich nicht geschwiegen. Er hätte uns daran erinnert, dass der Weg in die Unfreiheit schleichend ist – dass er nicht in einem plötzlichen Umsturz beginnt, sondern in kleinen, oft unbemerkten Schritten, die immer weiter in Richtung Autoritarismus führen. Und er hätte uns daran erinnert, dass die Verteidigung der Demokratie nicht einfach darin besteht, „Wahlen abzuhalten“ oder sich auf Verfassungen zu berufen. Demokratie ist nicht nur ein System, sondern eine Haltung, eine Lebenseinstellung. Es geht darum, zu akzeptieren, dass Freiheit manchmal chaotisch ist, dass Rechte verteidigt werden müssen, auch wenn sie unbequem sind, und dass die Macht der Bevölkerung eben in dieser Freiheit liegt – nicht in der Effizienz von autokratischen Regimen.
Doch was tun wir heute? Anstatt unsere Demokratien zu stärken, anstatt die Werte der Freiheit und der Gleichheit aktiv zu verteidigen, warten wir oft einfach ab. Vielleicht, so hoffen wir, geht diese autoritäre Welle von selbst vorüber. Doch wie Dahrendorf uns gewarnt hat, kommt die Freiheit nicht von selbst – und sie bleibt auch nicht von selbst. Sie muss immer wieder erkämpft, verteidigt und gepflegt werden.
Die Warnung, die keiner hören wollte
Lord Ralph Dahrendorf hat schon vor Jahrzehnten erkannt, dass das 21. Jahrhundert ein autoritäres werden könnte. Er wusste, dass die Freiheit nichts Selbstverständliches ist, sondern ständig bedroht wird – nicht nur von den offensichtlich autoritären Regimen, sondern auch von den subtileren, inneren Feinden der Demokratie. In einer Welt, die nach einfachen Lösungen und schneller Effizienz schreit, droht die Demokratie als zu kompliziert, zu langsam, zu „ineffizient“ abgetan zu werden.
Doch Dahrendorf wusste, dass genau diese Komplexität, dieses Zögern, diese Debatte der Kern der Freiheit ist. Autoritarismus mag schneller sein, mag „effizienter“ erscheinen – aber er führt uns nicht in die Zukunft, sondern zurück in die Dunkelheit. Vielleicht sollten wir jetzt, wo die Zeichen des 21. Jahrhunderts immer deutlicher werden, endlich anfangen, auf ihn zu hören. Denn wenn wir nicht wachsam bleiben, könnte sich die düstere Prophezeiung Dahrendorfs schneller erfüllen, als uns lieb ist.
Quellen und weiterführende Links:
- Ralph Dahrendorf: Versuchungen der Unfreiheit: Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung
- Die Krise der liberalen Demokratie: Eine Analyse von Ralph Dahrendorfs Vermächtnis
- Autoritarismus und die neuen Bedrohungen der Demokratie im 21. Jahrhundert
- UN-Berichte zur weltweiten Ausbreitung autoritärer Regime