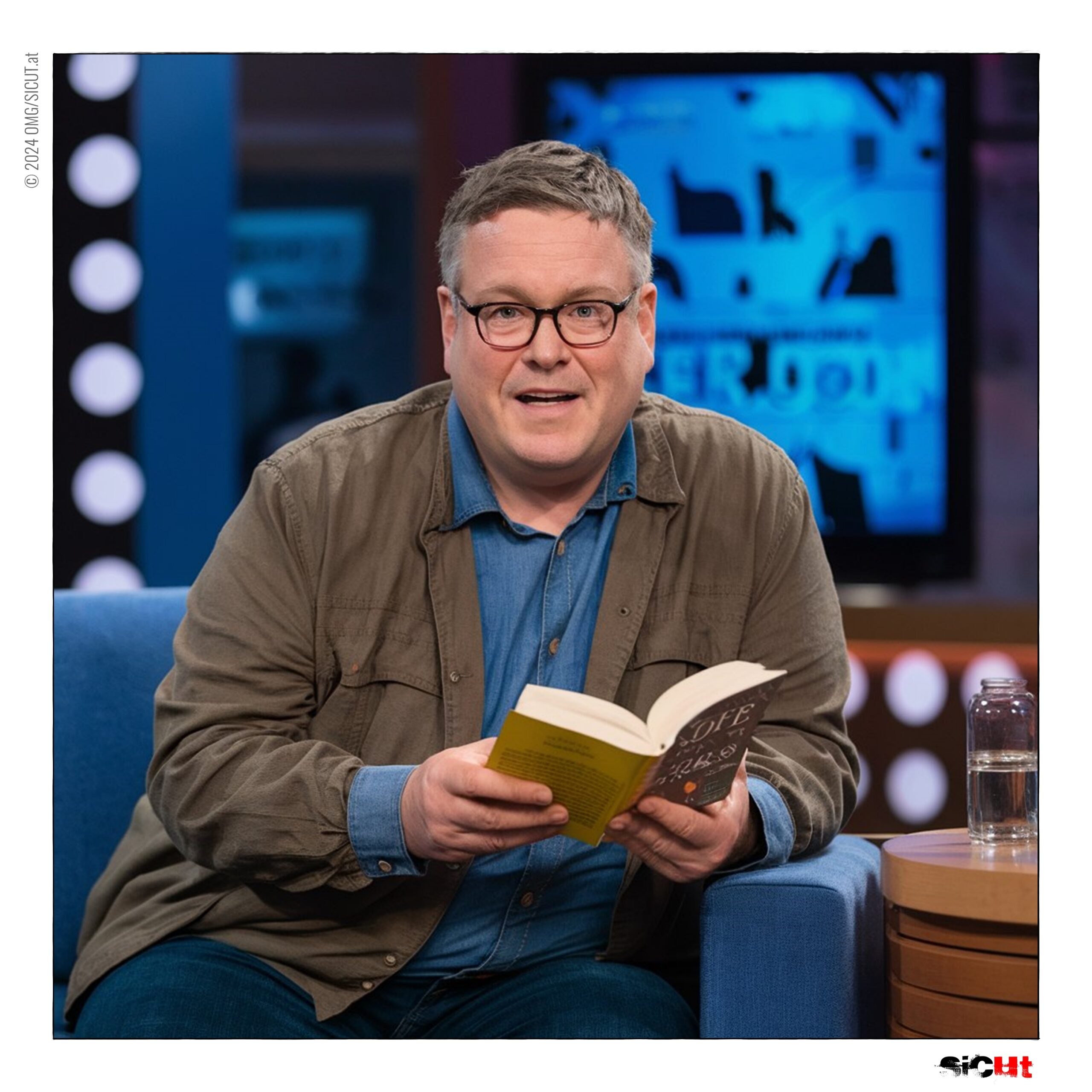Wie der 1. Zusatzartikel die Agenda behindert
Es ist ein herrlicher Herbstnachmittag in New York, und in den klimatisierten Konferenzräumen des Weltwirtschaftsforums, direkt an der gläsernen Front zum Hudson River, strömt der kühle Duft der Nachhaltigkeit durch die Luft. Hier versammeln sich die mächtigen Eliten dieser Welt, um über die Zukunft unseres Planeten zu sprechen. Über das Wohl der Menschheit, die Rettung der Meere, den Schutz des Klimas und – ganz nebenbei – über die kleine Unannehmlichkeit namens Demokratie.
John Kerry, der einstige Außenminister und erfolglose Präsidentschaftskandidat, sitzt am Tisch, ein Mann mit den Zügen eines verärgerten High-School-Lehrers, der sich gerade eingestehen muss, dass er die Klasse nicht mehr unter Kontrolle hat. In einer Welt, in der Konsens König ist, ist die Meinungsfreiheit nur lästig, scheint er zu denken. Während seiner Ansprache klagt er über eine unsichtbare Macht, die ihn und seine edlen Ziele behindert: den 1. Zusatzartikel der US-Verfassung.
Mit einem theatralischen Seufzen wirft er das Problem in den Raum: „Es ist heute schwieriger, einen Konsens zu finden,“ erklärt er, als wäre Konsens eine universale Menschenpflicht. Konsens, so scheint es, ist der Zustand, in dem alle gehorsam nicken, ohne Fragen zu stellen – zumindest solange, bis die Tür geschlossen wird. Aber der 1. Verfassungszusatz, dieser lästige Relikt einer unruhigen Vergangenheit, in der Freiheit noch ein Ideal und keine Bedrohung war, steht im Weg. Meinungsfreiheit, also, behindert die Agenda. Welch grausame Ironie der Geschichte.
Die Freiheit der Wahrheit im Weg
Man stelle sich vor: Ein mächtiger Politiker, der Millionen Menschen repräsentiert, beklagt sich darüber, dass Menschen zu viel sagen dürfen. Als wäre die Freiheit, die eigene Meinung zu äußern, eine gefährliche Unannehmlichkeit. Tatsächlich glaubt Kerry wohl, dass in einer perfekten Welt nur die Meinungen Gehör finden sollten, die mit der Agenda übereinstimmen. Wäre es nicht viel einfacher, wenn sich alle einfach einig wären? Alle sollten doch dasselbe denken, dasselbe wollen, dasselbe anstreben – besonders, wenn die klugen Köpfe es ihnen vorgeben.
Doch hier offenbart sich ein tieferes Problem: Sie denken wirklich, dass sie uns kontrollieren müssen. Nicht, weil sie böse sind, natürlich nicht. Nein, sie tun es aus purer Fürsorge! Manchmal muss man das dumme Volk eben vor sich selbst schützen. Kerry und seine Kollegen sehen sich als Retter in einer Welt, die sie nicht versteht. Das Volk? Unwissend, zu emotional, zu leicht beeinflussbar. Die Meinungsfreiheit? Eine Gefahr für das kollektive Wohl. Wie schön wäre es doch, wenn es diese lästigen Internetkommentatoren, Blogger und investigative Journalisten nicht gäbe, die die Wahrheit in Frage stellen.
Patrick Savalle, ein Journalist mit einem Blick für das Abgründige, fasst es in den Kommentaren treffend zusammen: „Die Meinungsfreiheit steht der Agenda der Regierung im Weg.“ Ein Satz, der so absurd ist, dass er fast schon wieder Sinn ergibt. Denn was ist das Wesentliche an Demokratie, wenn nicht die Meinungsvielfalt? Doch offenbar geht es längst nicht mehr darum, eine lebendige Diskussion zu fördern. Es geht darum, eine Diskussion zu kontrollieren.
Desinformation als neue Todsünde
Ach ja, die „Desinformation“. Dieses neue Modewort, das wie eine scharfe Guillotine über jedem freien Gedanken schwebt. Wir alle wissen, was damit gemeint ist: Alles, was nicht den Narrativen der Mächtigen entspricht, ist Desinformation. Die offizielle Wahrheit ist sakrosankt, und wer sie hinterfragt, ist ein Verschwörer. Ein Ketzer der Postmoderne. Früher brannten Ketzer auf Scheiterhaufen, heute werden sie aus den sozialen Medien verbannt. Der Pranger mag sich modernisiert haben, aber das Prinzip ist dasselbe geblieben.
Man muss schon ein wenig zynisch lächeln, wenn man sich die Ironie dieser Situation vor Augen führt: Die Menschen, die am lautesten über Desinformation schreien, sind oft diejenigen, die im Stillen entscheiden, was die Wahrheit sein soll. Diejenigen, die den Diskurs kontrollieren, sprechen von Freiheit, meinen aber Gehorsam. Sie sagen, sie wollen die Demokratie retten, aber sie retten nur ihre eigene Macht.
Der große Trick der Gegenwart ist es, die Bevölkerung glauben zu machen, dass ihre Freiheit sie selbst bedroht. Denn in einer Welt, in der Worte gefährlicher sind als Taten, in der Gedanken ein Verbrechen darstellen, ist die Freiheit zu denken, zu sprechen und zu hinterfragen der größte Feind derer, die herrschen wollen. Die Meinungsfreiheit wird nicht als Recht gesehen, sondern als Waffe – und wie jede Waffe muss sie kontrolliert, geregelt und in die richtigen Hände gelegt werden.
Ein Déjà-vu aus dem Osten?
In dieser schillernden neuen Welt, die das Weltwirtschaftsforum uns verspricht, spürt man einen merkwürdigen, kalten Wind aus der Vergangenheit. Er weht aus dem alten Ostblock, aus den grauen Straßenschluchten von Moskau, Bukarest und Ost-Berlin. Damals nannte man es Volksdemokratie – ein Begriff, der so ironisch wie traurig war. Eine Demokratie für das Volk, aber ohne das Volk. Eine Partei hatte das Monopol auf die Wahrheit, und wer diese Wahrheit in Frage stellte, wurde ein Feind des Staates.
Heute sind die Parolen geschmeidiger, die Rhetorik sanfter, die Macht subtiler. Doch das Prinzip bleibt dasselbe: Eine kleine Elite beansprucht das Recht, die Wahrheit zu definieren. Diese Wahrheit darf nicht in Frage gestellt werden. Und wenn doch, wird es als Desinformation gebrandmarkt. Wer es wagt, die Narrativen zu durchbrechen, wird aus dem Diskurs verbannt, als wäre er ein Virus, der die Gesundheit des Kollektivs bedroht.
Es ist eine Rückkehr zu den dunklen Tagen der Informationskontrolle – nur mit mehr Glasfassaden und Öko-Logos.
Der Preis der Freiheit
Am Ende bleibt die Frage: Was bedeutet Freiheit wirklich? Ist sie nur ein altes Relikt, das den Fortschritt behindert? Oder ist sie das Fundament jeder echten Demokratie? Kerry und seine Kollegen scheinen die Antwort bereits zu kennen: Freiheit ist nur dann gut, wenn sie uns nützt. Ansonsten ist sie eine Gefahr.
Doch wer kontrolliert die Kontrolleure? Wer entscheidet, was Desinformation ist? Und wer schützt uns vor denen, die die Wahrheit für sich beanspruchen?
Die Freiheit, die John Kerry als störend empfindet, ist vielleicht das letzte Bollwerk gegen eine Welt, in der Konsens wichtiger ist als Wahrheit und in der die Mächtigen bestimmen, was gesagt werden darf. Wenn die Meinungsfreiheit wirklich im Weg steht – dann sollten wir sehr genau darauf achten, wessen Weg sie behindert.
Weiterführende Quellen und Links:
- UN General Assembly: Official Report
- World Economic Forum: Sustainable Development Impact Meetings
- Patrick Savalle – Investigative Journalism and Opinion Blog