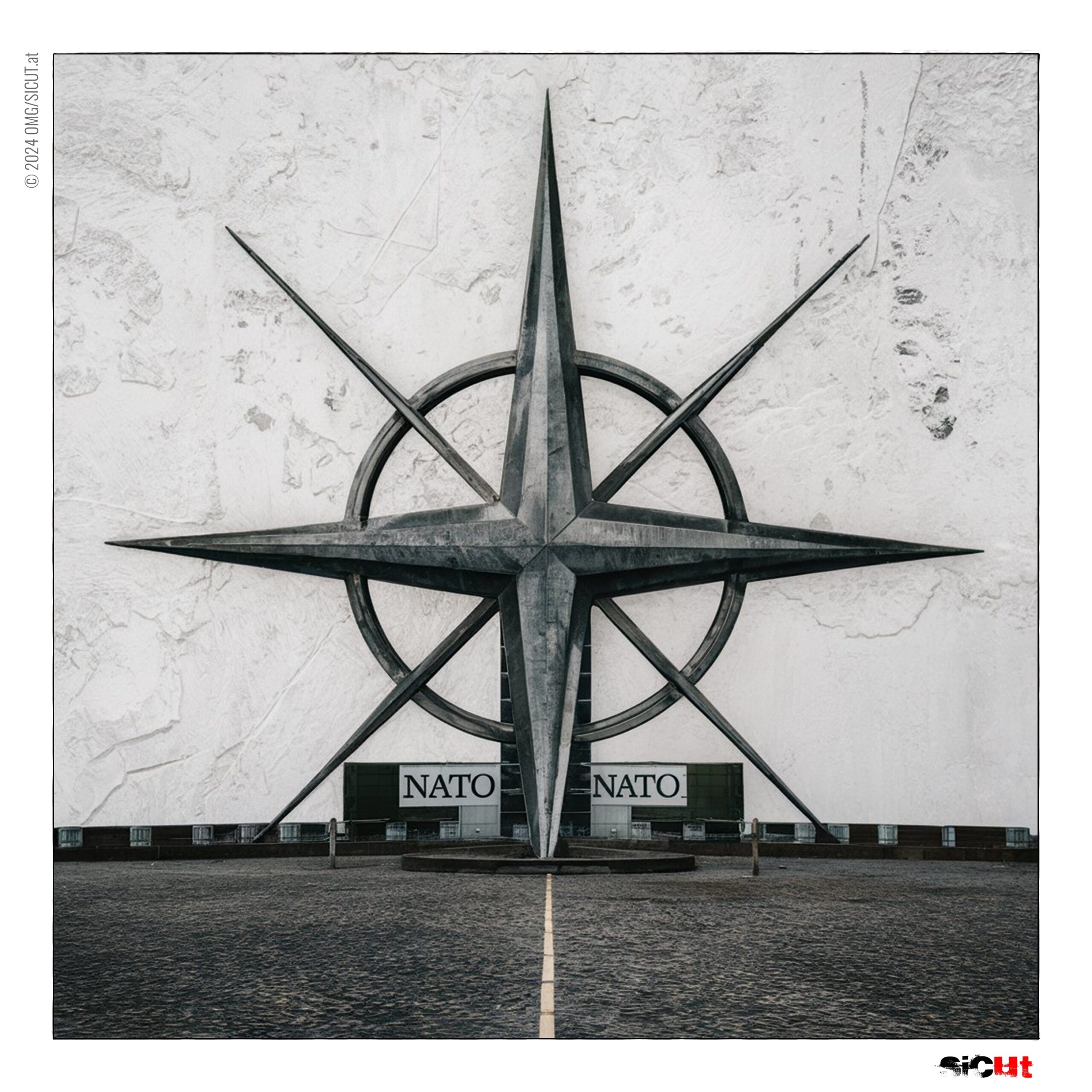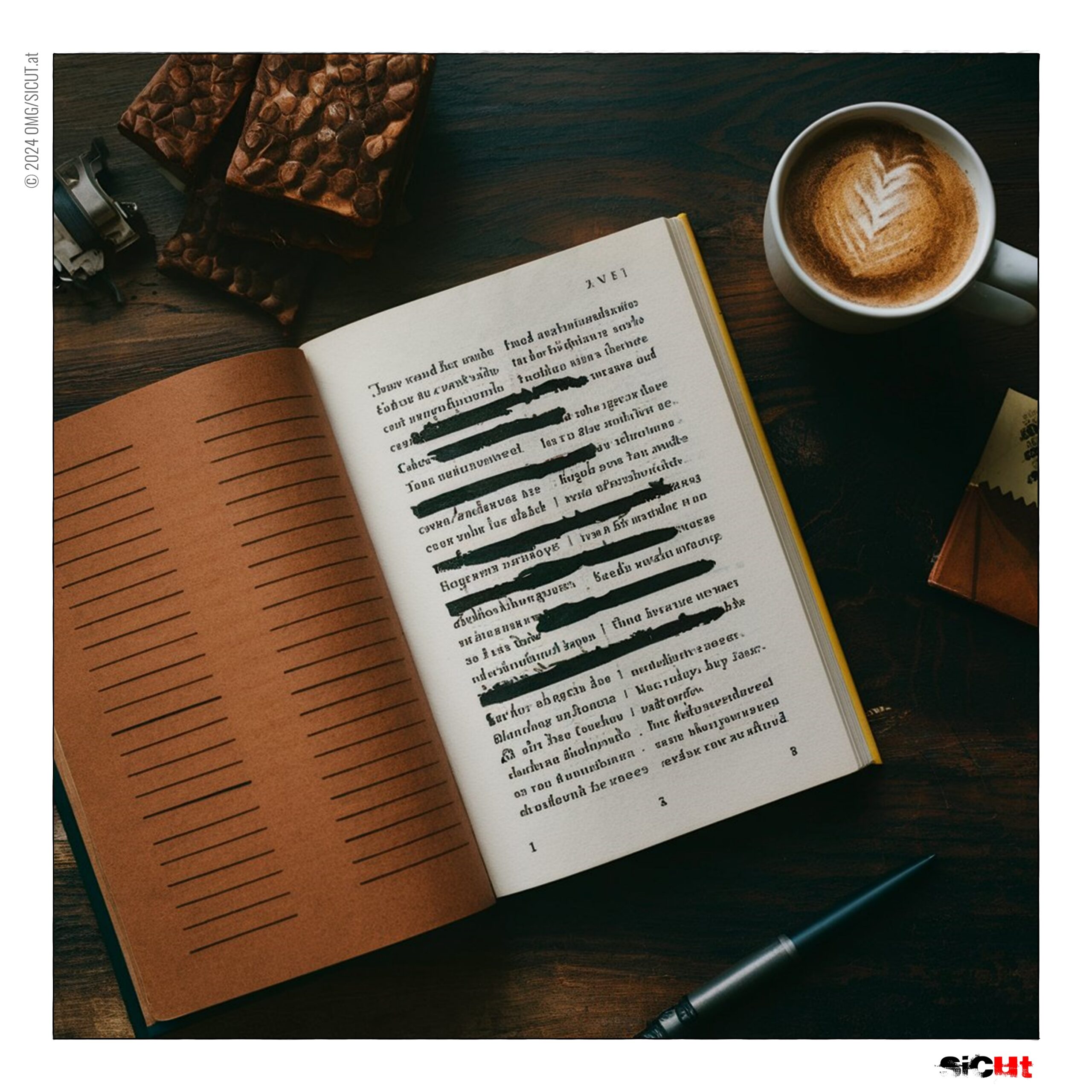Der verführerische Reiz des scheinbar Unsinnigen
Es gibt wenige Dinge, die auf den ersten Blick so wunderbar sinnfrei erscheinen, wie zwei Gruppen älterer Menschen, die sich auf ihre alten Tage in das Dickicht der politischen Auseinandersetzung begeben. „Omas gegen Rechts“ – das klingt so nett, so unverdächtig, so moralisch überlegen. Wer könnte schon etwas gegen Omas haben? Ihre Mission? Die Welt retten vor dem Rechtsruck, vor Faschismus und Rassismus. Omas sind im Besitz der Wahrheit, Omas wissen es besser, und – das ist das Wichtigste – sie sind die moralische Instanz. Und da wären noch die Opas – ja, die Opas. Aber sind sie gegen oder für irgendwas? Sind sie etwa auch gegen Rechts? Oder haben sie es sich vielleicht gelegentlich, ganz unauffällig, links eingerichtet?
Inmitten dieses gesellschaftlichen Wirrwarrs stellt sich die Frage: Gibt es hier eine perfekte Symbiose? Omas, die das rechte Monster zähmen, und Opas, die – nun ja – ab und an ein bisschen links schlummern, vielleicht sogar abdriften? Oder ist das alles nur eine verzweifelte Suche nach politischer Relevanz in der dritten Lebensphase?
Moralische Königinnen des Protests oder verirrte Kämpferinnen?
Zuerst zu den Omas gegen Rechts. Einem Konzept, das auf den ersten Blick so herzerwärmend wie naiv klingt. Auf den zweiten Blick jedoch könnte man den Verdacht hegen, dass hinter der wohlklingenden Fassade des Widerstands gegen das Böse ein tief verwurzelter, unreflektierter Aktivismus steckt. Es ist, als hätten die Omas beschlossen, die weichen Kardigans überzustreifen und auf die Barrikaden zu gehen – mit thermosgefüllten Kannen Tee und plattgelaufenen Pantoffeln. Es geht schließlich um die Sache!
Aber ist es wirklich so einfach? Haben diese Omas, die ihre Moral wie ein Schild vor sich hertragen, tatsächlich verstanden, worauf sie sich eingelassen haben? Oder ist das ganze Projekt einfach nur eine elegante Form des Altersaktivismus, der es den Teilnehmerinnen ermöglicht, sich wieder jung und rebellisch zu fühlen, ohne sich dabei allzu sehr mit den unangenehmen Realitäten des modernen politischen Diskurses auseinanderzusetzen? Man könnte fast meinen, sie hätten ihre Enkel bei der Fridays-for-Future-Demo beobachtet und sich gedacht: „Das können wir auch!“
In Wahrheit ist es ein verzweifelter Versuch, Relevanz zu finden in einer Zeit, in der die ältere Generation oft als altbacken und rückständig abgestempelt wird. Die „Omas gegen Rechts“ kämpfen also nicht nur gegen den Faschismus, sondern auch gegen den Zahn der Zeit. Es ist ein verzweifeltes Ringen um Aufmerksamkeit in einer Welt, die sie längst in die Rente abgeschoben hat – und was könnte dafür besser geeignet sein als ein plakatives, emotional aufgeladenes Thema wie der Rechtsruck?
Auf den Barrikaden? Oder doch nur auf dem Sofa?
Und dann sind da die Opas. Ja, die Opas – die männliche Antwort auf die moralische Überlegenheit der „Omas gegen Rechts“. Aber anstatt klar Stellung zu beziehen und sich – wie ihre besseren Hälften – mit wehenden Fahnen gegen das Böse zu stellen, haben sie es sich irgendwo zwischen links und „was soll’s“ bequem gemacht. „Opas gegen links“ – das klingt fast wie eine Zufallsbeschreibung aus einem IKEA-Katalog. Der Opa, der gelegentlich auf der linken Seite der Couch döst, während er den Fernseher anstarrt und nostalgisch über die Zeiten sinniert, als Protest noch bedeutete, tatsächlich auf die Straße zu gehen.
Was treibt diese Opas an? Ist es wirklich politische Überzeugung, oder eher der Drang, sich nicht komplett dem politischen Diskurs zu entziehen? Denn – Hand aufs Herz – so sehr sie vielleicht auch mit der rechten Faust gegen den Faschismus wettern würden, so sehr haben sie doch die linke Faust längst auf dem Bauchtisch platziert, um darauf ein bequemes Nickerchen zu machen. Der links geneigte Opa scheint sich eher in einem politischen Halbschlaf zu befinden. Aber vielleicht ist das auch sein Vorteil: Während die Omas unermüdlich demonstrieren, können die Opas gelegentlich ihren Nachmittagsschlaf genießen, um dann erfrischt – vielleicht – auch mal das eine oder andere kluge Wort beizutragen.
Aber seien wir ehrlich: Das klingt doch fast nach einer perfekten Symbiose, oder? Omas, die kämpfen, und Opas, die gelegentlich „Links“ unterstützen – wenn auch nur im Geiste, während sie auf dem Sofa schlummern.
Zwischen Hochmut und Realität
Es gibt hier jedoch einen tieferen Widerspruch, der nicht übersehen werden darf. „Omas gegen Rechts“ und „Opas gelegentlich links“ scheinen auf den ersten Blick harmonisch miteinander verbunden zu sein, ein ideales politisches Duo. Aber in Wahrheit klafft eine enorme Lücke zwischen der moralischen Selbstgewissheit dieser Bewegungen und der tatsächlichen politischen Realität.
Es ist leicht, gegen das „Böse“ zu sein, wenn man es auf so simplistische Art und Weise kategorisiert. Rechts ist böse, links ist gut. Omas auf der einen Seite, Opas auf der anderen. Doch was passiert, wenn die Realität nicht so einfach ist? Was, wenn diese Gruppen mehr zur Selbstbestätigung als zur tatsächlichen Veränderung beitragen?
Die Omas marschieren in ihrem selbstgefälligen Protestzug gegen alles, was nicht in ihr idealisiertes Weltbild passt, während die Opas sich am Rande des politischen Diskurses bewegen, gelegentlich zustimmend nicken, aber meist im Hintergrund bleiben. Und so bleibt der eigentliche politische Kampf auf der Strecke – während die Hauptakteure sich in ihrer moralischen Überlegenheit sonnen. Was bleibt, ist eine seltsame Mischung aus nostalgischem Aktionismus und halbherzigem Engagement.
Die perfekte Symbiose oder doch nur ein laues Lüftchen?
Am Ende bleibt die Frage: Ist dies die perfekte Symbiose? Omas gegen Rechts und Opas gelegen Links – zwei Seiten einer Medaille, die die politische Landschaft mit ihrer Weisheit und Erfahrung retten? Oder handelt es sich um ein tragikomisches Schauspiel, in dem ältere Generationen verzweifelt versuchen, sich an einem politischen Diskurs zu beteiligen, der längst an ihnen vorbeigezogen ist?
Vielleicht ist es beides. Vielleicht sind die Omas tatsächlich in ihrer moralischen Empörung so fest verankert, dass sie glauben, das Richtige zu tun – auch wenn die Welt komplizierter ist, als sie es sich vorstellen. Und vielleicht sind die Opas tatsächlich gelegentlich links – nicht aus Überzeugung, sondern aus Bequemlichkeit.
Die perfekte Symbiose? Wohl kaum. Doch wenigstens sorgt sie für Unterhaltung. Und das ist ja auch etwas wert.
Quellen und weiterführende Links:
Wie ältere Generationen in der heutigen politischen Landschaft ihren Platz finden
„Omas gegen Rechts“ – Eine Bewegung gegen den Rechtsruck
Politisches Engagement im Alter – Chancen und Herausforderungen
Warum linke und rechte Politiken komplexer sind, als wir denken