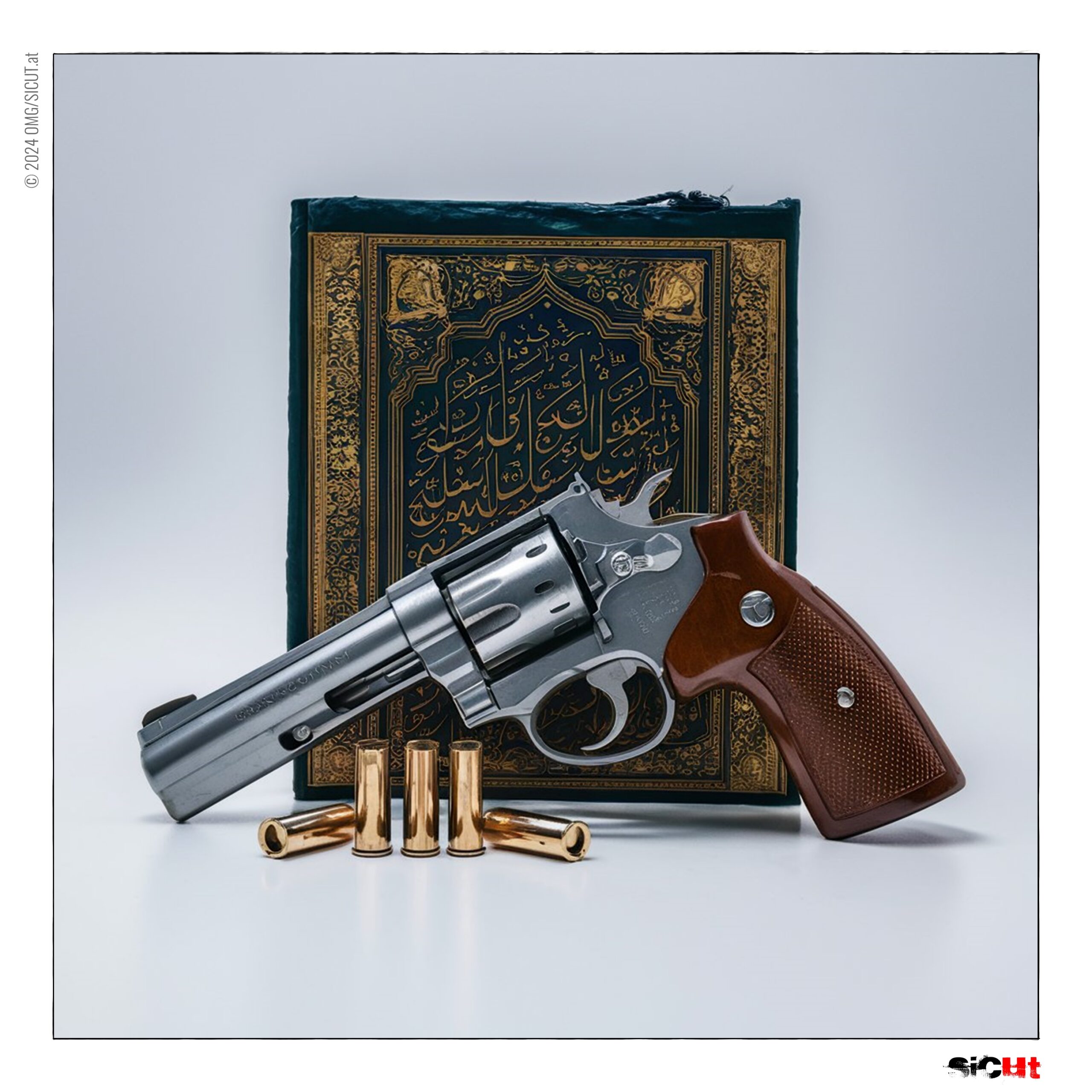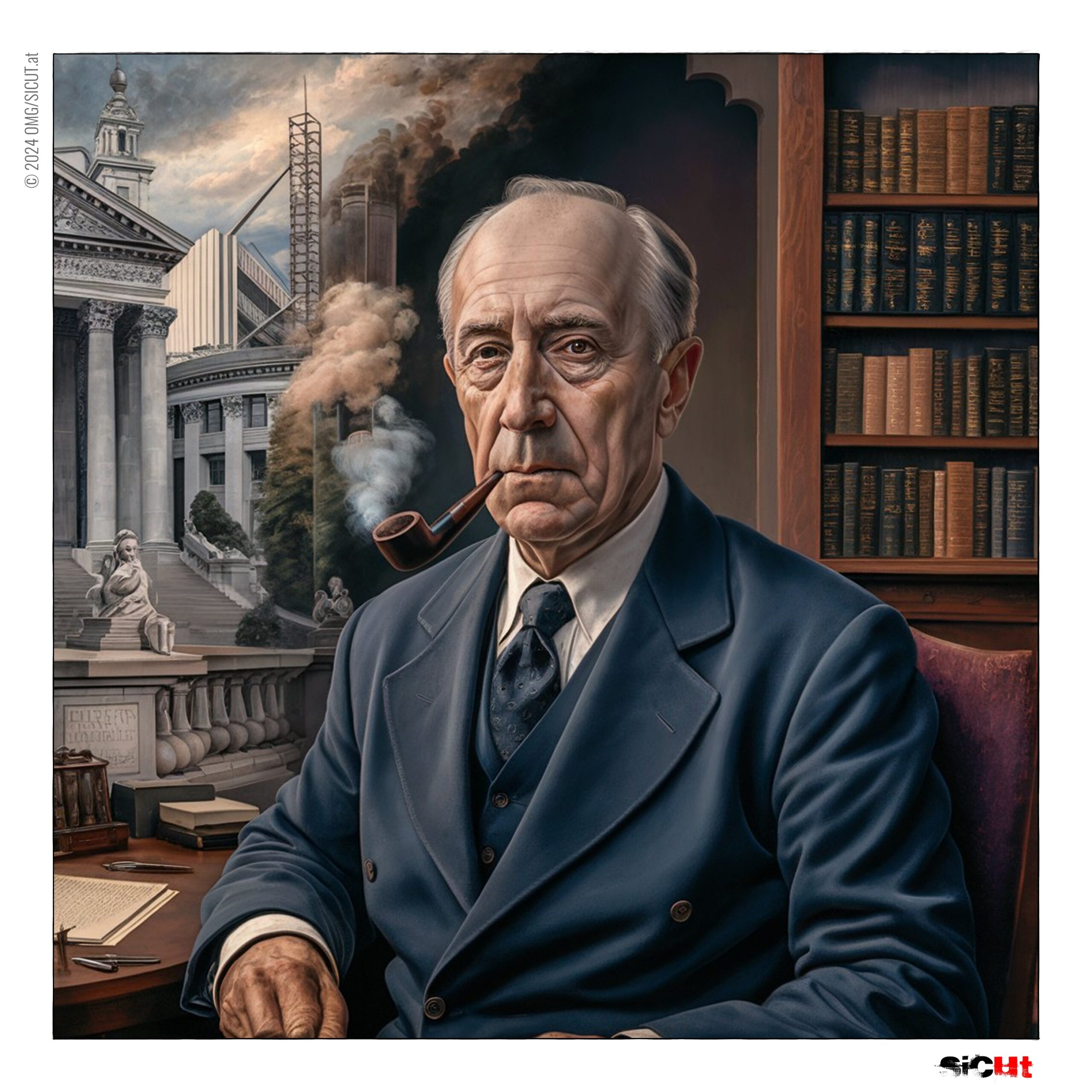Krieg ist das Geschäft der Anderen: Über Zynismus, Kapitalismus und Winterhilfen für die Ukraine
Es ist Dezember. Ein eisiger Wind pfeift durch die Trümmer der ukrainischen Städte. Doch was wärmt in diesen Tagen mehr als das Heulen der Schneestürme? Vielleicht die Aussicht auf satte Dividenden, die in kuschelig beheizten Büroetagen der Unternehmenszentralen auf die Bilanzen der Investoren warten. Krieg als Garant für Wachstum – ein Paradoxon, das längst ins System Kapitalismus eingelassen ist wie eine gut geschmierte Maschine. Während Deutschland die Winterhilfe für die Ukraine um zusätzliche 200 Millionen Euro aufstockt und Ministerin Annalena Baerbock sich abermals nach Kiew begibt, fragen sich einige vielleicht: Was wäre Weihnachten ohne das Manna der Solidarität?
Doch schauen wir genauer hin. Solidarität wird hier zur Ware, die von Nation zu Nation gehandelt wird, eine Art Geschenkkorb für die internationalen Mächte. Inmitten von zerstörten Städten, zerbrochenen Familien und immer neuen Frontlinien, breitet sich das Netzwerk des Kapitalismus wie ein unsichtbares Gewinde aus. 200 Millionen für Winterhilfen? Die noble Geste ist unverkennbar – und doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein der Kapitalinteressen. Denn während hier mit großer Geste von Solidarität gesprochen wird, mischen sich im Hintergrund bereits Investoren, Geschäftemacher und Bauunternehmer in die neuentstehenden Märkte.
Man könnte fast meinen, es handele sich um ein Geschäftsmodell mit eingebauter Humanität, eine Art lukrative Investitionsstrategie in Form von Unterstützung. Rosa Luxemburgs Worte hallen uns in diesen Tagen schmerzlich im Ohr: „Die Dividenden steigen, und die Proletarier fallen.“ Ein Sinnbild dafür, wie weit die moralische Latenz des Kapitalismus reichen kann, wenn sich hinter dem Deckmantel der „Winterhilfe“ bereits die Schatten der neuen Gewinnzonen abzeichnen.
Des Einen Elend, des Anderen Skivergnügen
Während die europäischen Staaten mit Millionenhilfe die Notleidenden in der Ukraine unterstützen, genehmigt die ukrainische Regierung ein gigantisches Bauprojekt, das an Zynismus kaum zu übertreffen ist: Ein Skiresort, geplante Baukosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, das bereits als das „St. Moritz der Ukraine“ betitelt wird. Österreichische Baukonzerne sind dabei federführend und verhandeln fleißig, während sich in unmittelbarer Nähe Frontlinien und Kriegsverwüstungen aneinanderreihen.
Man könnte fast glauben, man lausche einem makabren Scherz, einer satirischen Zuspitzung des Kapitalismus. Doch das Skigebiet ist real und formt sich auf dem Reißbrett der kapitalistischen Logik. Was zählt, ist der Fortschritt der Wirtschaft, selbst wenn die Skipisten über die Gräber jener verlaufen, die im Namen eines nicht enden wollenden Konflikts ihr Leben verloren haben. Hier, so scheint es, wird Krieg zur Landschaftsform, und der Tod wird ein Feature für die Erholungssuchenden. Es ist die Perversion eines Systems, das alles in Rendite umzuschlagen weiß, selbst die tiefsten Wunden eines Landes.
Diese „Wintersport-Oase“, finanziert von internationalen Investoren und gebaut von Unternehmen, die aus der Zerstörung Profit schlagen, verdeutlicht auf frappierende Weise, wie grenzenlos die Geschäftsidee des Kapitalismus ist. Es ist, als würde eine feine Schneeschicht aus Euros und Dollars die Trümmer der Städte zudecken – ein „Winterzauber“ der besonderen Art, in dem nicht Kälte und Eis, sondern die Gleichgültigkeit den Herzschlag bestimmt.
Wo die Moral aufhört und der Profit beginnt
Natürlich könnten einige einwenden, dass man doch irgendwo beginnen müsse mit dem Wiederaufbau, dass Infrastruktur die Basis für jede wirtschaftliche Erholung darstellt. Aber wie viel an Skrupel ist nötig, um nicht zu sehen, dass hinter dieser „Investition“ in die touristische Infrastruktur das gleiche System steckt, das den Krieg selbst am Laufen hält? Der Kapitalismus ist darauf angewiesen, immer wieder neue Märkte zu schaffen, ja, sich ständig neue Schlachtfelder für sein profitables Fortbestehen zu erschließen. Der Krieg wird dabei zum unfreiwilligen Architekten dieser Märkte, ein unheimlicher Geschäftspartner, dessen Brutalität zur Antriebskraft wirtschaftlichen Wachstums wird.
Hier wird nicht über Hilfsgelder gesprochen, um Leid zu lindern, sondern vielmehr über Investitionsvolumina, Profitmargen und Baubeginnzeiten. Die Hilfe wird zur Ware, eine neue Form des „Konsums“, an dem sich jeder beteiligen kann, der seinen Anteil an der „Ukraine-Solidarität“ haben möchte. Und so zieht der Kapitalismus seine Kreise, während Europa mit Symbolen der Unterstützung wirft und dabei nichts anderes tut, als sein eigenes System am Laufen zu halten.
Winterhilfe, Skiresorts und die Paradoxien der „Zivilisation“
In der entlarvenden Klarheit des Kapitalismus wird deutlich, dass Solidarität und Zynismus sich kaum voneinander trennen lassen. Was als „Winterhilfe“ deklariert wird, könnte ebenso gut als Investitionsschub in einen zukünftigen Absatzmarkt gelesen werden. Die 200 Millionen Euro für Heizungen, Decken und Notunterkünfte stellen in Wahrheit eine Art Anzahlung dar. Denn wer heute hilft, so scheint es, darf auch morgen mitreden, mitbestimmen und mitverdienen.
Der Bau eines Skiresorts in einem Kriegsgebiet ist nichts anderes als ein Symbol für die Unempfindlichkeit, mit der sich der Kapitalismus über die ethischen Grenzen hinwegsetzt. Für ihn ist Krieg kein Desaster, sondern eine Betriebsbedingung. Und wie könnte es anders sein, wenn selbst in der Notwendigkeit der Winterhilfe ein Geschäftsfeld gesehen wird? Hier tritt uns der Kapitalismus nicht nur als ökonomische Macht entgegen, sondern auch als ideologische Kraft, die selbst die moralische Verkommenheit als Marktsegment begreift.
Ein System, das nur verlieren kann
Die „Winterhilfe“ ist in diesem Sinne ein tragikomisches Symbol für die Mechanismen einer Weltordnung, in der der Wert des Menschen nichts anderes als eine Währung ist. Die Ukraine braucht mehr als das, sie braucht ein Ende der skrupellosen Geschäfte, die sich wie Parasiten in das Leid und die Zerstörung einnisten. Denn solange wir zusehen, wie Skilifte durch zerbombte Landschaften gleiten, so lange wird es auch diesen Krieg geben, von dem so viele profitieren.
So bleibt am Ende nur die bittere Erkenntnis, dass die 200 Millionen Winterhilfe zwar Wärme spenden, aber nichts daran ändern, dass der Kapitalismus selbst die größte Kälte ist.
Quellen und weiterführende Links
- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Deutsche Hilfsleistungen für die Ukraine
- Rosa Luxemburg: Schriften über Krieg und Kapitalismus, Archiv für Sozialgeschichte
- Wirtschaftsberichte über den geplanten Skitourismus in der Ukraine: Handelsblatt, Die Presse
- Kritik an der Rolle kapitalistischer Interessen in Krisengebieten: Kritik der politischen Ökonomie