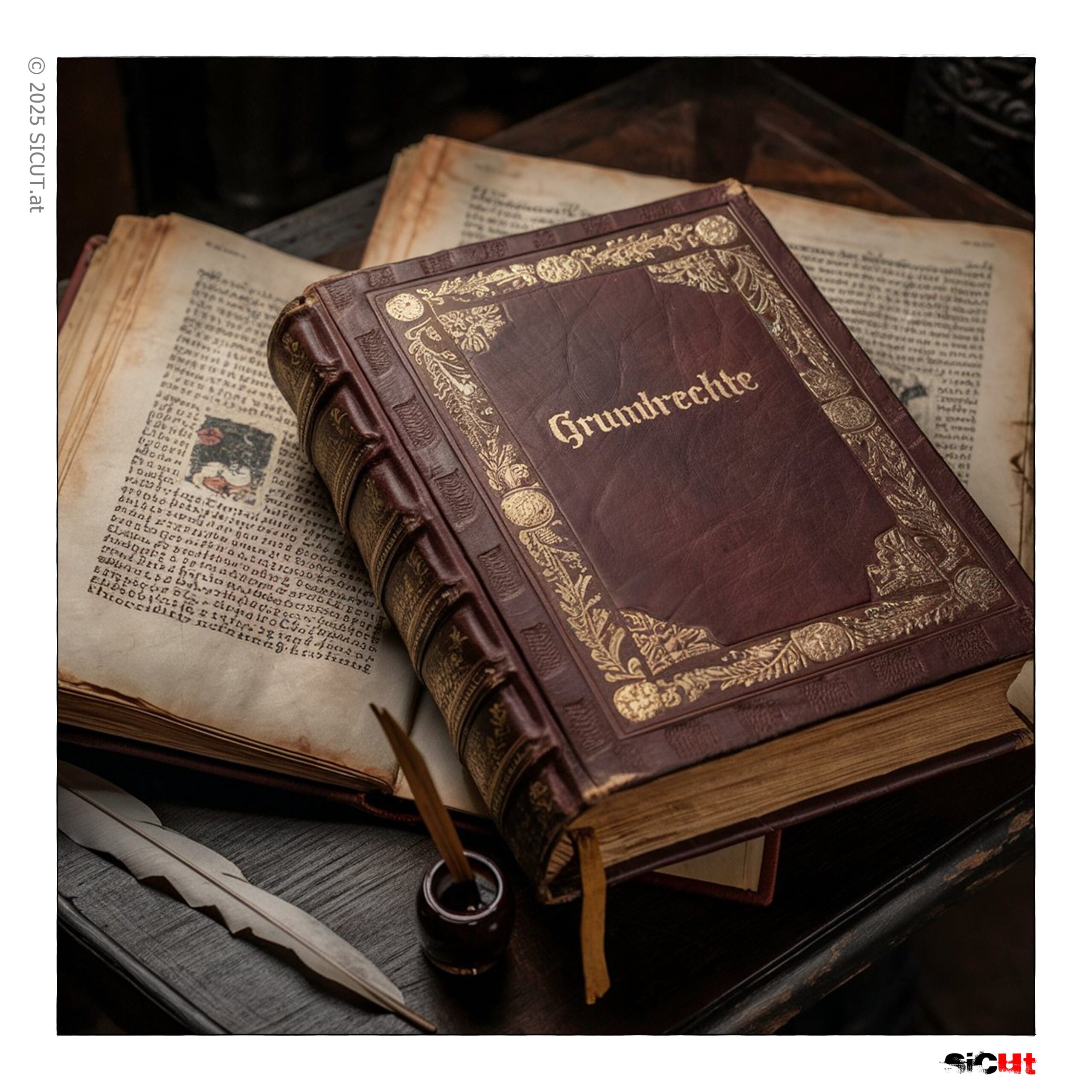Von Globalisierungseuphorie zu Grenzziehungshysterie
Es ist eine dieser faden Ironien der Geschichte, dass ausgerechnet jene politischen Kräfte, die seit Jahrzehnten mit fanatischem Eifer für eine entfesselte Globalisierung kämpfen, nun mit fast religiösem Furor die nationale Abschottung predigen. Sie haben die Märkte entgrenzt, die Konzerne entnationalisiert, die Produktion in Billiglohnländer verlagert, die Sozialstaaten abgebaut, Löhne gedrückt und Arbeitskräfte flexibilisiert – aber wenn es um Menschen geht, die aus genau diesen Destabilisierungszonen zu uns kommen, dann wird plötzlich das Abendland verteidigt, dann ist die Nation wieder heilig, dann wird das Soziale plötzlich zum „wir können nicht alle aufnehmen“.
Friedrich Merz, dieser großbürgerliche Klassenkrieger in Nadelstreifen, steht exemplarisch für diesen Zynismus. Jahrzehntelang hat er als wirtschaftsliberaler Hardliner keine Gelegenheit ausgelassen, den „Markt“ über den „Staat“ zu erheben, Lohnzurückhaltung zu predigen und „Wettbewerbsfähigkeit“ als ultimatives Argument für sozialen Kahlschlag ins Feld zu führen. Doch kaum tritt das Thema Migration auf den Plan, mutiert er zum besorgten Patrioten, der das Soziale entdeckt – freilich nicht als Schutz für die Armen, sondern als Keule gegen die noch Ärmeren.
Kapital ohne Grenzen, Menschen mit Schlagbäumen
Der Widerspruch könnte kaum offensichtlicher sein: Dieselben Politiker, die noch gestern beklatschten, wie Amazon, Apple und BlackRock jeden staatlichen Eingriff verhöhnten, fordern heute maximale Kontrolle über Migration. Kapital darf sich frei bewegen, aber Menschen sollen es nicht. Unternehmen dürfen jeden Arbeiter weltweit gegen einen billigeren austauschen, aber wenn sich ein Arbeiter selbst auf den Weg macht, dann ist das plötzlich eine „Überforderung“.
Merz & Co. haben kein Problem mit Migration – solange sie nach unten drückt. Sie applaudieren, wenn osteuropäische Pflegekräfte für Hungerlöhne deutsche Senioren betreuen oder wenn Geflüchtete als Erntehelfer schuften. Aber wehe, sie verlangen Mindestlohn, Schutz oder Perspektiven. Dann wird die AfD-light-Rhetorik ausgepackt, und plötzlich geht es um „Leistungsmissbrauch“ und „Sozialtourismus“.
Das Drama der gescheiterten Globalisierungsgewinnler
Die besondere Lächerlichkeit dieses Theaters liegt darin, dass Leute wie Merz überhaupt nicht wissen, was sie wollen. Jahrzehntelang war ihre Botschaft klar: „Wir brauchen mehr Zuwanderung, um unsere Renten zu sichern, unsere Fachkräftelücken zu füllen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken!“ Aber nun, wo die Folgen ihrer eigenen Politik sichtbar werden – wo die soziale Ungleichheit explodiert, wo Geringverdiener realisiert haben, dass ihre Löhne nicht steigen, wo der Frust über den Neoliberalismus mit Wucht in den Mainstream einbricht –, versuchen sie, sich mit populistischen Nebelkerzen aus der Affäre zu ziehen.
So sitzt Merz da, mit seinem opportunistischen Dauergrinsen, und schwadroniert über „die Ampel, die die Kontrolle verloren hat“, während er in Wahrheit eine ganz andere Panik verspürt: die Angst, dass die Leute merken, wer wirklich schuld an der sozialen Spaltung ist. Es sind nicht die Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan oder Eritrea, die Deutschland „überfordern“. Es ist die Politik der Deregulierung, der Steuergeschenke für Konzerne, der Privatisierungen und des Lohndumpings, die die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter geöffnet hat.
Aber anstatt sich dieser Wahrheit zu stellen, wird Migration als Sündenbock instrumentalisiert. Wer über Wohnungsnot, marode Infrastruktur oder kaputte Schulen klagt, bekommt nicht zu hören: „Ja, das ist das Ergebnis jahrzehntelanger Kürzungspolitik.“ Nein, er soll glauben: „Das liegt an den Flüchtlingen.“
Der Robin Hood der Oberschicht
Man muss Merz eines lassen: Er hat das seltene Talent, ein Problem zu diagnostizieren, das er selbst verschärft hat, um dann eine Lösung zu fordern, die alles noch schlimmer macht. So wie er als BlackRock-Lobbyist die Vermögenskonzentration befeuert hat, um dann mit dem Märchen vom „steuerzahlenden Mittelstand“ gegen Erbschaftssteuern zu kämpfen, so beklagt er heute die soziale Verunsicherung, um sie mit noch mehr neoliberalem Kahlschlag zu beantworten.
Denn was ist seine eigentliche Antwort auf Migration? Weniger Sozialstaat, mehr Markt, mehr Druck auf Arbeitslose, mehr „Eigenverantwortung“ – sprich: genau die Politik, die dazu geführt hat, dass so viele Menschen das Gefühl haben, sie würden abgehängt. Wer also glaubt, Friedrich Merz interessiere sich ernsthaft für „die kleinen Leute“, der glaubt auch, dass ein Wolf Schäfer geworden ist, nur weil er sich mal ein paar Schafsfelle übergeworfen hat.
Das Ende der Maskerade
In Wahrheit haben Leute wie Merz keine Vision für Deutschland – außer einer, in der ihre eigene Klasse weiterhin profitiert, während der Rest sich gegenseitig zerfleischt. Ihre größte Angst ist nicht Migration, sondern Solidarität. Denn was wäre, wenn diejenigen, die sich heute von rechter Rhetorik blenden lassen, realisieren, dass ihre wahren Gegner nicht die Migranten sind, sondern die neoliberalen Strippenzieher, die ihre Löhne drücken, ihre Mieten explodieren lassen und ihre sozialen Sicherheiten abbauen?
Deshalb muss die Debatte so geführt werden, wie sie geführt wird: mit maximaler Emotionalisierung, mit Sündenböcken, mit Symbolpolitik, mit jeder Menge Nebelkerzen. Merz braucht die AfD, weil er genau wie sie lebt: von Spaltung, von Ablenkung, von falschen Fronten. Doch der Tag wird kommen, an dem die Maske fällt – und dann könnte es eng werden für die Herren der Heuchelei.
Der Wolf bleibt ein Wolf
Friedrich Merz als Verteidiger der sozialen Gerechtigkeit? Das ist, als würde Jeff Bezos über Gewerkschaften philosophieren oder Christian Lindner den Kommunismus entdecken. Nein, er bleibt, was er ist: ein knallharter Klassenkrieger, ein BlackRock-Lobbyist im CDU-Mantel, ein Wolf, der sich immer dann als Hirte geriert, wenn es ihm nützt.
Und deshalb, liebe Leser, gilt: Wenn Friedrich Merz über Migration spricht, dann redet er nicht über Migration. Er redet über Macht. Über Kontrolle. Und darüber, wie er beides behalten kann.