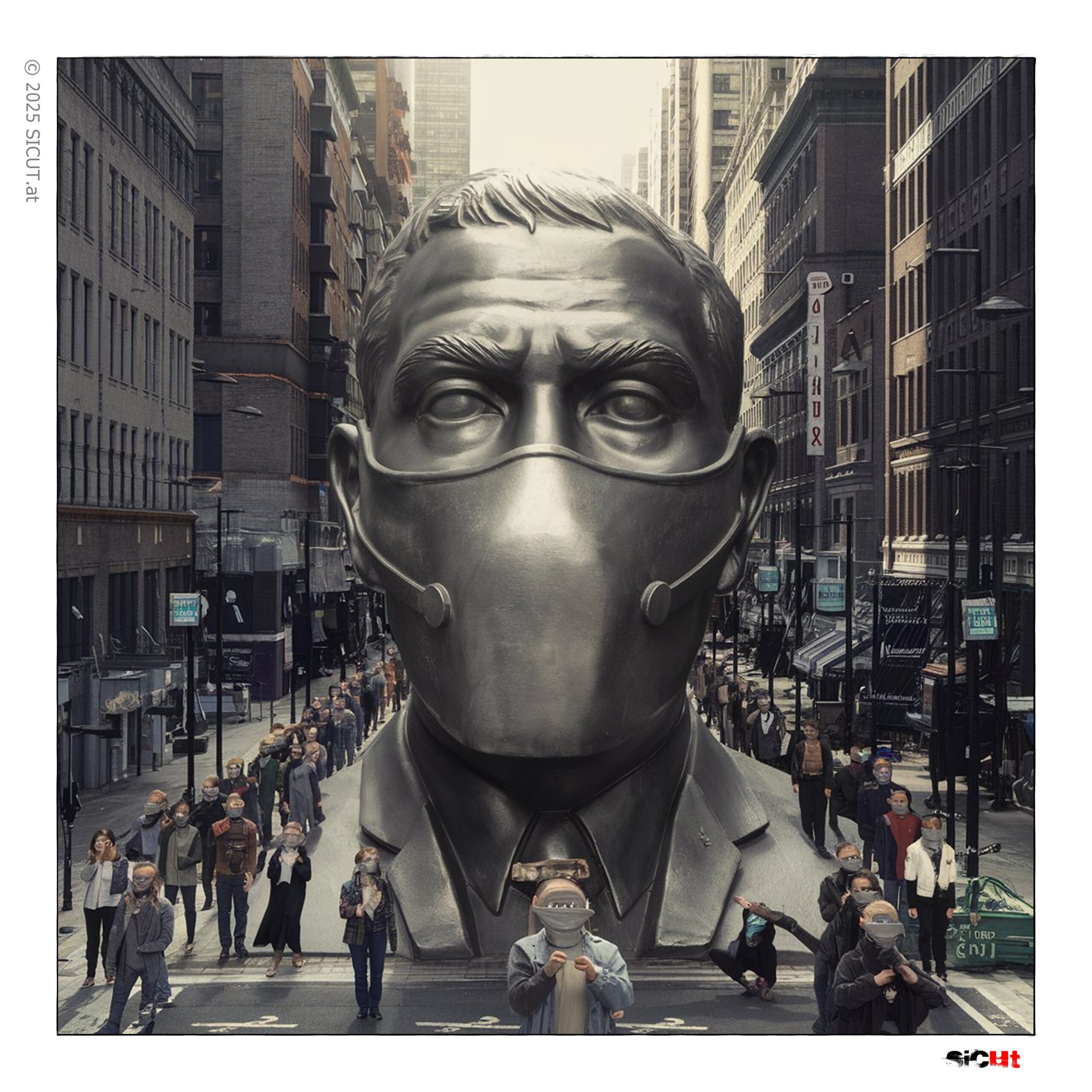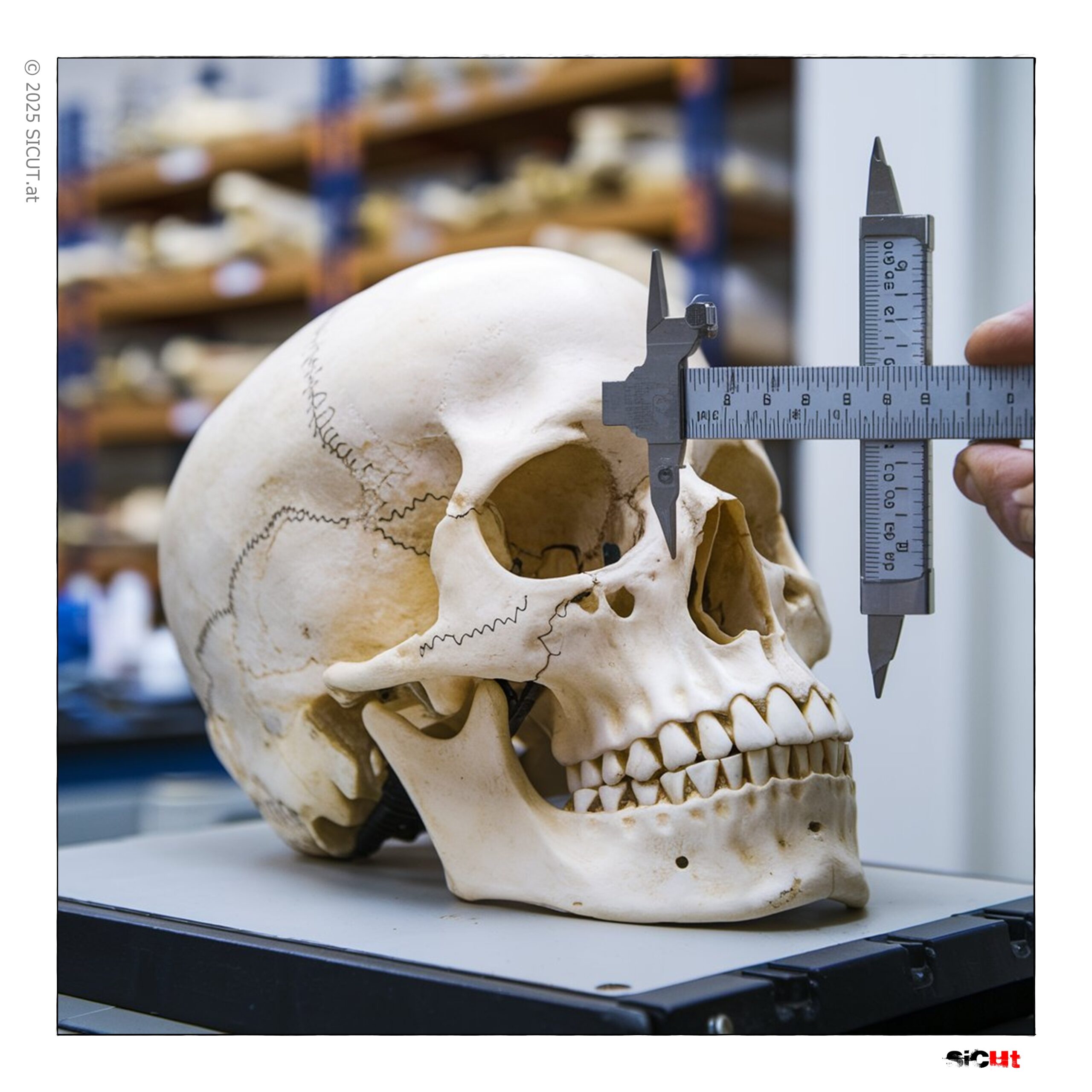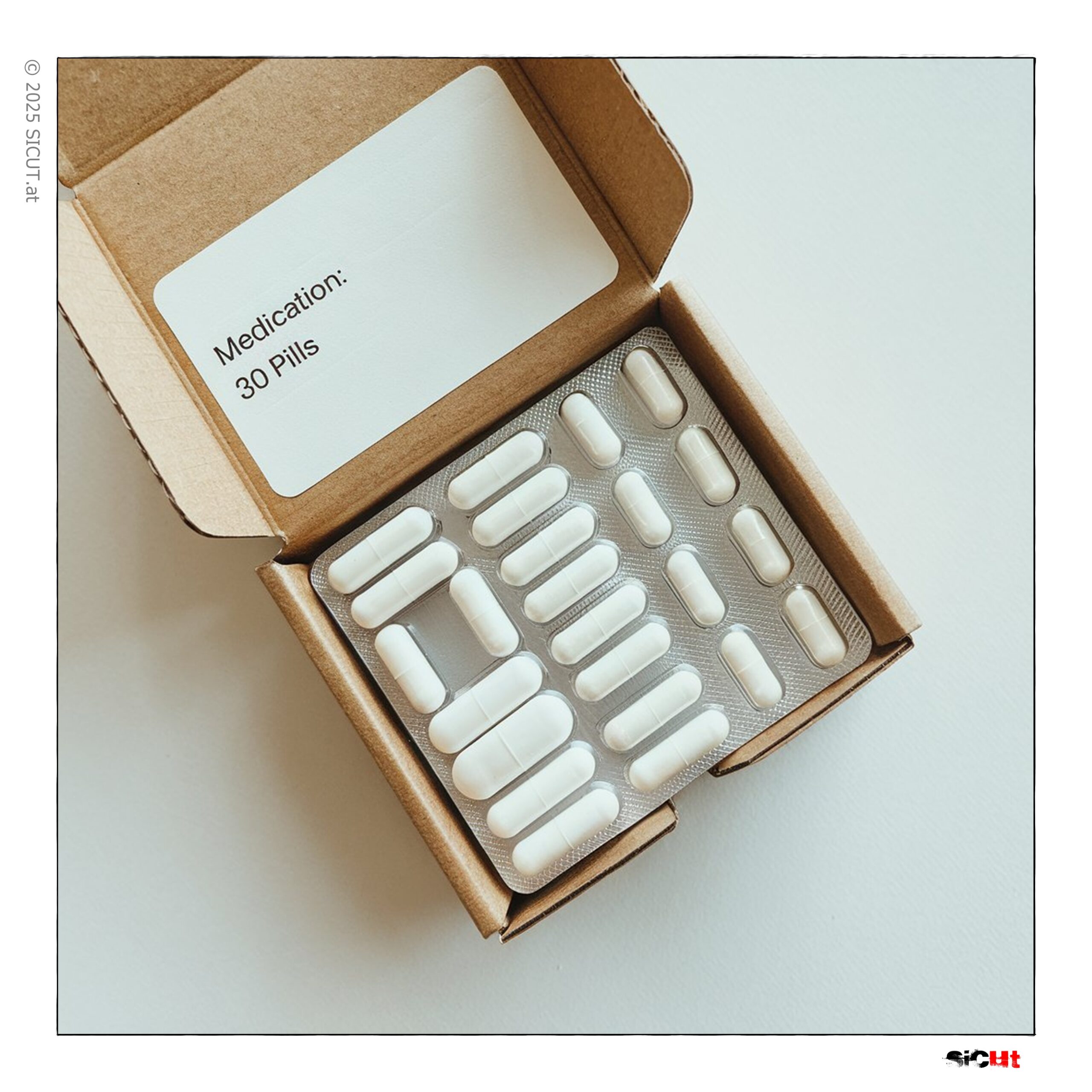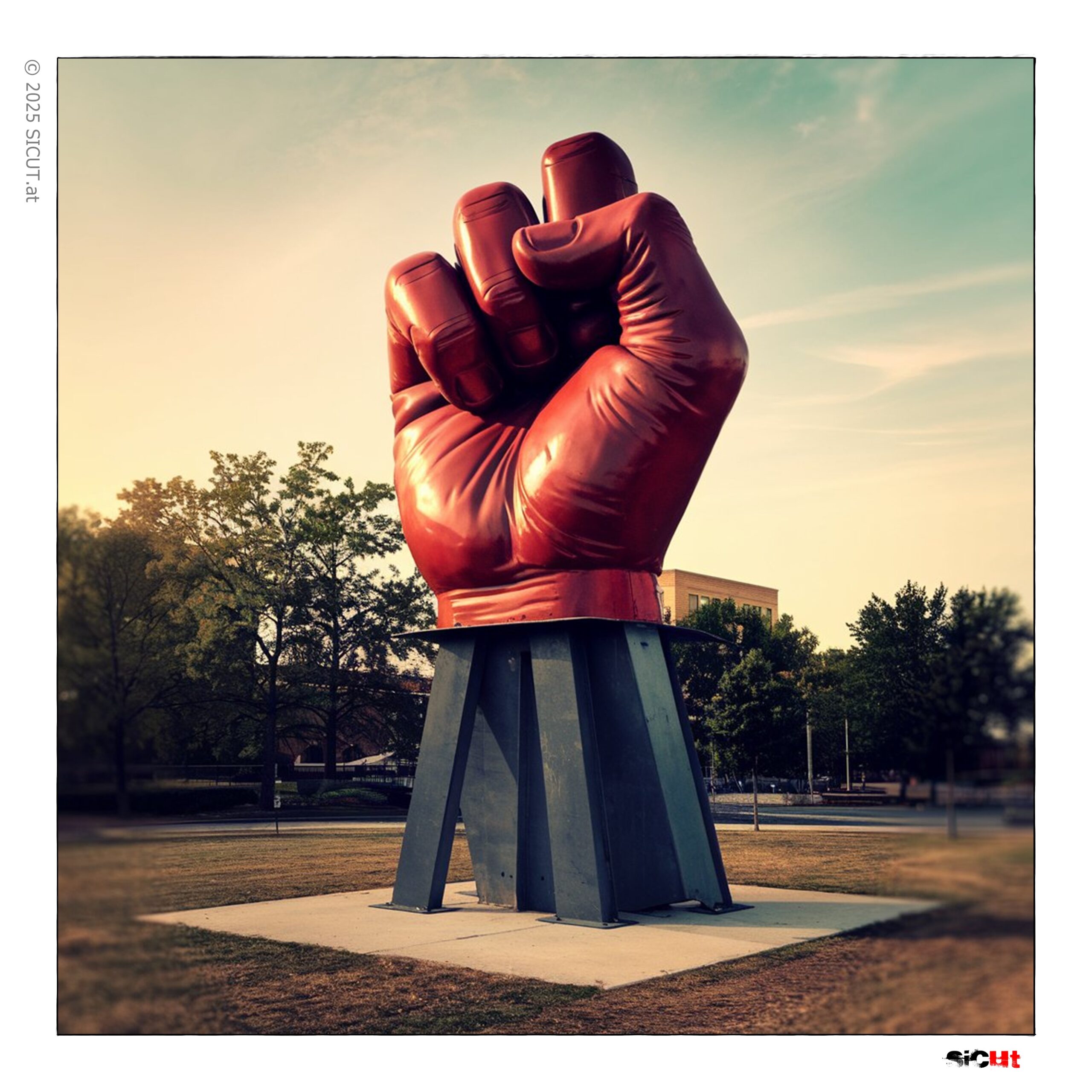Die Richtermacher tanzen den Spagat
Am 11. Juli 2025, einem Datum, das in die Annalen deutscher Demokratie eingehen wird wie eine warme Bierflasche in die Chronik sommerlicher Enttäuschungen, entscheidet der Bundestag über nichts Geringeres als die zivilreligiöse Weihe einer neuen Verfassungspriesterin: Frau Professorin Brosius-Gersdorf, deren Name bereits klingt wie eine Fußnote in einer Verwaltungsgerichtsentscheidung aus den 80er Jahren, soll zur Richterin am Bundesverfassungsgericht erhoben werden. Die höchste juristische Weihestufe der Republik – rot gewandet, über dem Gesetz stehend, dem Gewissen verpflichtet, aber meist einem Parteibuch näher als der objektiven Vernunft.
Nun könnte man sagen: Na gut, Richter kommen und gehen, aber was soll’s – der Rechtsstaat funktioniert doch, solange wenigstens das Wappen über dem Sitzungssaal noch adlerförmig bleibt. Doch halt! Diese Nominierung ist kein lauer Verwaltungsakt, keine Personalie unter vielen. Sie ist ein programmatischer Paukenschlag, ein verfassungsjuristischer Akt der Deutungshoheit – oder, um es mit einem anderen Wort zu sagen: ein Etikettenschwindel.
Menschenwürde light – der Fetisch der Definitionshoheit
Frau Brosius-Gersdorf, ihres Zeichens Professorin mit reichlich Publikationsvergangenheit, hat sich in der Vergangenheit nicht nur durch subtile juristische Ausdifferenzierung hervorgetan, sondern auch durch eine gewisse Bereitschaft, die Menschenwürde wie einen Mantel zu tragen, den man bei Bedarf ablegt, wenn es politisch zieht. Wer, wie sie, vorschlägt, dass ungeborenen Kindern im Mutterleib das Grundrecht auf Menschenwürde nicht automatisch zustehe, der stellt sich nicht nur gegen Jahrzehnte der verfassungsrechtlichen Dogmatik, sondern gegen den Kern dessen, was das „C“ im Parteinamen der CDU/CSU ursprünglich mal bedeutete – bevor es endgültig zu einer bloßen Glyphe verkommen ist, hübsch gerahmt im Parteilogo, aber ansonsten funktionslos wie ein Kirchturm in einem atheistischen Ferienpark.
Die Menschenwürde – jenes hochmoralische Versprechen der Verfassung, das als einziges Grundrecht nicht eingeschränkt werden darf – soll nun zur verhandelbaren Kategorie gemacht werden. Ein Fötus, ein Zellhaufen, ein rechtliches Nichts, solange er nicht atmet, schreit oder steuerlich veranlagt wird? Welch subversives Verständnis von Schutzbedürftigkeit – man möchte fast meinen, der Paragraph 1 GG sei neuerdings ein Antragsformular, kein Dogma.
Wehrhafte Demokratie als Illusionszauber
Man könnte vermuten, wer so locker die Menschenwürde für Ungeborene zur Disposition stellt wie eine schlecht begründete Seminarthese, würde staatlicher Macht mit Skepsis begegnen. Doch nein – Frau Brosius-Gersdorf zieht es vor, ihre juristische Energie auf ein anderes Lieblingsprojekt zu lenken: das Verbot der AfD. Nicht aus nüchterner Rechtsbetrachtung, sondern mit leuchtenden Augen und dem Brustton der Überzeugung. Ein AfD-Verbot sei ein „ganz starkes Signal“ – so nennt sie es. Signal! Welch schönes Wort, wenn man nichts verändern, aber dabei gut aussehen will.
Doch was dann folgt, ist der eigentlich aufschlussreiche Moment: Man müsse, so Brosius-Gersdorf, leider „bedenken, dass damit nicht die Anhängerschaft beseitigt“ werden könne. Beseitigt! Welch unglückliches Wort – oder war es vielleicht doch ganz bewusst gewählt? Man spürt beim Lesen förmlich das Bedauern, dass man sich zwar der Partei entledigen kann, aber nicht der Menschen, die sie wählen. Schade aber auch. Da hat man das Symptom endlich abgeschafft – und dann lebt die Krankheit einfach weiter. Diese Demokratie ist wirklich manchmal frustrierend.
Man wünscht sich fast, Frau Brosius-Gersdorf würde gleich ein Anschlussverfahren vorschlagen: nach dem Parteienverbot folgt das Wählerverbot. Ein „starkes Signal“ an all jene, die nicht richtig wählen wollen – oder schlimmer noch: überhaupt noch denken. Am besten mit rückwirkender Wirkung und digitaler Vollstreckung. Schließlich kann die Demokratie nicht wehrhaft sein, solange sie nicht auch sauber ist.
Was hier als staatsrechtliche Erwägung daherkommt, ist in Wahrheit der autoritäre Reflex der Besserwisserklasse: Man hätte sie so gern – diese radikalen Wähler, diese Störenfriede der Gesinnungshygiene – einfach aus dem Diskurs, dem Wahllokal, der Statistik. Und man sagt es auch. Fast beiläufig, fast nebenher. Als wäre es das Natürlichste der Welt: dass man sie nicht beseitigen kann. Leider.
Merz und das Orakel der Einfachheit
Und dann, als letzter Akt im moralischen Trauerspiel, tritt Friedrich Merz vor die Mikrofone – jener Mann, der als Kanzler der Selbstbehauptung inszeniert wurde, nun aber wirkt wie das museale Überbleibsel einer Partei, die einst vorgab, zwischen Soziallehre und Seelenheil zu balancieren. Die Frage, die ihm gestellt wird, ist keine banale. Keine technische. Keine taktische. Sie zielt ins Zentrum dessen, was einen Volksvertreter auszeichnen sollte: Kann er diese Entscheidung mit seinem Gewissen vereinbaren?
Die Antwort: ein schlichtes, ungerührtes, vollständig unreflektiertes „Ja“.
Kein Innehalten. Kein „Es war eine schwierige Abwägung“. Kein „Ich habe gerungen“. Kein „Ich vertraue auf die institutionelle Kraft unseres Rechtssystems“. Nein – nichts davon. Nur dieses eine, kalte, administrative Ja. Zwei Buchstaben, gesprochen mit der Emotionskraft eines Thermodruckers im Finanzamt.
Ein „Ja“ wie aus der Fabrik für politische Automatismen. Ein „Ja“ wie ein auswendig gelernter Schwur, den man längst nicht mehr versteht. Ein „Ja“, das nicht erklärt, nicht begründet, nicht verantwortet – sondern einfach nur abspult. Als sei das Gewissen ein Menüpunkt im Parteitagsprotokoll.
Vielleicht war es ein routiniertes Ja, wie man es sagt, wenn der eigene Kalender ein „Abnicken“ vorsieht. Oder ein innerlich längst entleertes Ja, das in Wahrheit ein „Ich will meine Ruhe“ meint. Vielleicht war es auch ein ironisches Ja – doch selbst dafür fehlte jede Spur von Zwinkern. So oder so: Dieses „Ja“ ist ein Totenschein. Für das Gewissen in der Politik. Für das Denken vor dem Entscheiden. Für eine Partei, die sich immer noch ein „C“ in den Namen schreibt, aber längst nicht mehr weiß, wofür es stehen sollte.
Merz sagt: Ja.
Und mit diesem Ja sagt er eigentlich alles – über sich, über seine Partei, über einen Zustand, in dem selbst das Gewissen nur noch eine lästige Nachfrage ist.
Das „C“ als Fossil – Grabrede auf ein christliches Phantom
CDU und CSU – jene Parteien, die einst den moralischen Kompass Deutschlands stellen wollten, wenn auch nicht immer treffsicher – sollten nun endlich das tun, was längst überfällig ist: das „C“ aus dem Parteinamen streichen. Nicht aus polemischer Lust, sondern aus intellektueller Redlichkeit. Denn wer einer Kandidatin zur höchsten moralischen Instanz der Republik verhilft, die ungeborenes Leben zur juristischen Fußnote erklärt, der kann sich das Christentum aus dem Namen meißeln wie man eine Heiligenstatue vom Giebel eines Bordells abnimmt. Es ist nur noch Dekoration – und niemand glaubt mehr daran.
Das „C“ ist heute nichts als rhetorisches Taxidermieprodukt – ausgestopft, poliert, an Feiertagen hervorgeholt. Die Realität sieht anders aus: Sie heißt Opportunismus, Anpassung, Machterhalt. Und mit Frau Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin wird diese Realität einen roten Talar tragen.
Schlussakkord: Satire oder Prophetie?
Man fragt sich, ob das alles noch Satire ist oder schon dystopischer Realismus. Vielleicht ist es beides. Vielleicht leben wir längst in einem politischen Roman von Heinrich Böll, nur ohne Bölls Stilgefühl und Widerstandskraft. Vielleicht ist Frau Brosius-Gersdorf die logische Konsequenz eines Systems, das sich selbst als demokratisch verklärt, aber zunehmend technokratisch kastriert.
Der 11. Juli 2025 wird ein Test. Nicht für Frau Brosius-Gersdorf – die ist längst durch alle Instanzen der akademischen Selbstvergewisserung geprügelt worden. Sondern für das Parlament. Für die Parteien. Für das letzte Restgewissen einer politischen Klasse, die noch weiß, dass man über die Menschenwürde nicht abstimmen kann, ohne dabei sich selbst zur Disposition zu stellen.
Doch seien wir ehrlich: Wir kennen das Ergebnis bereits.
Merz sagt ja.
Und das „C“ stirbt schweigend.