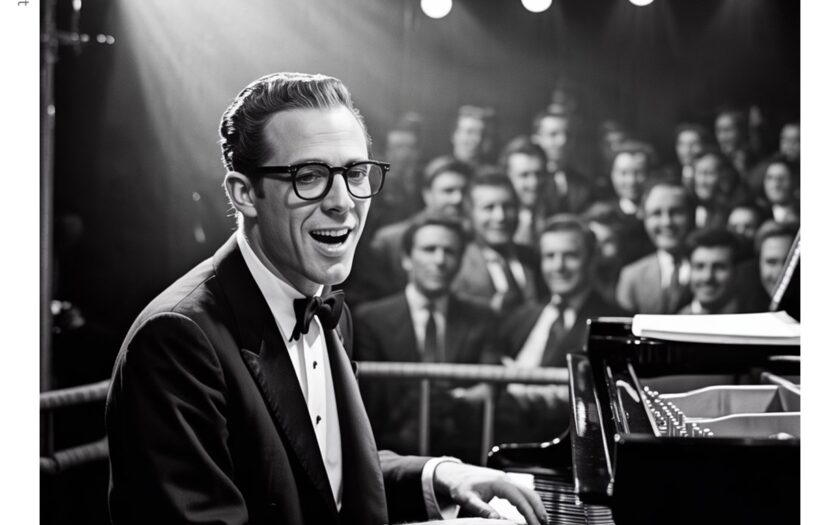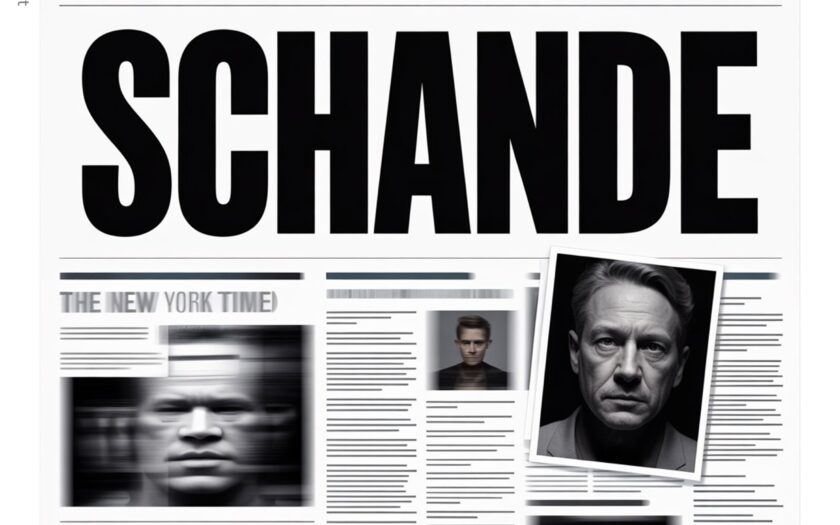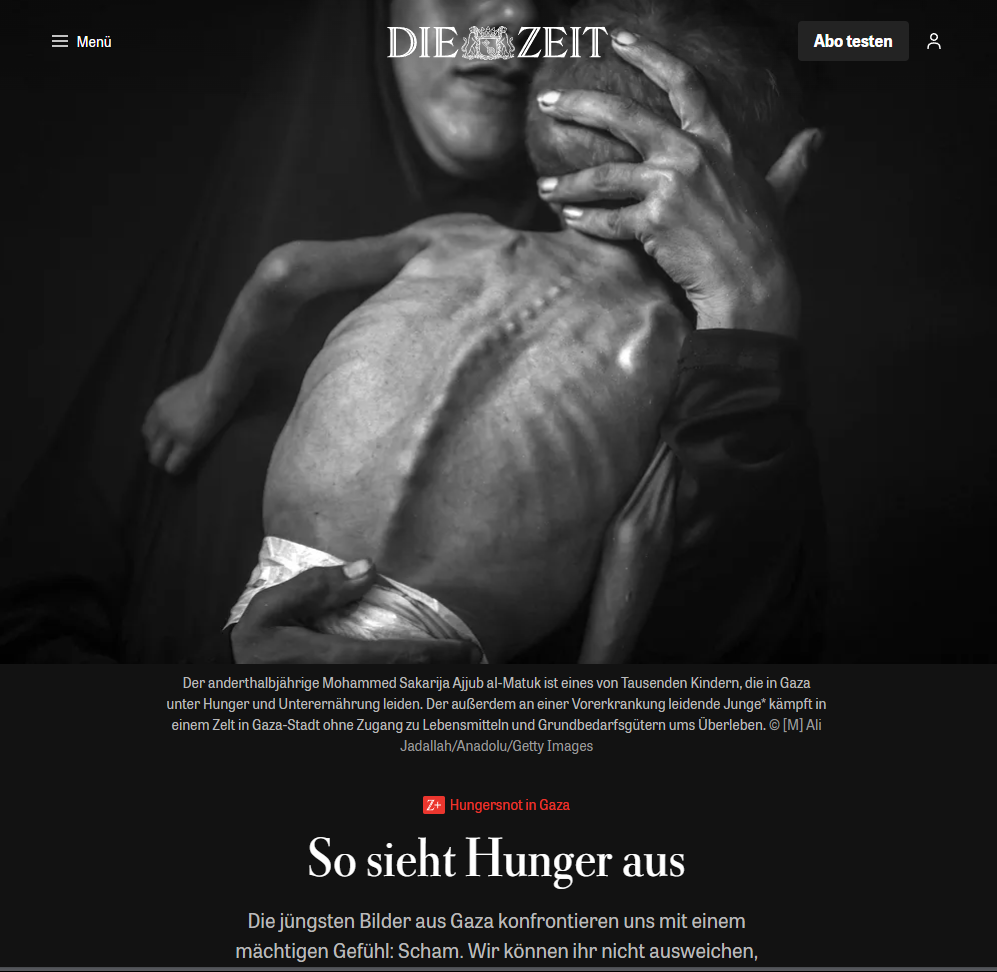Ein Nachruf auf die politische Zurechnungsfähigkeit
Wenn eines den Deutschen heilig ist – neben dem Dackel, dem Datenschutz und dem bindestrichgeadelten Titelwesen – dann ist es der funktionierende Bahnverkehr. Doch wie alles, was man liebt, wird es früher oder später angezündet. Im aktuellen Fall nicht metaphorisch, sondern ganz konkret: durch ein paar Radikale mit Zeitzünder und ideologischem Kurzschluss. Die Täter? Eine Antifa-Gruppe mit ökoklimatischem Erweckungspathos, ein Grüppchen, das seine Radikalität aus einer Melange von Weltuntergang und Weltenrettung bezieht, sich selbst dabei als eine Art bewaffneter Erlösertrupp inszeniert. Die Methode? Brandsatz auf Kabel. Das Ziel? Alles, nur nicht Versöhnung.
„Die Zeit, an einer Versöhnung der Seiten zu arbeiten, ist vorbei“, verkünden die Täter mit der Nonchalance selbsternannter Endzeitpropheten, als hätten sie gerade beschlossen, dass Kommunikation überbewertet ist. Vielleicht zu viele Nietzsche-Zitate gelesen, aber nur halb verstanden. Vielleicht auch einfach nur gelangweilt vom politischen Mittelmaß, das keine Revolution verspricht. Der Bahnanschlag als symbolische Begleitmusik einer unterkomplexen Weltverachtung, zündelnd inszeniert auf Kosten von Infrastrukturen und Gesellschaftsvertrag.
Brandsätze statt Argumente: Vom ideologischen Eifer zur strategischen Dummheit
Der „Eisblock Timer“ – eine Bastelanleitung aus dem humorlosen Arsenal der Sabotageliteratur für Möchtegern-Guerilleros – ist offenbar das Gadget der Stunde. Während der Rest der Welt darüber streitet, wie man das Klima schützt ohne dabei die Gesellschaft gleich mit abzufackeln, greifen diese militanten Klimaaktivisten zur Technik der Zerstörung, weil Argumente offenbar zu wenig Feuerkraft haben. Wer keine Geduld für Diskurs hat, bastelt sich eben seine Wirkung – aus Benzin, Uhrwerk und ideologischer Frustration.
Die Ironie dabei: Diese Täter kämpfen angeblich für die Zukunft, indem sie die Gegenwart zerstören. Das wäre fast poetisch, wenn es nicht so wahnsinnig wäre. Es ist, als würde man ein Krankenhaus in die Luft jagen, um gegen Krankheit zu protestieren. Aber vielleicht ist Logik ja nur ein Herrschaftsinstrument in der dialektischen Fantasie dieser Aktivisten. Vielleicht bedeutet Freiheit in ihren Kreisen ohnehin nur die Lizenz zur Anarchie.
Wenn Notwehr zur Religion wird: Moralischer Narzissmus im Endzeitkostüm
Besonders bemerkenswert – oder vielmehr alarmierend – ist die Selbstrechtfertigung der Täter. Man fühlt sich im Recht, in der Pflicht, ja fast schon im sakralen Auftrag. Ihre Gewalt sei Notwehr, ihre Sabotage das notwendige letzte Mittel, weil die Welt nicht auf sie hört. Eine Mischung aus narzisstischem Opfermythos und revolutionärer Erlösungsfantasie.
Wer nicht „so radikal denkt“, ist Feind. Wer abwägt, kollaboriert. Wer demokratisch entscheidet, bremst die Geschichte aus. Aus dem Geltungsdrang wird Gewalt, aus der Ohnmacht Übergriffigkeit, aus der Frustration Terror. Das Bekennerschreiben liest sich wie das Tagebuch eines trotzig verzweifelten Kindes, dem man die Welt nicht nach Wunsch zurechtbauen will. Dabei wirkt das ganze Pathos wie ein Schulaufsatz aus dem Seminar „Moralische Überlegenheit für Anfänger“.
Verrat an der eigenen Bewegung: Wenn der Kampf fürs Klima in Brandstiftung endet
Nicht nur die Gesellschaft wird zur Zielscheibe, auch die eigenen Leute. Die Täter geißeln die „Mainstream“-Klimaaktivisten – Luisa, Greta, alle, die es zu Talkshowruhm oder NGO-Karriere gebracht haben – als abtrünnige Opportunisten. Deren Fehler? Nicht radikal genug. Nicht brennend genug. Nicht bereit, die letzten Brücken zur Realität hinter sich abzureißen. Die Revolution duldet eben keine Differenzierung.
Was dabei untergeht: Dass genau diese „Mainstream“-Bewegung überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Themen wie Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf der politischen Agenda auftauchten. Aber für die Extremisten sind Vermittler nur Schwächlinge. Wer nicht mit brennt, ist verbrannt. Eine groteske Logik, die ausgerechnet in jenem Fanatismus wurzelt, den man angeblich bekämpfen will.
Staatliche Fördergelder für die Demokratie – oder doch für deren Feinde?
Dass die Antifa in Teilen von SPD, Grünen oder Linken zumindest toleriert, wenn nicht sogar mittelbar durch gewisse NGOs mit öffentlichen Geldern gestützt wird, ist ein offenes Geheimnis, das wie ein schlecht gewarteter Feuerlöscher neben einem brennenden Ölfass steht. Man wollte „gegen rechts kämpfen“ – was grundsätzlich ehrenwert ist – und hat dabei die Brandstifter aus den eigenen Reihen übersehen oder unterschätzt.
Es ist ein Paradebeispiel für das alte linke Dilemma: Man will Gerechtigkeit, bekommt aber Fanatismus. Man will Widerstand, bekommt aber Gewalt. Und am Ende sitzt der Rechtsstaat da wie ein geschlagener Schulmeister, der zwar Förderanträge prüfen kann, aber nicht erkennt, wann seine Schüler längst zu Pyromanen geworden sind.
Die Lücke im Rechtsstaat – zwischen politischer Naivität und operationaler Blindheit
Während ein „Kommando Angry Birds“ Bahnkabel anzündet und sich dabei auf eine Mischung aus Karl Marx, Twitter-Rage und Bastelanleitungen aus dem Internet beruft, diskutiert der deutsche Rechtsstaat noch über Gendersterne im Verfassungsschutzbericht. Es ist, bei aller Notwendigkeit differenzierter Betrachtung, ein Armutszeugnis. Ein Staat, der bereitwillig den Verfassungsschutz auf Landwirte ansetzt, aber den Sprengsatz unter seinen Verkehrsadern erst bemerkt, wenn der Fahrplan explodiert, hat das Verhältnis von Risiko und Ideologie endgültig verloren.
Der Rechtsstaat darf nicht wegschauen, wenn sich linke Gewalt in die Wohlfühlfassaden der „richtigen Gesinnung“ schleicht. Wer gegen rechts mit Inbrunst kämpft, aber bei linkem Terrorismus milde laviert, gefährdet seine eigene Glaubwürdigkeit. Gewalt bleibt Gewalt – unabhängig vom ideologischen Anstrich. Und wer Gewalt relativiert, wird früher oder später zum Mittäter.
Epilog mit Brandsatz – Von der Endzeitpose zur Gegenwartsverachtung
Es bleibt am Ende eine bittere Erkenntnis: Die Täter dieses Anschlags hassen nicht nur die Konzerne, die Strukturen oder den Kapitalismus. Sie hassen auch die Menschen, die in Zügen sitzen, zur Arbeit fahren, ihre Kinder besuchen, ein Wochenende planen. Sie verachten das Alltägliche, weil es ihnen zu banal ist, um als revolutionär zu gelten. Sie wollen die Welt brennen sehen – im Namen der Rettung.
Doch die Frage, die sie nie beantworten werden, ist diese: Wenn ihr wirklich glaubt, dass die Gesellschaft euch verraten hat – was genau habt ihr ihr je angeboten außer eurem Zorn?
Denn wer alles niederbrennt, wird am Ende nicht als Visionär erinnert, sondern als der, der nicht unterscheiden konnte zwischen einem Leuchtturm und einem Molotowcocktail.