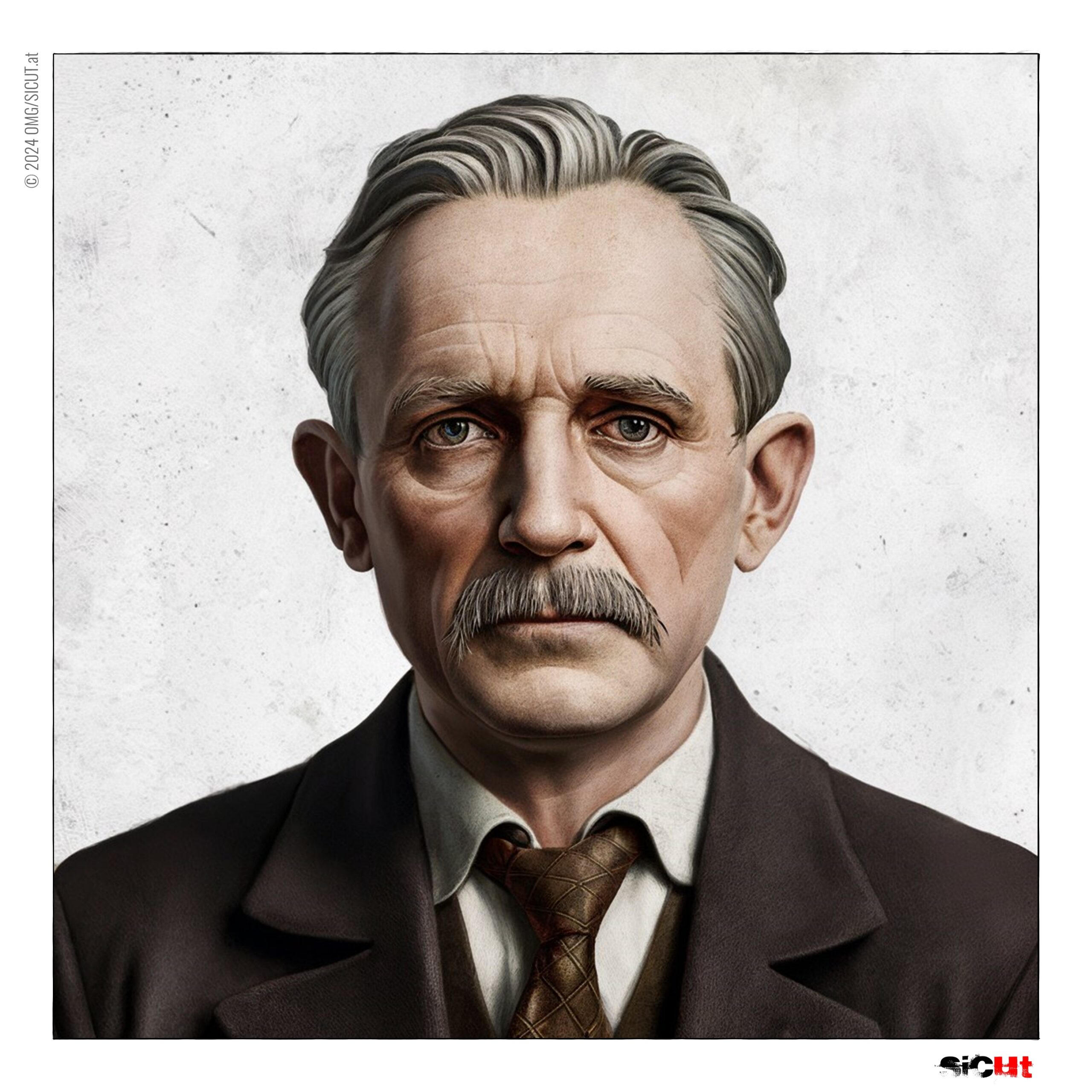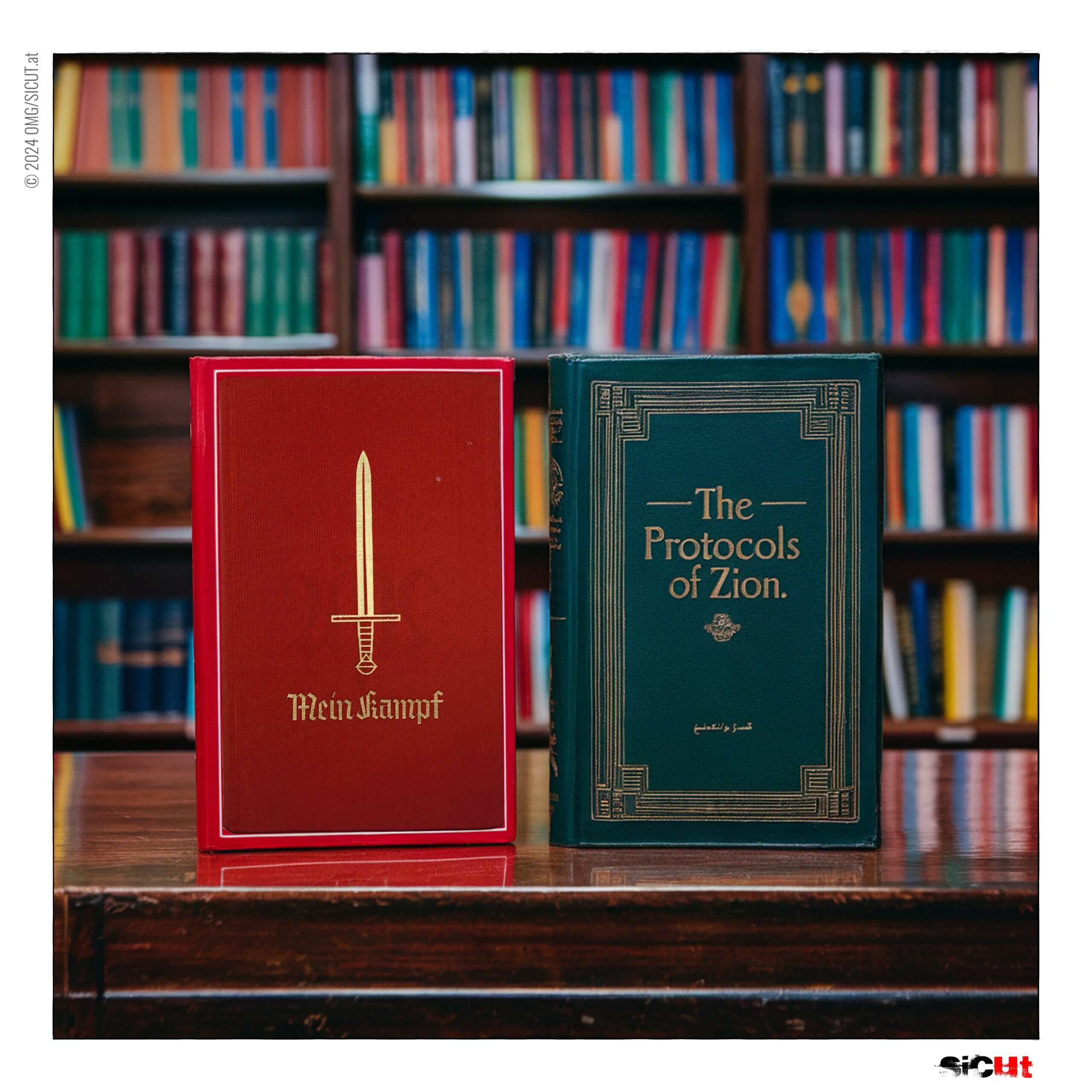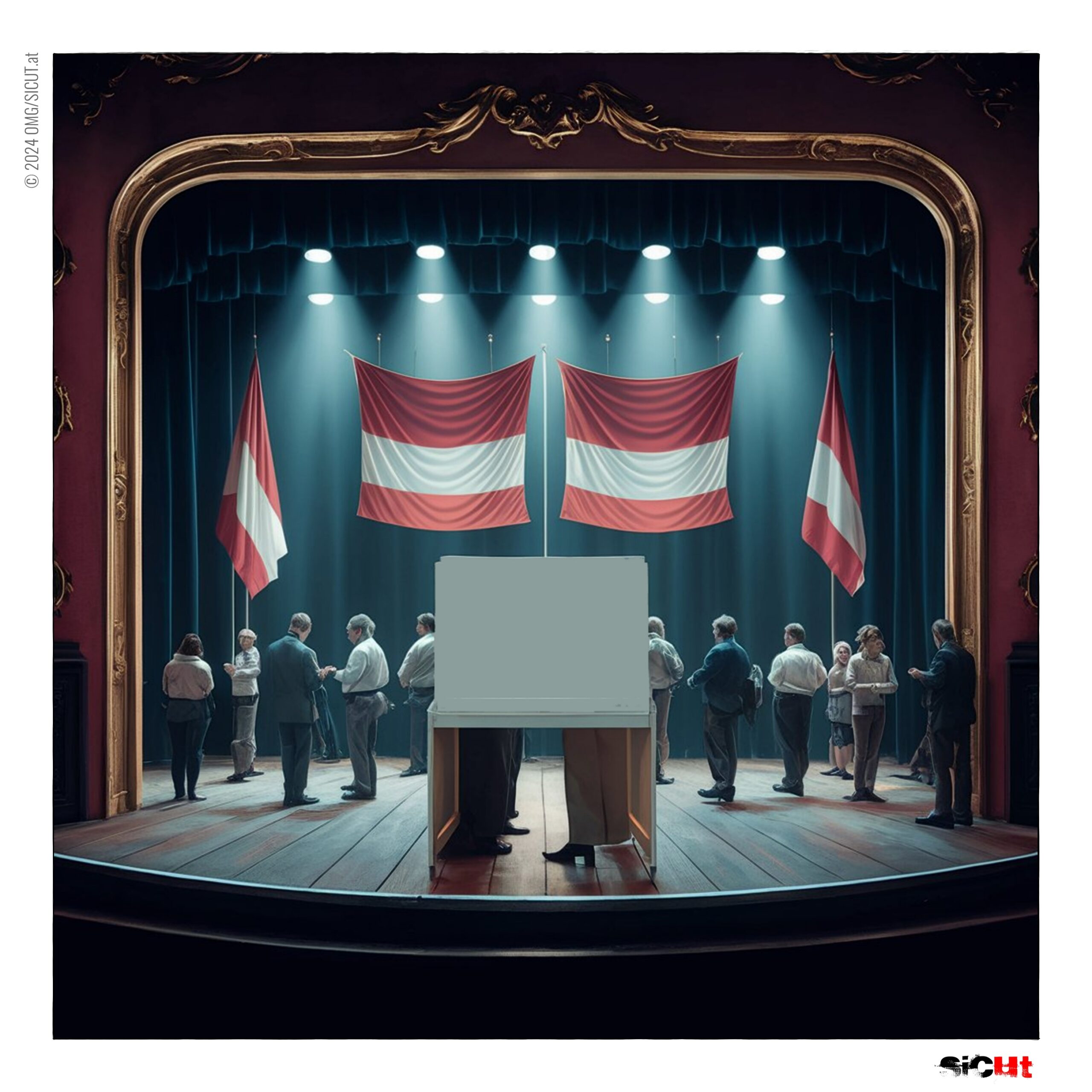Gesinnungsethik gegen Verantwortungsethik – das ewige Duell
Es gibt da diesen einen Satz von Max Weber, der so häufig zitiert wird, dass man glauben könnte, er sei irgendwo in den Wänden des Bundestags eingemeißelt: „Gesinnungsethik und Verantwortungsethik“ – zwei Ethiken, die auf dem Papier wunderbar nebeneinander existieren, in der Praxis aber wie Hund und Katz aufeinander losgehen. Und mittendrin: Die Grünen und die Linken, die unermüdlichen Taktgeber der moralischen Komposition, immer darauf bedacht, dass der Dirigent den rechten Takt vorgibt.
Doch ach! Es gibt einen kleinen, kaum erwähnenswerten Haken an der ganzen Sache: Während die Gesinnungsethik mit breiter Brust das edle Ziel, die reine Idee in den Himmel hebt, stolpert die Verantwortungsethik meist über die lästigen Stolpersteine der Realität. Denn da draußen, liebe Freunde des Idealismus, stehen die unbequemen Tatsachen bereit – die Märkte, die Physik und, wie könnte es anders sein, die menschliche Natur. Aber lasst uns diese störenden Elemente für einen Moment beiseiteschieben, wir haben schließlich eine Utopie zu dirigieren!
Mit dem Fahrrad zur Energiewende!
Da wäre also zunächst die Politik der Grünen, jener moralische Kompass, der so strikt nach Norden zeigt, dass der Süden sich beleidigt abwendet. Es geht um das große Ziel: die Klimarettung, die Transformation der Wirtschaft, die Wende zu einer besseren, gerechteren Welt – und zwar alles gleichzeitig, bitte. Klar, dass der Kapitalismus in dieser Sinfonie keinen Platz hat, ist doch das freie Spiel der Kräfte in den Augen vieler nichts anderes als ein chaotisches Gedränge auf dem Weg ins Verderben.
Also braucht es einen Plan. Und wer könnte den Plan besser entwerfen als die moralischen Avantgarden? Der grüne Faden der Moral ist dabei unverwüstlich: Das Elektroauto wird zur neuen Erlösungsformel, der Solardachzwang wird mit Schwung aus der Tasche gezogen, und das Tempolimit als Allheilmittel gegen die Verkehrssünden darf natürlich auch nicht fehlen. Jeder Gedanke ist von reiner Gesinnung durchtränkt, der Gedanke an die Umsetzbarkeit tritt höflich einen Schritt zurück – man will ja nicht als „unprogressiv“ gelten.
Doch halt! Wurden da nicht gerade erst Autobahnblockaden von Aktivisten abgehalten, die glauben, die Energiewende ginge nicht schnell genug? Ironischerweise bringen sie mit ihrer radikalen Gesinnungsethik den täglichen Verkehr (also das reale Leben) zum Erliegen, während die Verantwortungsethik im Stau steht und sich fragt, wo in dieser Sinfonie der rationale Takt geblieben ist. Vielleicht hätte man doch lieber zuerst die Struktur des Stromnetzes stabilisieren sollen, bevor man die Kohlekraftwerke abschaltet. Aber wer braucht schon ein Stromnetz, wenn man guten Willen hat?
Eine Revolution ohne Plan B
Nun, liebe Leserinnen und Leser, wenden wir uns der Linken zu, deren Utopien so strahlend sind, dass man am liebsten Sonnencreme tragen möchte, wenn sie ihre Programme enthüllen. Was hier geboten wird, ist nicht weniger als das Versprechen auf das Paradies – ohne Ausbeutung, ohne Ungerechtigkeit, ohne Kapitalisten, die uns alle knechten. Und, wie könnte es anders sein, ohne Rücksicht auf die finanziellen oder wirtschaftlichen Realitäten. Es ist ja schließlich eine Revolution! Und Revolutionen fragen nicht, sie befehlen.
Also her mit dem bedingungslosen Grundeinkommen für alle! Höhere Steuern für die Reichen, grenzenlose Sozialleistungen für die Armen, und natürlich ein staatlich gelenkter Wohnungsmarkt. Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Warum also zögern? Die Gesinnungsethik weiß, dass es moralisch richtig ist, den Reichtum umzuverteilen. Dass dabei möglicherweise der letzte Investor das Land verlässt und der Wohlstand in den Urlaub fährt, wird übersehen. Verantwortungsethik? Ach, die kann später nachkommen, wenn wir alle in der sozialistischen Utopie angekommen sind.
Und dann wäre da noch die Sache mit der offenen Migrationspolitik. Natürlich, alle sind willkommen! Die Grenzen öffnen sich weit wie das Herz der Linken. Dass der Sozialstaat nicht unendlich belastbar ist und dass Integration mehr erfordert als nur einen warmen Händedruck, wird in den feinen Nuancen dieser Utopie großzügig übergangen. Denn warum über Details nachdenken, wenn das große Ziel so strahlend vor einem liegt? Gesinnung über Verantwortung – das ist die Melodie, nach der hier getanzt wird.
Von der Staatslenkung zum Staatszwang
Da wären wir also beim zentralen Begriff: Dirigismus. Ein Wort, das so französisch klingt, dass es fast schon charmant wirkt, obwohl es nichts anderes bedeutet als „Staatslenkung“. Die Vorstellung, dass die klugen Köpfe in den Ministerien, unterstützt von Heerscharen ideologisch beflügelter Berater, besser wissen, wie man eine Gesellschaft steuert, als die Menschen selbst, zieht sich wie ein roter Faden durch die Programme der Grünen und Linken.
Denn seien wir ehrlich: Wer will schon die Kräfte des Marktes spielen lassen, wenn man alles mit kluger Hand regeln kann? Wer glaubt noch an die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, wenn man ihn doch sanft, aber bestimmt, in die „richtige“ Richtung lenken kann? Und wer braucht schon den Wettbewerb, wenn man mit Planwirtschaft das Himmelreich auf Erden erschaffen kann?
Die Ideen klingen so einfach: höhere Steuern, strengere Regulierungen, mehr Umverteilung. Alles nur zu unserem Besten, versteht sich. Aber wie sich das in der Realität anfühlt, wenn der Staat erst einmal die Kontrolle über alle Lebensbereiche übernommen hat, wird in den Gedankenspielen der Gesinnungsethiker oft übersehen. Max Weber dürfte im Grabe rotieren, wenn er mitansehen müsste, wie wenig seine Warnung vor der Gesinnungsethik in diesen Kreisen Gehör findet.
Der Traum von der perfekten Gesellschaft
Es ist schön, von Utopien zu träumen. Wer würde nicht gern in einer Welt leben, in der es keine Armut, keine Ungerechtigkeit und keine Umweltverschmutzung gibt? Doch wie wir alle wissen: Träume sind dazu da, um zu zerplatzen, wenn sie auf die harte Realität treffen. Während die Gesinnungsethik den moralischen Zeigefinger erhebt und die Vision einer besseren Welt predigt, erinnert uns die Verantwortungsethik daran, dass jede noch so gute Idee ohne realistische Umsetzungsmöglichkeiten zum Scheitern verurteilt ist.
Aber warum sich den nüchternen Fakten stellen, wenn die moralische Überlegenheit so viel angenehmer ist? Da kann man sich doch viel besser zurücklehnen, die Nase ein wenig höher tragen und sich auf der richtigen Seite der Geschichte wähnen. Dass man dabei das Grundgesetz des politischen Handelns – nämlich das der realistischen Machbarkeit – ignoriert, spielt keine Rolle. Schließlich sind wir ja im Dienste der guten Sache unterwegs.
Zwischen Utopie und Realität
In der Debatte zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik neigen die Grünen und die Linken dazu, sich immer wieder auf die Seite der Gesinnung zu schlagen. Das große Ziel der moralischen Reinheit blendet dabei die Komplexität der Wirklichkeit aus. Doch wie wir aus der Geschichte wissen: Ohne einen gesunden Schuss Realismus und Verantwortung wird jede Utopie früher oder später zur Dystopie.
Max Weber hat uns vor den Gefahren einer Politik gewarnt, die sich nur auf die Gesinnung stützt, ohne die Folgen des eigenen Handelns zu bedenken. Und wenn wir uns die aktuellen politischen Debatten ansehen, scheint es, als würde seine Mahnung in den Fluren der Macht verhallen. Aber solange der Kaffee in den Ministerien heiß und die moralische Erhabenheit ungebrochen bleibt, darf der Dirigismus weiter aufspielen – und die Verantwortungsethik bleibt im Keller der Realität.
Weiterführende Links und Quellen:
- Max Weber, Politik als Beruf (Vortrag, 1919)
- Bundeszentrale für politische Bildung: Max Webers Gesinnungs- und Verantwortungsethik
- Grünes Grundsatzprogramm 2020
- Linke Parteiprogramme
- OECD-Berichte zu Sozialstaaten und Wirtschaftspolitik