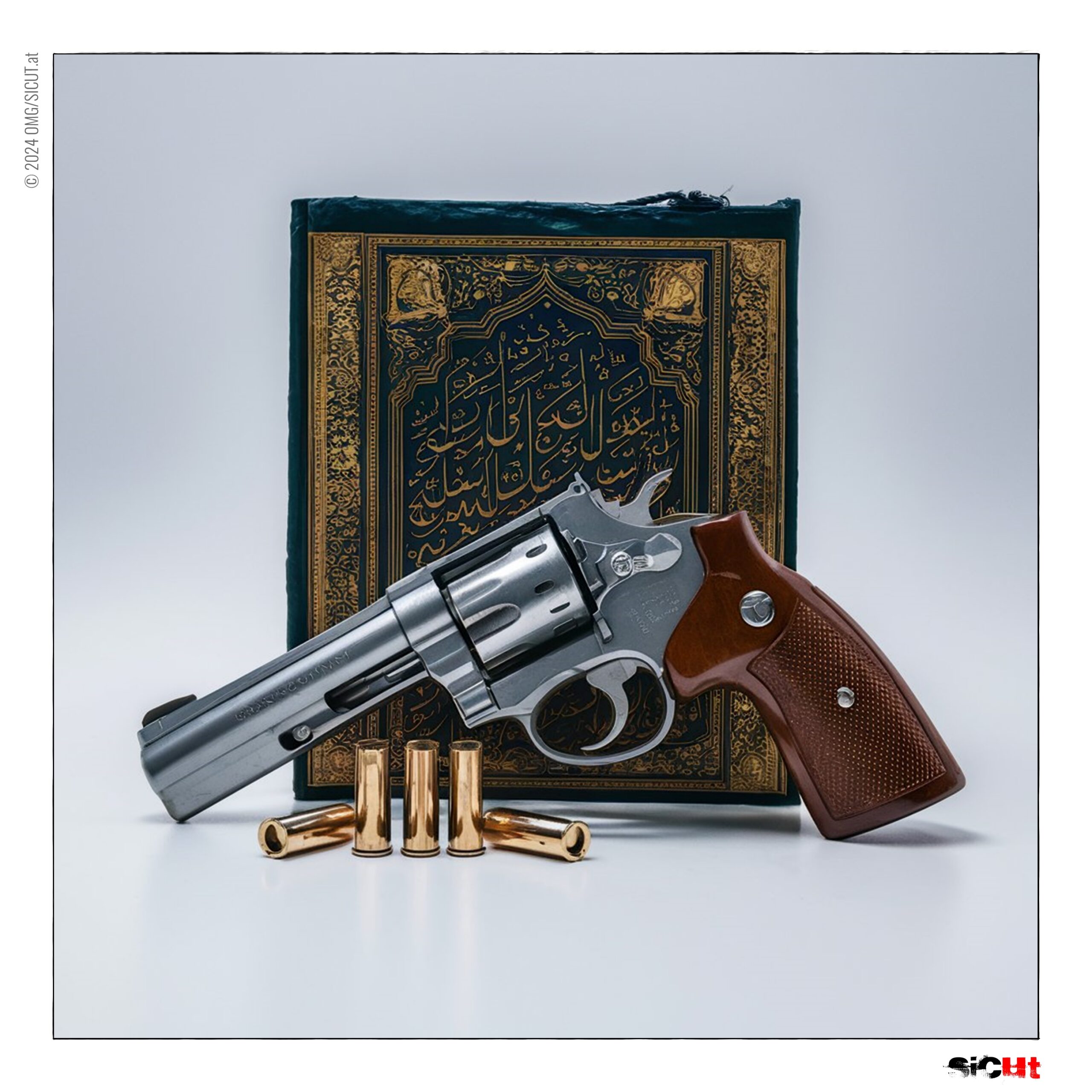Die Tänzer: Banken, Kirchen, Milliardäre – oder warum Medien in Österreich klingen wie ein gut geöltes Schallplattenensemble
Es scheint, als stünde die österreichische Medienlandschaft täglich vor einem großen Spiegel, um ihre perfekte Choreographie einzuüben. Die Hauptakteure? Die üblichen Verdächtigen: Raiffeisen, die katholische Kirche, einige wenige Unternehmerfamilien und ein paar staatsnahe Söldner, die sich mit Steuergeldern die Schuhe polieren lassen. Der Tanzboden? Ein verschachteltes Netzwerk aus Eigentumsverhältnissen, das so opak ist wie der nächtliche Donaukanalnebel.
Betrachten wir zunächst die Raiffeisen-Gruppe, die ein Meisterstück im „Pas de Deux“ zwischen Medien- und Wirtschaftsmacht aufführt. Mit ihren Beteiligungen an der „Kronen Zeitung“, dem „Kurier“ und nicht zu vergessen ihrer Symbiose mit der katholischen Kirche (Stichwort: NÖN), schafft sie es, die Melodie des konservativen Österreichs durch jede Druckerpresse zu jagen. Kritiker würden sagen: „Propaganda mit Weichzeichner.“ Befürworter? Nun, die sind schwerer zu finden – vielleicht unter den Vorstandsmitgliedern der ÖVP.
Steuerzahler tanzen mit – unfreiwillig
Doch der eigentliche Skandal ist nicht das enge Miteinander von Banken und Redaktionen. Es ist das staatliche Förderkarussell, das diesen Medienwalzer erst richtig beschleunigt. Jährlich pumpen Steuergelder Millionen in den Boulevardjournalismus. Ob „Kronen Zeitung“ oder „Heute“ – beide kassieren großzügige Summen für „journalistische Leistungen“, die man bestenfalls als Unterhaltung für die Wartezimmer der Republik bezeichnen könnte.
Man fragt sich: Ist das ein subventioniertes Trommelfeuer an Stereotypen und Vereinfachungen? Oder dient es dem vielbeschworenen „Erhalt der Pressefreiheit“? Die Antwort? Kommt darauf an, wen Sie fragen. Der österreichische Steuerzahler jedenfalls wippt zwangsweise im Takt.
Die Kirche und ihre stille Macht: Ein diskreter Wiener Walzer
Während die katholische Kirche in den Predigten Demut predigt, tanzt sie in der Medienwelt den eleganten Wiener Walzer der Macht. Über den Styria-Verlag kontrolliert sie nicht nur Qualitätsblätter wie die „Presse“, sondern auch softere Angebote wie „Die kleine Zeitung“. Selbst Plattformen wie Willhaben.at liegen in ihrem Einflussbereich – ein hübsches Geschäftsmodell, das geistliche Werte mit Marktkapitalismus vereint.
Die Symbiose mit Raiffeisen, sichtbar am Beispiel der „Niederösterreichischen Nachrichten“, gleicht einem harmonischen Duett, bei dem jeder Schritt ein Statement ist: „Uns gehört der Diskurs, und wir bestimmen, wie er geführt wird.“
Boulevard: Die chaotischen Tänze der Dichands und Fellners
Nicht zu vergessen die große Show des Boulevards. Die Familie Dichand und die Fellner-Brüder inszenieren sich wie die John Travoltas der österreichischen Medienwelt – ein Feuerwerk aus Schlagzeilen, Glitzer und dem gelegentlichen Stolpern über journalistische Ethik. Beide beherrschen den Cha-Cha-Cha der Auflagezahlen, gespeist aus Skandalen, Halbwahrheiten und der Kunst, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen.
Dass die Familie Dichand mit ihren Beteiligungen an der „Krone“ und „Heute“ gleich zwei der einflussreichsten Zeitungen kontrolliert, ist dabei ebenso pikant wie die Tatsache, dass sie damit fast jede zweite Zeitungsseite Österreichs prägt.
Das staatliche Intermezzo: APA und ORF
Und dann gibt es noch die große Staatskapelle: den ORF und die Austria Presse Agentur (APA). Während der ORF als Dinosaurier des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit gigantischen Gebühreneinnahmen auf den Paukenschlag wartet, ist die APA der heimliche Dirigent, der den Takt vorgibt. Sie versorgt die meisten Redaktionen mit vorgefertigten Nachrichten. Ein wenig hintergründige Recherche, ein wenig Hintergrundrauschen – und fertig ist die nächste Schlagzeile.
Man könnte fast meinen, die Nachrichten in Österreich seien wie Wiener Kaffeespezialitäten: dieselbe Bohne, nur anders serviert.
Red Bull und die Polka des Populismus
Die Rolle des Red Bull Media House darf nicht unerwähnt bleiben – oder wie ein Energydrink-Konzern zum zweitgrößten Medienunternehmen des Landes wurde. Mit „Servus TV“ hat sich Red Bull eine Bühne geschaffen, auf der rechtspopulistische Narrative und Heimatkitsch Hand in Hand tanzen. Selbst formate wie „The Pragmaticus“ schwingen das rhetorische Tanzbein zwischen Pseudointellektualismus und reaktionärer Pose.
Es ist ein Tanzstil, der polarisiert – und dennoch scheint er in vielen Wohnzimmern Anklang zu finden. Denn wo sonst könnte man den Spagat zwischen Almhüttenromantik und kulturkritischem Pathos so genüsslich zelebrieren?
Der finale Applaus – und wer wirklich zahlt
Am Ende bleibt der Geschmack eines zwiespältigen Abends. Während Raiffeisen, Kirche, Milliardäre und Boulevard-Barone die Melodien bestimmen, bleibt die Frage: Wer applaudiert eigentlich? Die Leser? Die Werbekunden? Oder ist es doch nur das Echo eines Steuersystems, das unfreiwillig den Taktstock schwingt?
Eines ist klar: Der Medienwalzer Österreichs ist kein Tanz für die Ewigkeit. Die Schritte sind alt, die Musik knistert vor Korruption, und die Tänzer wirken – bei näherem Hinsehen – reichlich ermüdet. Vielleicht ist es Zeit, die Musik zu wechseln.
Weiterführende Links:
- Profil: Artikel „Propaganda für Pensionisten“, Juni 2023.
- Chomsky, Noam: Die Konsensfabrik – Die politische Ökonomie der Massenmedien.
- Media-Analyse Österreich, diverse Jahrgänge.
- APA: Offizielle Webseite und Informationen zur Eigentümerstruktur.