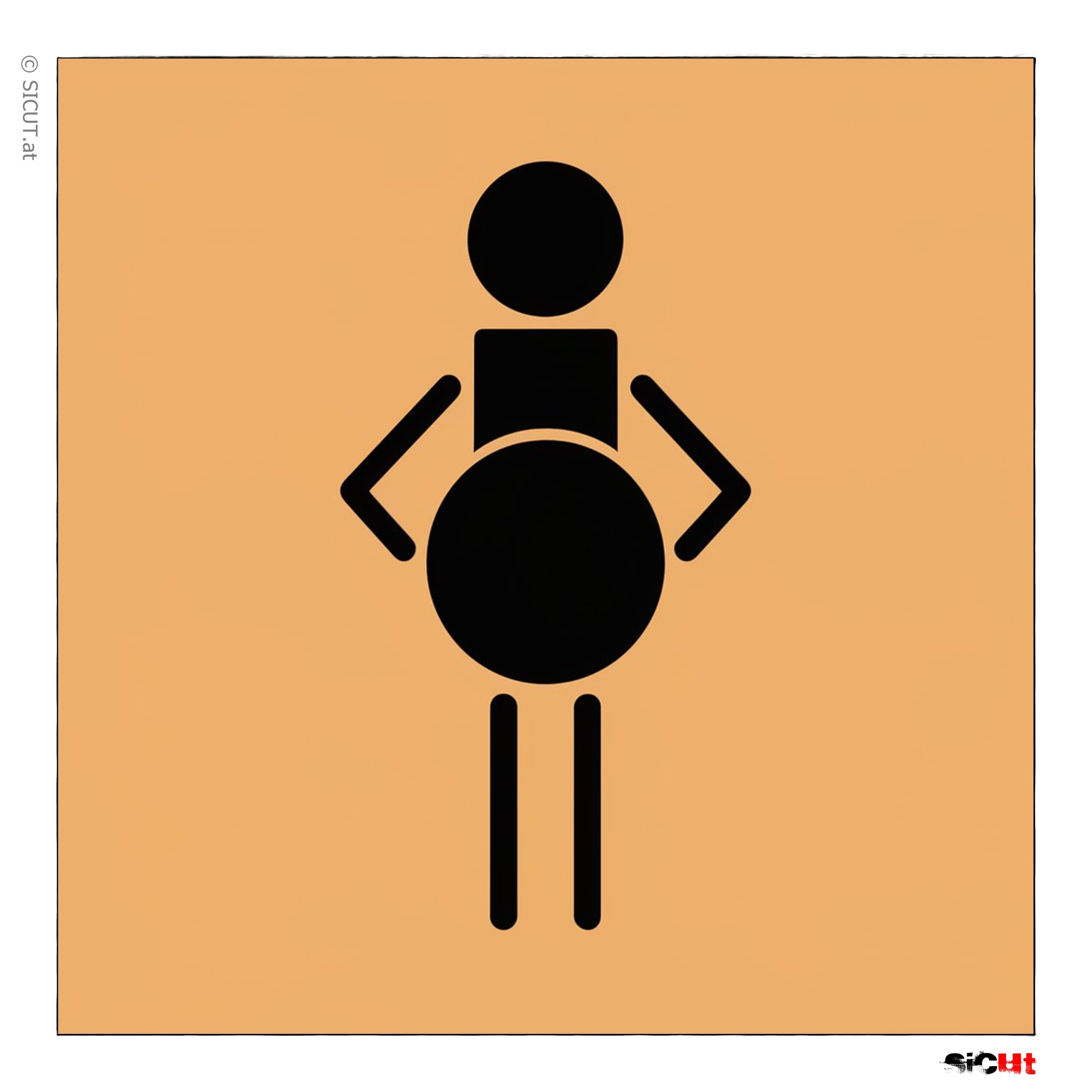Ein Kontinent rüstet auf: Waffen für den Frieden?
„Ja, das ist auch die Position des EU-Parlaments.“ Mit diesen simplen, aber hochbrisanten Worten hat EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in einer beiläufigen Bemerkung die europäische Außenpolitik in ein akustisches Trommelfeuer verwandelt. Das klingt wie ein enthusiastisches „Let’s do this!“ aus einer schlechten Actionserie, doch es geht hier nicht um den Dreh eines B-Movies, sondern um nichts weniger als den möglichen Einsatz westlicher Waffen gegen russische Ziele. Klingt nach Eskalation? Ist es auch.
Metsola spricht mit der Überzeugung einer Person, die entweder nicht weiß, was eine Explosion ist, oder der festen Überzeugung ist, dass Granaten – wenn sie nur die richtigen Leute treffen – Frieden stiften. Ein politischer Kurswechsel in Deutschland, deutet sie an, könnte bald Realität werden. Und warum nicht? Schließlich hat Deutschland seit 1945 sowieso viel zu wenig mit Panzern gespielt. Zeit, den Panzer-Generationen von gestern Tribut zu zollen. Jetzt geht’s los! Oder?
Opfer, Moralapostel und Waffenlobbyist in einem
Präsident Selenskyj – Europa nennt ihn mit ein bisschen zu viel Pathos einen „Widerstandskämpfer“ – steht dabei mit sorgsam justierter Empörung an vorderster Front. Zeitdruck, mahnt er. Menschenleben, appelliert er. Moralische Verantwortung, drängt er. Wer kann da schon nein sagen?
Seine Botschaft ist einfach: Ihr, die ihr eure Konflikte mittlerweile vorzugsweise in Talkshows und Twitter-Threads austragt, habt keine Ahnung, was ein echter Krieg ist. Deshalb: Mehr Waffen! Möglichst viele und möglichst schnell, damit der Krieg endlich endet – indem er eskaliert, natürlich. Der logische Widerspruch darin scheint niemandem wirklich aufzufallen. Es erinnert an den Satz: „Um den Brand zu löschen, werfen wir noch ein bisschen mehr Benzin ins Feuer.“
Demokratie oder Waffenhandel mit besserem PR-Team
Nun, die EU hat ihre Rolle als moralische Instanz immer sehr ernst genommen – solange sie nicht allzu unbequem wurde. Doch Metsola stellt klar: Verzögerungen, Wahlkämpfe, Uneinigkeiten – all das ist Luxus, den sich der Kontinent nicht leisten könne. Und mit dieser Aussage setzt sie einen Maßstab, der den Begriff „Demokratie“ leise im Hintergrund kichern lässt.
Es ist bemerkenswert, wie schnell aus mühsam errungenen moralischen Standards ein ideologischer Waffenschrank wird. Man könnte meinen, Europa hätte gelernt, dass Waffenlieferungen selten eine endgültige Lösung sind. Stattdessen verhält man sich wie ein frustrierter Spieler, der mit jeder Runde des Konflikts mehr Chips in den Pot wirft, in der Hoffnung, irgendwann doch den Jackpot zu knacken.
Vom Pazifismus zur Rüstung in Rekordzeit
Deutschland, das seit Jahrzehnten stolz darauf war, sich lieber auf Autos als auf Panzer zu spezialisieren, gerät nun ins Visier der Kritik. Eine Kursänderung in der Waffenfrage scheint laut Metsola unvermeidlich. Die Regierungskoalition sei uneins, aber wer glaubt schon, dass sich Uneinigkeit langfristig gegen geopolitischen Druck behaupten kann? Selbst Olaf Scholz, der Meister des politischen Zögerns, dürfte irgendwann in die Ecke gedrängt werden. Wahrscheinlich von Annalena Baerbock, die schon lange darauf wartet, ihren inneren Falken auszuleben.
Der Pazifismus, so scheint es, ist in Deutschland nur noch eine hübsche Erinnerung. Oder wie es ein Satiriker ausdrückte: „Wir liefern keine Waffen, wir liefern Freiheit!“ Man könnte fast glauben, die Deutschen hätten beschlossen, sich an ihrem alten Slogan „Geiz ist geil“ zu orientieren – allerdings mit dem Zusatz „Geiz ist geil, aber Waffen sind besser.“
Die einzige Strategie, die bleibt
Und was ist mit der Eskalationsspirale, fragt der geneigte Realist? Was, wenn mehr Waffen nicht zu mehr Frieden, sondern zu mehr Krieg führen? Ah, aber das sind nur die Sorgen von Pessimisten. Wer braucht schon eine realistische Einschätzung, wenn man die glänzenden Visionen eines geeinten, waffenstarrenden Europas haben kann?
Es ist die Logik eines Kindes, das nicht versteht, warum man eine Sandburg nicht mit einer Abrissbirne rettet. Oder eines Politikers, der davon ausgeht, dass Gewalt das universelle Esperanto der Diplomatie ist.
Die Farce geht weiter
Die eigentliche Tragödie in all dem ist jedoch nicht nur die moralische Heuchelei oder die geopolitische Kurzsichtigkeit. Es ist die erschreckende Banalität, mit der über Krieg entschieden wird. Als wäre es ein Politikfeld wie jedes andere. Als könnte man Eskalation durch Waffenlieferungen in denselben Kategorien diskutieren wie Subventionen für Landwirtschaft.
Metsola und Co. tun, was Politiker immer tun: Sie geben vor, die Kontrolle zu haben, während sie hoffen, dass der Zug, den sie angestoßen haben, nicht aus den Gleisen springt. Und wir, die Beobachter, schauen zu, wie ein weiterer Konflikt aus den Fugen gerät, während wir in Echtzeit debattieren, wer schuld ist.
Quellen und weiterführende Links:
- „Metsola: EU-Parlament positioniert sich zur Ukraine-Unterstützung“ – Bericht im EU Observer.
- „Kurswechsel in der deutschen Waffenpolitik?“ – Analyse der Süddeutschen Zeitung.
- „Selenskyj fordert mehr Unterstützung aus Europa“ – Artikel der BBC.
- Historische Parallelen zu Waffenlieferungen und Eskalationen – Studie des SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
- Politische Analysen zu deutschen Waffenexporten – Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).