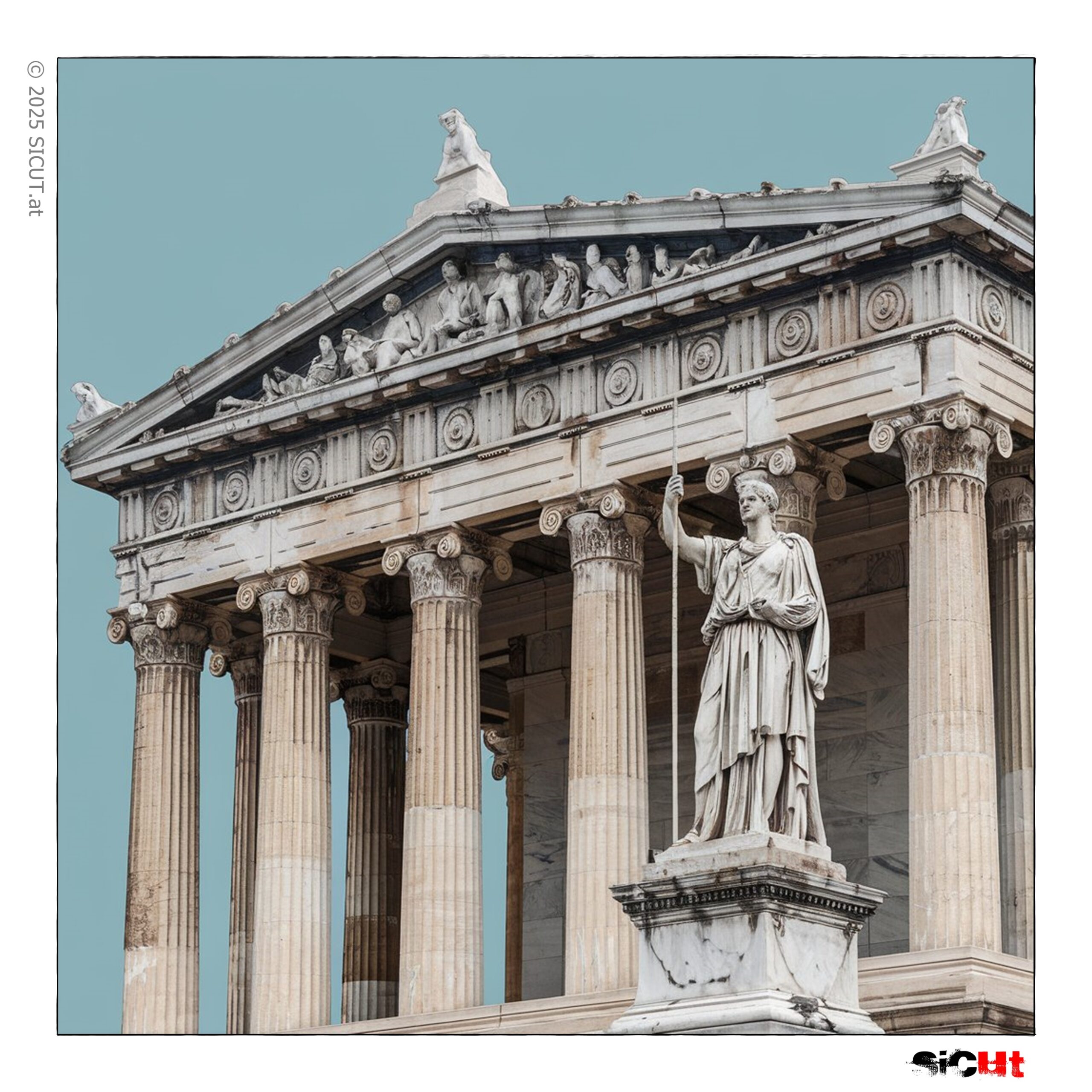Krieg ist Frieden, Rüstung ist Abrüstung, und Orwell dreht sich im Grab
Manchmal ist Sprache ein zauberhaftes Mittel, um selbst die härtesten Realitäten weichzuspülen, wie ein sanftes Lavendelbad nach einem Tag im Schützengraben. So auch diesmal: Die EU-Kommission hat beschlossen, ihren martialischen „Plan zur Wiederaufrüstung Europas“ („ReArm Europe“) in das wohlklingende „Readiness 2030“ umzubenennen. Denn wir wissen ja alle: Wenn eine Massenmobilisierung nach mehr Waffen, größeren Budgets und stärkerer Militarisierung schreit, dann liegt das eigentliche Problem nicht in den Kanonen, sondern in der Wortwahl. Schließlich ist es ungleich angenehmer, sich auf eine schöne, runde Jahreszahl vorzubereiten als auf eine Schlacht.
Die Brüsseler Nachrichtenagentur des gesunden Menschenverstands, auch EU-Kommission genannt, weiß: Der europäische Bürger ist sensibel. Nicht etwa, wenn es darum geht, Milliarden in die Verteidigungsindustrie zu pumpen, während Krankenhäuser nach Personal betteln oder die Inflation die Renten auffrisst – nein, das würde ja eine gewisse Reflexion und vielleicht sogar Proteste hervorrufen. Viel schlimmer wäre es, wenn sich jemand beleidigt fühlt! Also wird schnell der Namensgenerator angeworfen, und heraus kommt: „Readiness 2030“. Klingt wie ein EU-Förderprogramm für digitale Bildung, ist aber der Plan, wie Europa sich bis zum Ende des Jahrzehnts strategisch für seine Rolle als Bollwerk der Demokratie rüstet – und sei es nur auf dem Papier.
Ein Planspiel mit realen Konsequenzen
Doch was genau bedeutet „Readiness 2030“? Geht es darum, den Bürgern schonend beizubringen, dass Frieden etwas für Nostalgiker ist? Oder darum, eine Generation darauf vorzubereiten, dass ihre berufliche Zukunft nicht im Homeoffice, sondern im Schützengraben liegt? Zum Glück hat die Kommissionssprecherin Paula Pinho bereits klargestellt, dass man nicht nur zuhören, sondern auch in der Kommunikation darauf eingehen werde. Welch ein Glück! Kommunikation ist in der EU schließlich das A und O – besonders, wenn es darum geht, Dinge schönzureden.
Währenddessen beobachten europäische Waffenhersteller die Entwicklungen mit feuchten Augen. Seit Jahren warnen sie davor, dass das Verteidigungsbudget nicht ausreicht, um Europa „sicher“ zu machen – also in einen Zustand zu versetzen, in dem jedes Land mindestens zwei Panzer pro Einwohner sein Eigen nennt. Endlich hat man in Brüssel begriffen, dass das einzig Wahre gegen Unsicherheit ein dickes Arsenal ist. Niemand fühlt sich sicherer als jemand, der ein Haus voller Sprengstoff hat, oder?
Von Empfindlichkeiten und Empfindungslosigkeit
Dass besonders in Spanien und Italien gewisse „Empfindlichkeiten“ gegenüber dem Begriff „Wiederaufrüstung“ bestehen, ist ein nettes Detail, das zwischen all den Nebelkerzen fast untergeht. Was mag der Grund sein? Die Erinnerung an vergangene Diktaturen? Die bittere Erfahrung, dass das Befeuern von Kriegslogik selten zu dauerhaftem Frieden führt? Oder schlicht die banale Tatsache, dass „Wiederaufrüstung“ sich ungemütlich nach den Zeiten anhört, in denen Europas Staaten ihre Bevölkerungen mit patriotischem Furor in den Abgrund schickten?
Doch keine Sorge: Diese Empfindlichkeiten werden respektiert. Man wird niemanden mehr damit behelligen, was hinter „Readiness 2030“ wirklich steckt. Die Aufrüstung passiert so oder so – aber sie kommt in einem weichgewaschenen, PR-getunten Gewand daher, das jedem Anflug von Besorgnis die Spitze nimmt. „Seid bereit!“, ruft die EU. Aber bitte ohne Panik, ohne Protest und vor allem ohne die Illusion, dass es Alternativen gibt.
Das Ende der Unschuld – und das Ende der Illusionen
Vielleicht sollten wir nicht so naiv sein. Vielleicht ist es in einer Welt, in der die Geopolitik sich wie eine dystopische Netflix-Serie entfaltet, nur logisch, dass Europa seine Verteidigung ausbaut. Vielleicht ist „Readiness 2030“ einfach der Name eines unvermeidlichen Kapitels in unserer Geschichte. Aber wäre es nicht ehrlicher, das auch so zu sagen? Wäre es nicht an der Zeit, einmal nicht die Sprachakrobaten ans Mikrofon zu lassen, sondern jene, die den Mut hätten, offen zuzugeben: „Ja, wir rüsten auf. Ja, das kostet. Ja, das ist ein Bruch mit der europäischen Friedensrhetorik der letzten Jahrzehnte“?
Doch stattdessen haben wir „Readiness 2030“. Einen Namen, der sich anhört wie ein Businessplan für eine agile Softwarelösung, und eine Politik, die von der Geschichte nur eines gelernt hat: dass sich schlechte Nachrichten am besten mit Marketing verpacken lassen.
Also, Europa, sei bereit – aber vor allem, sei still.