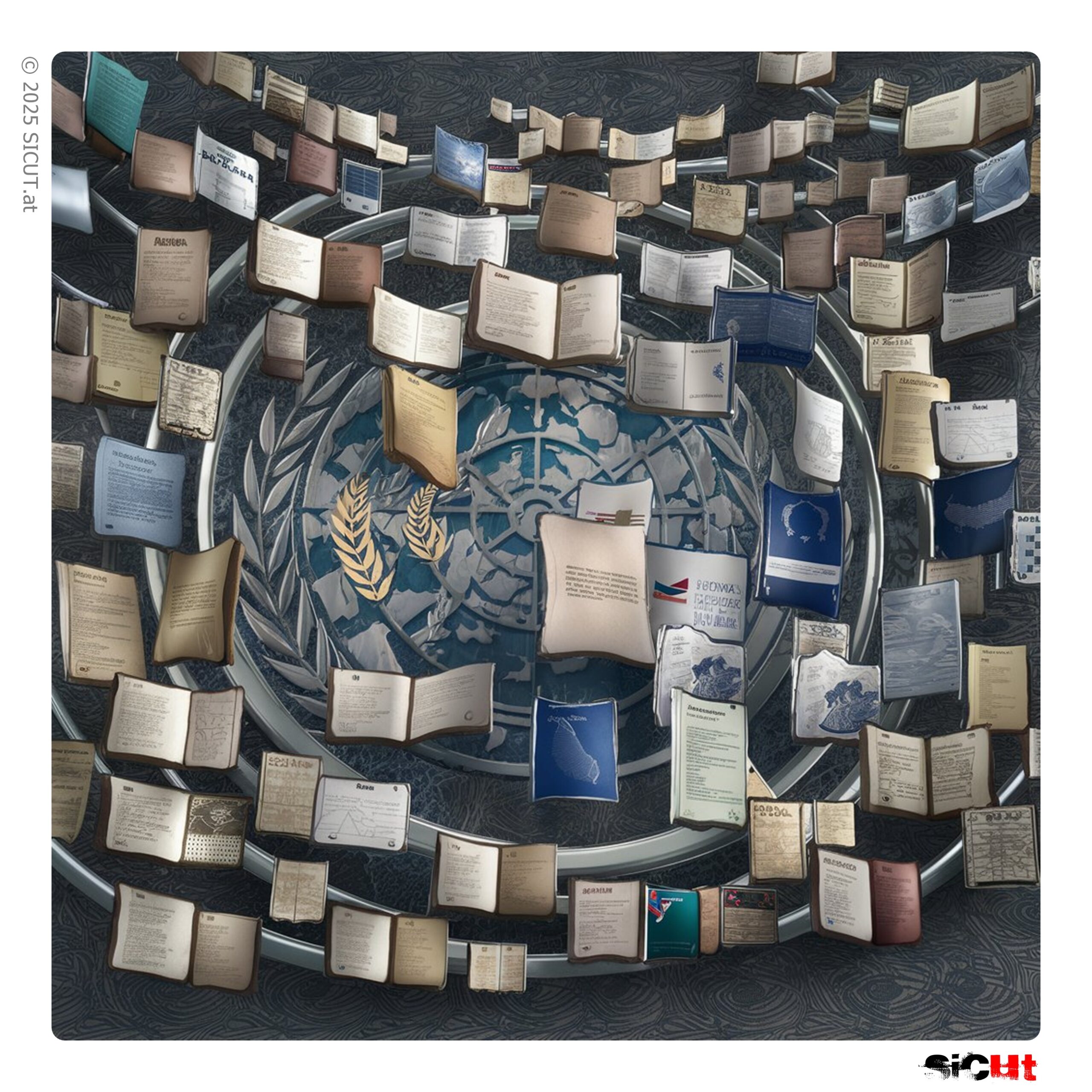Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) ist ein fragwürdiges Instrument. Kritiker:innen weisen immer wieder darauf hin, dass sie keineswegs ein exaktes Bild der Kriminalitätsrealität zeichnet, sondern vielmehr eine verzerrte, verzagte, voreingenommene Momentaufnahme bietet. Besonders auffällig ist dies bei der Frage der sogenannten „Überrepräsentation“ von Ausländer:innen in nahezu allen Deliktsgruppen. Ein alarmierender Umstand? Mitnichten! Denn ein solches Bild entsteht erst durch unzureichende „Bereinigungen“.
Die große Bereinigung
Bevor man übereilte Schlüsse zieht, gilt es, die Daten in einen gerechten, sozialverträglichen Kontext zu stellen. Denn Kriminalität ist keineswegs einfach ein individuelles Fehlverhalten, sondern vielmehr Ausdruck struktureller Bedingungen, gesellschaftlicher Zwänge und natürlich der berüchtigten „verfälschenden Einflüsse“, die wir nun sorgfältig entwirren wollen.
Der heimliche Faktor: Dunkelziffern
Beginnen wir mit der Dunkelziffer, jenem dunklen Fleck auf der Landkarte der Kriminalität, den niemand genau kennt, der aber dennoch zuverlässig als Argument herhalten kann. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass Deutsche seltener angezeigt werden als Nichtdeutsche. Wer also in der PKS erfasst wird, ist nicht etwa ein Spiegel der Realität, sondern lediglich ein Spiegel der Anzeigegewohnheiten. Die wahren Täter:innen bleiben verborgen, gutbürgerlich abgeschirmt in den eigenen vier Wänden, während auf der Straße das Unrecht öffentlich sichtbar gemacht wird.
Anzeigenbereitschaft: Ein bedauerlicher Bias
Die Bereitschaft, eine Straftat anzuzeigen, ist kulturell geprägt und gesellschaftlich konditioniert. In einer durch subtile Xenophobie geprägten Gesellschaft wie der unsrigen zeigt man gerne mit dem Finger auf das vermeintlich „Fremde“. Folglich werden Straftaten von Nichtdeutschen überproportional gemeldet, während der Herr Müller von nebenan für seine kleinen Eskapaden großzügig übersehen wird.
Freisprüche – der unsichtbare Beweis der Unschuld
Nicht zu vergessen ist die höhere Freispruchquote bei ausländischen Tatverdächtigen. Man könnte meinen, dies wäre ein Beweis für ihre Unschuld – doch auch hier ist es komplizierter. Denn wenn jemand erst einmal als Verdächtiger registriert wurde, dann bleibt dieser Verdacht in der Statistik bestehen, selbst wenn sich später herausstellt, dass es sich um ein Missverständnis oder ein rassistisch motiviertes Fehlurteil handelt.
Die Mär vom „Ausländerrecht“
Ein beliebter Einwand: „Aber das Ausländerrecht ist doch bereits herausgerechnet!“ Tatsächlich wird es in der PKS gesondert erfasst. Doch hier liegt die Crux: Das Ausländerrecht ist nicht etwa eine unabhängige rechtliche Instanz, sondern vielmehr ein perfides Instrument, das Menschen für Dinge kriminalisiert, die für Deutsche vollkommen legal wären. Der Aufenthaltstitel, die Arbeitserlaubnis, die Meldepflicht – wer sich hier einen Fehltritt leistet, gerät sofort in die Mühlen der Statistik.
Gewalttourismus: Die unterschätzte Gefahr
Wenig bekannt, aber unbestreitbar: Tourist:innen begehen Verbrechen. Wer einmal nachts durch eine Altstadt nach einem Fußballspiel geschlendert ist, weiß: Aggressive Reisegruppen sind eine ernsthafte Bedrohung. Und doch werden sie einfach unter „Ausländer“ subsumiert, obwohl sie morgen schon wieder ganz woanders randalieren.
Reisende Täter – ein unangenehmes Detail
In Zeiten der Globalisierung sind Straftäter:innen mobil. Sie agieren international, doch ihre Herkunft wird nicht benannt – aus gutem Grund, denn eine solche Offenlegung könnte einseitige Assoziationen hervorrufen. Schließlich sind Kriminelle nicht per se böse, sondern oft nur von Not und Elend getriebene Akteur:innen.
Sozialstrukturelle Faktoren: Kriminalität als Notwehr
Armut, geringe Bildung, Gewaltopfererfahrung, Fluchttraumata – all dies sind soziale Umstände, die Kriminalität nicht nur erklären, sondern in einem gewissen Maße auch legitimieren. Wer sich in einer Umgebung voller Gewalt befindet, passt sich an. Wer unterdrückt wird, muss sich wehren. Wer nichts hat, muss sich nehmen. Kurz: Kriminalität ist nicht die Ursache, sondern das Symptom einer tief gespaltenen Gesellschaft.
Polizeipräsenz – eine Frage der Perspektive
Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben: Dort, wo die Polizei häufiger patrouilliert, werden auch mehr Straftaten registriert. Dass dies besonders in Gegenden mit einem hohen Anteil an Migrant:innen der Fall ist, lässt sich nur auf eines zurückführen: latenten Rassismus. Denn wer kontrolliert wird, wird auch leichter überführt – ein trauriger, aber unvermeidlicher Bias der Strafverfolgung.
Männer als statistischer Trick
Bleibt noch die letzte Bastion der Statistik: die Männerquote. Ja, Männer sind generell krimineller als Frauen. Doch wer sind „die Männer“? In der PKS werden Deutsche und Nichtdeutsche in ihrer Männlichkeit nicht gleich betrachtet. Während der deutsche Mann ein sanfter Romantiker ist, bleibt der ausländische Mann eine latent bedrohliche Gestalt – so will es zumindest das verzerrte Bild der Statistik.
Das Fazit: Die große Gleichheit
Bereinigt man die Daten um all diese Aspekte, zeigt sich eindeutig: Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen der Kriminalität von Deutschen und Nichtdeutschen. Ein statistischer Mythos, ein verzerrtes Bild, ein Konstrukt, das vor allem eines tut: spalten, statt aufzuklären. Lassen wir uns davon nicht täuschen!