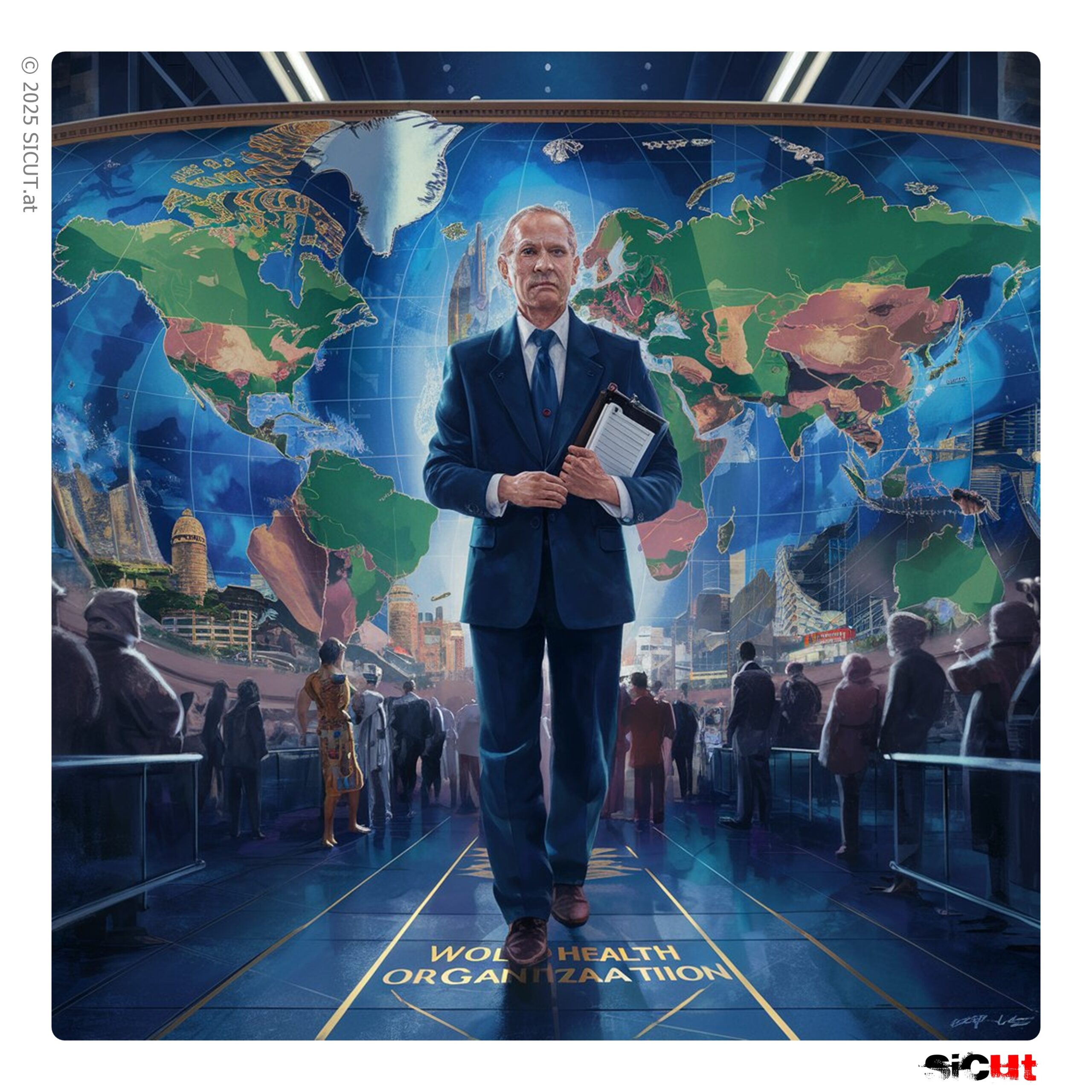Es ist eine der seltsamen Konstanten in einer Zeit, die sich für besonders aufgeklärt hält: Die Moral ist wieder in Mode, aber diesmal trägt sie Funktionskleidung und filtert ihre Werte durch eine ideologische App. Die Welt ist komplex – ja, sogar grausam –, doch das stört den westlichen Moralhaushalt nicht im Geringsten. Man urteilt trotzdem. Schnell. Empört. Und mit der Wucht einer moralischen Guillotine, bei der selbst Robespierre vor Neid in den Revolutionshimmel schauen würde.
Und da stehen wir nun, mit blutrotem Blick auf den Gazastreifen, auf Israel, auf all das, was nicht in 280 Zeichen passt. Die Fakten? Zweitrangig. Die Zusammenhänge? Zu kompliziert. Die Geschichte? Stört nur die Erzählung. Und so hallt es durchs deutsche Feuilleton, durch Fernsehstudios, Straßen und studentische AStA-Büros: „Was Israel tut, ist unverhältnismäßig!“, „Die Palästinenser leiden!“, „Man muss die andere Seite sehen!“
Natürlich. Man muss. Man soll. Man darf. Aber eines fällt auf: Während in Nazi-Deutschland, in einem der durchindustrialisiertesten Vernichtungsregime der Menschheitsgeschichte, vereinzelt Deutsche ihre Menschlichkeit bewahrten, Juden versteckten, retteten, riskierten – in Gaza, nach dem 7. Oktober, nach dem Massaker, nach der Vergewaltigung, nach dem Kindermord, hat kein einziger der 2,3 Millionen Bewohner auch nur eine Geisel versteckt, beschützt, gerettet.
Nicht eine.
Und man fragt sich: Was passiert da eigentlich, wenn die moralische Buchhaltung so stumm bleibt bei dieser Bilanz?
Die neue Linke – universell solidarisch, aber nur wenn’s ins Weltbild passt
Es gehört zu den bittersten Ironien unserer Zeit, dass ausgerechnet jene, die einst gegen Totalitarismus, Gewalt und Unrecht kämpften, heute ihre rote Fahne über dem Tunnel der Relativierung hissen. Antikolonialismus, Antiimperialismus, Antizionismus – es klingt so schön rhythmisch, so wissenschaftlich. Und es ist so bequem. Denn wer Israel als „Kolonialmacht“ imaginiert, kann auf Menschenrechtsrhetorik reiten, ohne sich die Hände mit Fakten zu beschmutzen.
Dass in Gaza kein Jude lebt – seit Jahren nicht. Dass Israel sich zurückgezogen hat, dass es Wahlen gab, dass man sich für Hamas entschied wie andere für Popcorn – das alles ist egal. Hauptsache, der Klassenkampf gegen den Westen bleibt aufrecht.
Aber was ist das eigentlich für eine Revolution, die keinen Einzigen findet, der eine Geisel versteckt? Keine alte Frau mit Gewissensbiss. Kein Lehrer. Keine Ärztin. Kein Imam, der sagt: „Nicht in meinem Haus, nicht in Allahs Namen.“
Nein, es wird geschwiegen. Oder schlimmer: gefeiert. Paraden, Konfetti, Süßigkeiten für die Kinder, weil der Feind geschändet wurde. Das ist kein Widerstand – das ist Barbarei auf Instagram.
Das Märchen vom Schweigen der Mehrheit
Es gibt eine Phrase, die wie ein Mantra wiederholt wird, jedes Mal, wenn ein islamistisches Massaker durch die Medien spült: „Die Mehrheit der Muslime hat damit nichts zu tun.“ Oder, im aktuellen Fall: „Nicht alle Gazaner sind Hamas!“
Gewiss. So wenig wie alle Deutschen Nazis waren. Und doch… und doch gab es da Sophie Scholl. Hans Scholl. Menschen, die bei Strafe des Todes Flugblätter verteilten, Juden versteckten, Funksprüche abfingen, aus Fenstern warfen. Wer war der Sophie Scholl von Gaza? Wo ist der Hans Scholl von Khan Yunis?
Ein Tweet, ein anonymer Hinweis, ein YouTube-Video, das ein Kinderschicksal rettet. Nichts. Stattdessen: Schweigen. Feigheit? Vielleicht. Zustimmung? Wahrscheinlicher. Kollaboration? Wahrscheinlich. Und doch wird diese Feststellung nicht geduldet. Sie ist, so sagt man, „rassistisch“.
Was für eine Farce. Wenn es rassistisch ist, ein moralisches Verhalten zu erwarten, dann ist der Rassismus zur Tugend geworden – und wir sind seine ergebenen Schüler.
Die neue Arithmetik der Schuld
Früher war Moral einfach: Gut war, wer half. Böse, wer schädigte. Heute ist Gut, wer ein Narrativ hat. Und Böse, wer darauf besteht, dass Moral universell sein sollte.
Die neue Rechnung geht so:
- Wenn Israel Bomben wirft, sind alle Opfer Opfer.
- Wenn Hamas Menschen abschlachtet, sind die Täter… ein Missverständnis.
Es ist eine moralische Mathematik, in der Null geteilt durch Null das Ergebnis „Kolonialgeschichte“ ergibt. Eine Logik, die jedes westliche Verbrechen bis zum heutigen Tag verlängert, aber östliche, südliche, islamistische Gewalt als „reaktiv“ entschuldigt.
Es ist das akademische Stockholm-Syndrom, bei dem sich die Geisel in den Täter verliebt, weil der so eindrucksvolle Postkolonialseminare halten könnte.
Der Luxus der Empathie – ein westliches Überbleibsel
Empathie ist in unserer Zeit keine Selbstverständlichkeit mehr – sie ist ein westliches Luxusgut, wie Bio-Kaffee oder Genderseminare. Man verteilt sie dosiert, kuratiert, entlang politischer Routen. Wer die falschen Opfer beweint, ist verdächtig. Wer die richtigen Täter benennt, ist raus.
Und so empören wir uns kollektiv – über Israels Selbstverteidigung, über Bilder von Trümmern, über Raketenabwehrsysteme, die das Falsche schützen. Aber über das Offensichtliche, das Unleugbare, das, was uns eigentlich ins Mark treffen müsste – das völlige Fehlen jedweder moralischer Regung bei einem millionenstarken Kollektiv nach einem Massaker – darüber schweigen wir. Denn es ist unbequem. Es zerstört das Narrativ.
Der Zynismus der guten Menschen
Man sagt oft: Satire darf alles. Und man meint damit meist, dass Satire verletzen darf. Aber wahre Satire will nicht verletzen – sie will entlarven. Die Maske herunterreißen, den Spiegel so fest ins Gesicht pressen, dass sich niemand mehr herausreden kann.
Und hier stehen wir, mit all unserer Aufgeklärtheit, unserem Humanismus, unserem politischen Feingefühl – und lassen zu, dass das Offensichtliche ignoriert wird, weil es uns nicht ins Weltbild passt.
Es ist nicht zynisch, zu sagen, dass kein einziger Gazaner eine Geisel gerettet hat.
Zynisch ist, das zu wissen – und es trotzdem nicht zu sagen.