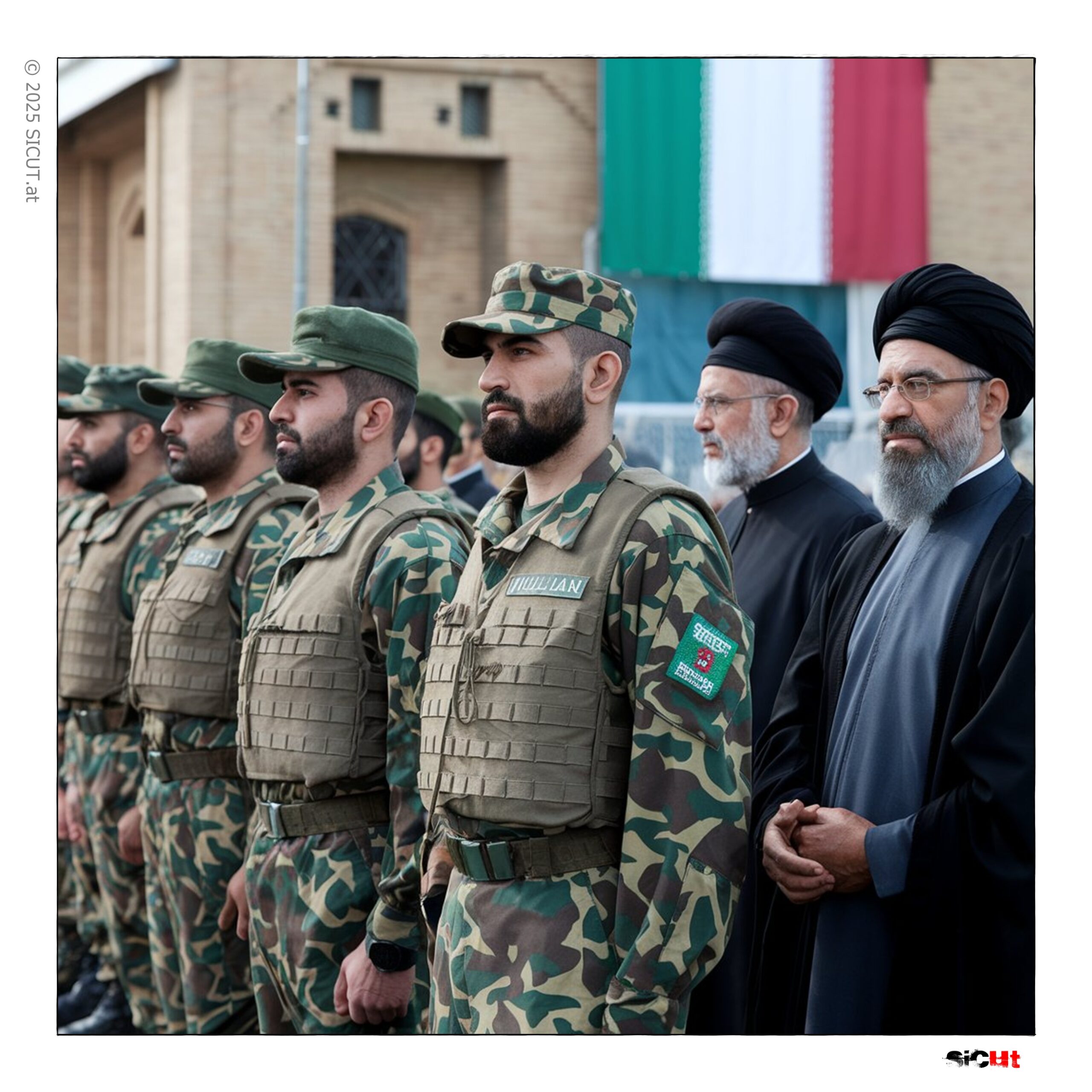… und dazwischen liegt die Wahrheit im Massengrab
Die Weltgeschichte liebt Wiederholungen, vorzugsweise in der grausameren, lächerlicheren, schlechter inszenierten Version. Wir schreiben das Jahr 2025, aber eigentlich könnte es auch 1916, 1942 oder 2003 sein – nur dass diesmal TikTok mitfilmt. Während Europa brav den Scheck ausstellt und Amerika gewohnt zuverlässig den Raketenwerfer liefert, dreht sich das große Hamsterrad der geopolitischen Moritat weiter. Das Drehbuch ist bekannt, die Rollen sind verteilt, und wie immer sind es die unteren Chargen, die das große Finale mit ihrem Blut bezahlen.
Die Europäer, diese alternden Exportweltmeister mit moralischem Zuckerguss, überweisen Milliarden in die Ukraine, als ob der Krieg ein besonders scharf gewürzter Netflix-Account wäre, den man für den Weltfrieden abonnieren muss. Die Amerikaner hingegen, pragmatisch wie immer, schicken das, was sie am besten können: Waffen. Viele Waffen. Mehr Waffen als nötig wären, wenn es jemals um Frieden ginge – aber wer redet noch von Frieden? Der hat in den Talks von Davos oder den Rüstungs-Messen in Abu Dhabi sowieso Hausverbot.
Die Ukro-Betrugsmasche: Kriegswirtschaft als Ponzi-Schema
Man nennt es Hilfe, aber es ist ein perfider Etikettenschwindel. Die Oligarchen, pardon: die „Führungsschicht“ in Kiew, scheffeln sich goldene Keller voll Dollars und Euros, während im Donbas weiter gestorben wird. Der Westen klatscht artig, liefert weiter Panzer und Patronen, schiebt Geld über die Grenze, das unterwegs auf wundersame Weise in Villen am Genfer See und auf Konten in Zypern verschwindet.
Es ist ein gigantisches Umverteilungsprogramm von unten nach oben, von den Steuerzahlern zu den Kriegsgewinnlern. Nur nennt es niemand beim Namen. Lieber versteckt man den Skandal hinter blau-gelben Flaggen-Emojis und moralisierender Rhetorik. Das nennt man heute Wertepolitik. Früher hätte man es organisierten Betrug genannt.
Sterben für die Rüstungsaktienkurse
Die Armen kämpfen, die Reichen zählen das Geld, oder wie es Rosa Luxemburg formulierte: „Die Dividenden steigen, und die Proletarier fallen“. Das ist keine Neuigkeit, das ist der Naturzustand des Kapitalismus im Krieg. Man könnte es zynisch nennen – wäre es nicht einfach nur die logische Fortsetzung der Wirtschaftsordnung, die wir uns eingerichtet haben.
Während Lockheed Martin, Rheinmetall und Co. Kursgewinne feiern, fliegen an der Front die Körperteile durch die Luft. Der Westen nennt das „Verteidigung der Freiheit“. Der Osten nennt es „militärisch-technische Operation“. Die Wahrheit ist: Es ist Geschäft. Und wo Geschäft gemacht wird, stirbt die Moral zuerst. Danach der Mensch.
Die Russen rücken auf, der Westen rückt Papiersoldaten nach
Während in Brüssel noch über die nächste Tranche nachgedacht wird, machen russische Truppen im Osten langsam, beharrlich Geländegewinne. Die Ukraine ist inzwischen ein Dauerprojekt wie der Berliner Flughafen – nur mit mehr Leichenbergen.
Man redet von Offensiven, von Durchbrüchen, von strategischen Umgruppierungen – und meint in Wirklichkeit Rückzüge, Erschöpfung und das schleichende Eingeständnis, dass die „regelbasierte Weltordnung“ an den Schützengräben verblutet. Aber niemand gibt das zu. Stattdessen verlängert man den Krieg wie eine schlechte Fernsehserie, die längst keinen Handlungsbogen mehr hat, nur noch immer neue Staffeln mit höheren Einschaltquoten für CNN und Fox News.
Die unausweichliche Katastrophe
Wie wird das enden? Natürlich hässlich. Es gibt keinen eleganten Ausgang aus einer Farce, die längst zur Tragödie geworden ist. Entweder wird die Ukraine weiter zerschlissen, bis nur noch ein Protektorat übrig bleibt, verwaltet von den Restbeständen der CIA, der BlackRock-Gruppe und den üblichen korrupten Lokalgrößen. Oder der Krieg eskaliert noch weiter, schwappt über in neue Regionen, bis irgendwann jemand in Washington oder Moskau den falschen Knopf drückt – aus Versehen oder aus Berechnung, was am Ende keinen Unterschied macht.
Das Narrativ vom „langen Krieg“ ist bereits Mainstream: Ein Krieg, der nicht gewonnen, sondern verwaltet wird. Ein Krieg als Dauerzustand. Als Geschäftsmodell. Als Polit-Ersatzprogramm für gescheiterte Eliten, die zuhause nichts mehr geregelt kriegen, aber wenigstens auf dem Globus die Muskeln spielen lassen dürfen.
Und wir? Wir zahlen die Rechnung
Am Ende bleibt die bittere Wahrheit: Wir alle bezahlen das – mit unseren Steuergeldern, mit der geopolitischen Destabilisierung, mit den nächsten Flüchtlingswellen, mit der Inflation, mit der Verrohung der politischen Kultur. Während der einfache Ukrainer und der einfache Russe in den Schützengräben erfrieren oder verbrennen, streiten sich westliche Think Tanks um Fußnoten in ihren Papers über „sinnvolle Eskalation“.
Aber trösten wir uns: Die nächsten Friedenspreise sind schon vergeben, die Talkshow-Sessel sind warm, die Journalisten haben ihre Schlagzeilen. Und irgendwo in einem Penthouse in Kiew, Zürich oder Washington wird gerade angestoßen – auf die nächste Waffenlieferung.
Prost.