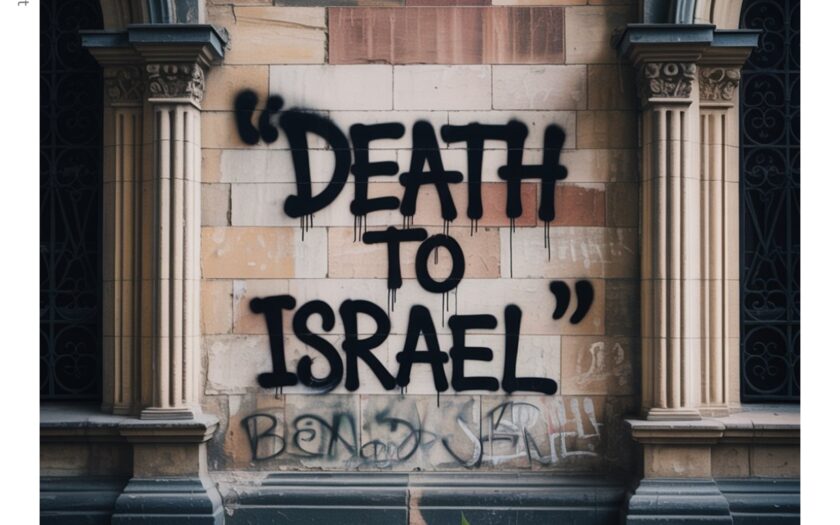Es gibt Völker, die sterben aus, und dann gibt es das palästinensische Volk – das einzige, das es schafft, sich trotz angeblichem Genozid derart fröhlich zu vermehren, als wolle es der Welt demonstrieren: „Sterben? Nicht mit uns!“ Von zwei Millionen 1990 auf über fünf Millionen 2024 – eine biologische Bankrotterklärung an jede Logik der Demografie. Andere Völker sterben aus, Palästinenser vermehren sich, als gäbe es kein Morgen. Ein Volk, das sich selbst am Leben erhält durch eine nie versiegende Quelle von Nachwuchs – und nebenbei den Flüchtlingsstatus zum ererbbaren Familienvermögen macht. Ein Status, der nicht etwa abgeschafft, sondern wie ein antikes Relikt in die Generationen weitergereicht wird, damit jeder Nachfahre das Privileg genießt, ein lebenslanger „Flüchtling“ zu sein. Wie schön, wenn Elend vererbbar wird – das nennt man dann wohl den sozialen Adelstitel der Misere.
Arafat – Der clevere Erfinder eines Volkes, das es erst werden musste
Was für ein genialer Coup: Aus einem heterogenen Gemisch von Bewohnern eines britischen Mandatsgebiets eine „Nation“ zu konstruieren, die mehr politisches Konstrukt als ethnische Realität ist. Yassir Arafat, der große Zauberer des Nahosttheaters, schuf nicht nur eine Identität, sondern auch eine grandiose Ausrede für einen dauerhaften Konflikt. Ein Volk, erfunden wie ein Marvel-Superheld, mit tragischer Hintergrundgeschichte, die sich aber wie ein Franchise weltweit verkaufen lässt. Der Clou: Ein Volk, das überall heimisch und doch nirgendwo willkommen ist – die perfekte Mischung aus Opferrolle und politischem Druckmittel. Nur die arabischen Brüder schauen mit Verachtung oder genervter Gleichgültigkeit zu, als hätten sie ein ungebetenen Gast, der nie wieder gehen will.
Brüderliche Ablehnung: Die traurige Palästinenserfreundschaft
Doch so sehr die Palästinenser sich auch als Einheit und Opfer präsentieren, in der Welt der arabischen Brüder gelten sie oft als ungeliebte, ja sogar ungeliebteste Verwandtschaft. Jordanien, das Land, das einmal die palästinensische Frage „gelöst“ zu haben schien, erinnert sich mit schaudern an den Schwarzen September 1970 – ein brutaler Bürgerkrieg, bei dem die jordanische Armee die palästinensischen Kämpfer gnadenlos aus Amman und Umgebung vertrieb. Das Bruderliebe nicht in jeder Sprache gleich klingt, zeigte sich hier mit brutalster Deutlichkeit.
Der Libanon, ebenfalls ein Pulverfass, zerbrach in den 1970er und 80er Jahren fast unter der Last seiner palästinensischen „Gäste“. Die palästinensischen Milizen wurden zu einer destabilisierenden Kraft, die jahrelang Bürgerkrieg und Chaos nährte. Und Kuwait? Dort begrüßten die Palästinenser Saddam Hussein während des Golfkriegs mit offenen Armen, was nicht nur den Zorn der alliierten Mächte, sondern auch der eigenen arabischen Geschwister provozierte – und zu einer Massen-Ausweisung führte. Die Palästinenser waren hier nicht die Opfer, sondern die ungeliebten Komplizen in einem Spiel, das sie nur verlieren konnten. Warum? Vielleicht, weil man im arabischen Raum eine ganz spezielle Art von „Bruderschaft“ kennt – eine, die mancherorts bei kleinsten Abweichungen in Feindschaft umschlägt.
Flüchtlingsstatus als dynastisches Erbe – Der bizarrste Sozialvertrag der Welt
Hier ein Flüchtlingsstatus, der nicht endet, sondern vererbt wird – wie ein aus der Mode gekommenes Familienerbstück oder eine schrullige Briefmarkensammlung. Niemand sonst auf diesem Planeten stellt sicher, dass der „Flüchtlings-Status“ quasi automatisch von Vater zu Sohn weitergegeben wird. Eine lebenslange Sozialversicherung auf Kosten der Weltgemeinschaft, die man nicht kündigen kann, weil das System selbst darauf gebaut ist, in ewiger Dauerexistenz zu funktionieren. Elend als Wirtschaftszweig und politische Währung, die keiner abschaffen will – zu nützlich ist der Mythos für allerlei Agenda-Manager und Menschenrechtsapostel. Generationen sitzen fest im Sumpf des staatenlosen Wartens, während ihre Anzahl so beständig wächst wie das Unglück selbst.
Bevölkerungsexplosion unter Genozidbedingungen – Der Demografie-Irrsinn
Man stelle sich vor: Ein Volk, das behauptet, einem Genozid ausgesetzt zu sein, vermehrt sich schneller als eine Legion von Kaninchen im Frühling. Ein Paradox so grotesk, dass es ohne bitteren Sarkasmus kaum zu ertragen ist. Wer braucht schon Fakten, wenn man Mythen hat, die besser performen als jede Netflix-Serie? Die dramatische Opferrolle ist das Sahnehäubchen auf einer biologischen Erfolgsgeschichte, die demografische Leichenfleddern zur Lachnummer macht. Ein Volk, das permanent im Zustand der Katastrophe inszeniert wird, aber keine Gelegenheit auslässt, weiter zu wachsen – biologisch, politisch und rhetorisch.
Das große Finale: Wer hat hier eigentlich das Sagen?
Palästinenser – ein politisches Phantom, das sich immer weiter vermehrt, während die Welt zuschaut und applaudiert, oder verzweifelt den Kopf schüttelt. Ein Volk, das erfunden wurde, um Leid zu institutionalisierten, Elend zu perpetuieren und politisches Kapital aus einer Dauerkrise zu schlagen. Die „Brüder“ im nahöstlichen Klub der Länder wissen längst, dass sie nicht Freunde, sondern unfreiwillige Gastgeber sind, und reagieren mit einer Mischung aus Ignoranz, Abneigung und kalkulierter Gleichgültigkeit. Und mittendrin das Volk, das zwischen Überleben, Mythos und politischer Inszenierung hin- und hergerissen ist, während der Rest der Welt das Schauspiel als Dauerbrennstoff für endlose Debatten nutzt.
In diesem Zirkus der Absurditäten ist nicht nur das Leiden, sondern auch die Demografie ein Kabarettprogramm – bitter, sarkastisch und mit einem Augenzwinkern, das den Wahnsinn nur noch grotesker macht.