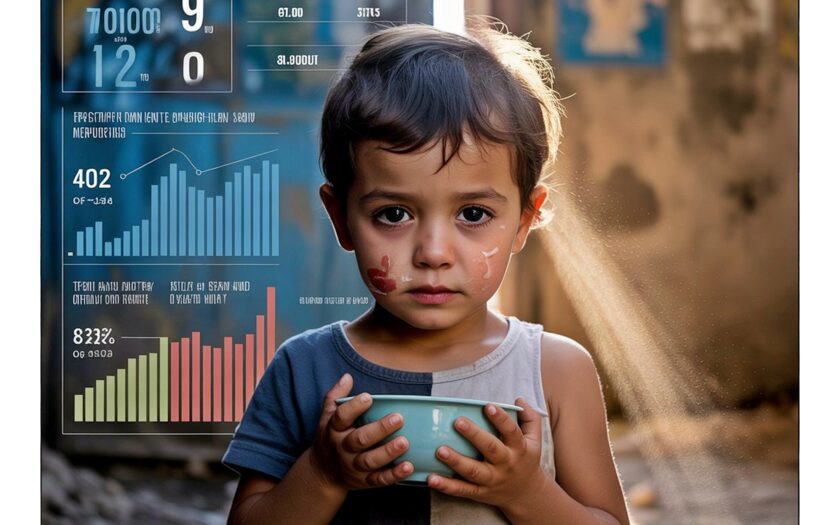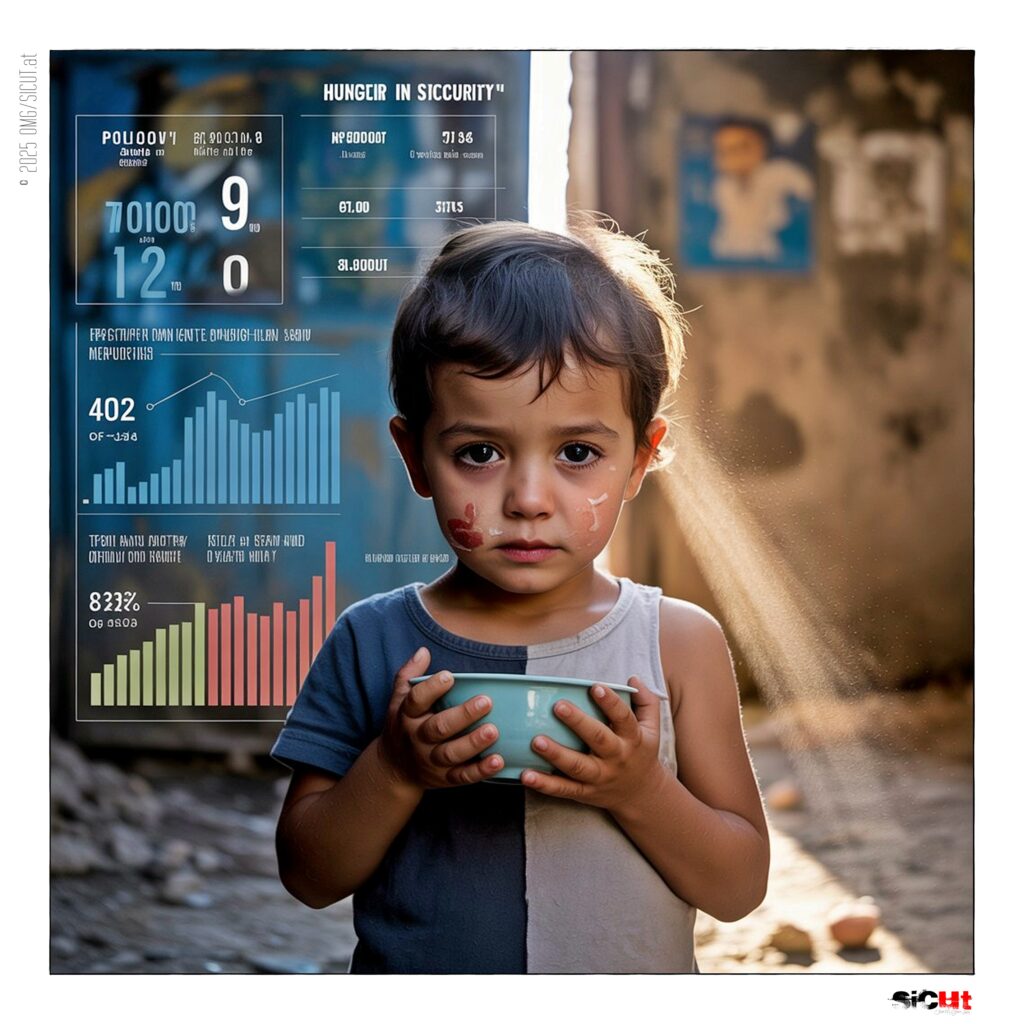
Von der Kunst, den Maßstab zu verschieben, bis die Realität passt
Es gibt Ereignisse, die so grotesk sind, dass man sich fragt, ob Kafka nicht heimlich Ghostwriter bei internationalen Organisationen spielt. Nehmen wir etwa die jüngste Hungersnotserklärung im Gazastreifen: eine mit dem Segen der UNO gesalbte Organisation hat offiziell Alarm geschlagen – und dabei, sagen wir, die Spielregeln leicht „nachjustiert“. Was heißt leicht? Man stelle sich einen Marathonläufer vor, der das Ziel kurzerhand um 20 Kilometer nach vorne verlegt und dann triumphierend erklärt, er habe die Weltrekordzeit pulverisiert. Genau diese sportliche Eleganz im Umgang mit Standards darf man nun in der internationalen Hungerstatistik bewundern.
Die Schönheit der Fußnote
Denn: Hungersnöte werden bekanntlich nicht einfach gefühlt, sie werden definiert. Präzise. Wissenschaftlich. Mit Zahlen, Tabellen, Schwellwerten. Oder – im neuesten Kapitel – mit einem unscheinbaren Sternchen unter einer Tabelle, das den Unterschied zwischen „katastrophal“ und „nicht ganz so schlimm“ markiert. Ja, so diskret, dass selbst die pedantischsten Bürokraten in Brüssel, wo bekanntlich selbst der Krümmungsgrad der Banane einst Verordnungsstatus erlangte, vor Neid erblassen müssten.
Im Handbuch stand einst: 30 Prozent der Kinder müssen akut unterernährt sein – nachprüfbar an Gewicht und Größe, ein mühsames, aber immerhin halbwegs präzises Verfahren. Nun aber genügt ein hübsches kleines Maßband am Oberarm, der sogenannte MUAC, und schwupps – die Schwelle sinkt auf 15 Prozent. Wer braucht schon Körpergröße und Gewicht, wenn man den Untergang der Menschheit in Zentimetern am Bizeps messen kann? Praktisch, schnell, und vor allem: medienwirksam.
Von Zahlenmagie und moralischer Buchhaltung
Natürlich könnte man sagen: »Aber wenn Kinder hungern, ist es doch egal, wie man misst.« Nun, das stimmt – wenn es um reale Hilfe ginge. Doch hier geht es nicht um Hilfe, sondern um Schlagzeilen. Um moralische Munition im Info-Krieg. Ein Prozentpunkt hier, eine Definition dort – und schon verwandelt sich eine schwierige humanitäre Lage in das „Worst-Case-Szenario einer Hungersnot“, wie CNN und Konsorten brav nachbeten.
Das Faszinierende: Mit dem neuen Maßstab kann man Hungersnöte praktisch auf Bestellung ausrufen. Ein wenig flexibles Datenmanagement, ein paar wohlgesinnte Quellen (notfalls aus der PR-Abteilung einer Terrororganisation, die zufällig auch das Gesundheitsministerium stellt), und voilà: die apokalyptische Erzählung steht. Wer braucht schon harte Evidenz, wenn die Empörung als politische Währung längst stabiler ist als jede Zentralbank?
Die stille Revolution der weichen Daten
Apropos Daten: Die Quelle der dramatischen Zahlen im Juli-Bericht war das Gesundheitsministerium in Gaza – also eine Einrichtung, deren Neutralität ungefähr so unverdächtig ist wie die Objektivität der Tabakindustrie beim Thema Lungenkrebs. Aber keine Sorge: Diese Daten sind „intern“ und damit vor allem eines – nicht überprüfbar. Was für ein Glück, dass Journalisten heutzutage ohnehin keine Lust mehr haben, Dokumente zu prüfen. Schließlich reicht ein offizielles Logo auf dem Briefkopf, um aus einem Gerücht eine Statistik und aus einer Statistik eine „Faktenlage“ zu machen.
Man könnte fast meinen, es sei Absicht: Wer Hunger definieren kann, ohne ihn exakt messen zu müssen, der kontrolliert nicht nur das Narrativ, sondern auch die moralische Landkarte der Welt. Somalia, Sudan, Südsudan mussten noch den alten, strengen Maßstab erfüllen. Gaza hingegen bekommt die Sonderedition: Hungersnot Deluxe, jetzt mit halber Hürde, dafür doppelter Medienwirkung.
Der Triumph der PR über die Realität
Es ist schwer, bei alledem nicht eine gewisse Bewunderung zu empfinden. Da haben die Kommunikationsstrategen eine Meisterleistung hingelegt: Während reale Helfer noch mit Kalorienrationen, Trinkwasser und medizinischen Lieferungen jonglieren, genügt den PR-Soldaten ein Handmaß, ein paar interne Tabellen und ein Sternchen in der Fußnote. Das Ergebnis: Schlagzeilen über „Massenhungersnot“ in den Leitmedien – zuverlässig, weltweit, synchron.
Natürlich könnte man fragen: Cui bono? Wer profitiert davon, dass die Hungersnotdefinition aufgeweicht wurde? Nun, die Antwort ist so offensichtlich, dass sie fast langweilig klingt. Aber sagen wir es so: In einer Welt, in der Bilder mehr zählen als Bilanzen, ist jeder tote Körper, jedes hungernde Kind eine geopolitische Münze – eine, die sich auf der großen Bühne der Diplomatie in Anklagen, Sanktionen und Schlagzeilen auszahlen lässt.
Fazit: Die Hungersnot der Begriffe
So bleibt am Ende die eigentliche Tragödie: nicht nur, dass Menschen tatsächlich leiden – was unbestritten ist –, sondern dass ihr Leid zum Spielball wird. Dass die Maßstäbe so lange gedehnt, gesenkt und verwässert werden, bis aus einer ernsthaften humanitären Krise eine maßgeschneiderte politische Waffe wird.
Wir haben es hier nicht mit einer Hungersnot der Mägen, sondern mit einer Hungersnot der Begriffe zu tun. Mit einer semantischen Diät, die den moralischen Stoffwechsel der westlichen Öffentlichkeit ankurbelt, bis sie im Empörungsrausch zusammenbricht.
Und die UNO? Die nickt, schweigt oder erklärt, man habe leider keine Zeit für Fragen. Verständlich. Schließlich muss man schon die nächste Tabelle vorbereiten – mit einem neuen Sternchen in der Fußnote, für das „Worst-Case-Szenario 2.0“.