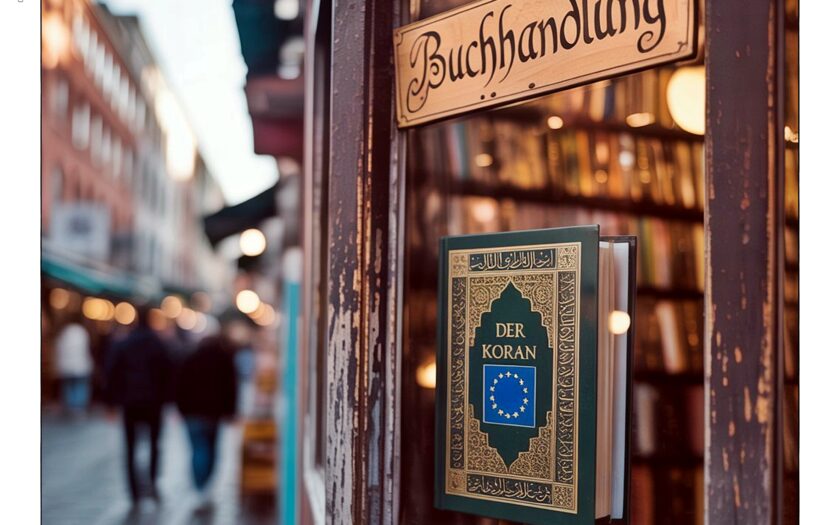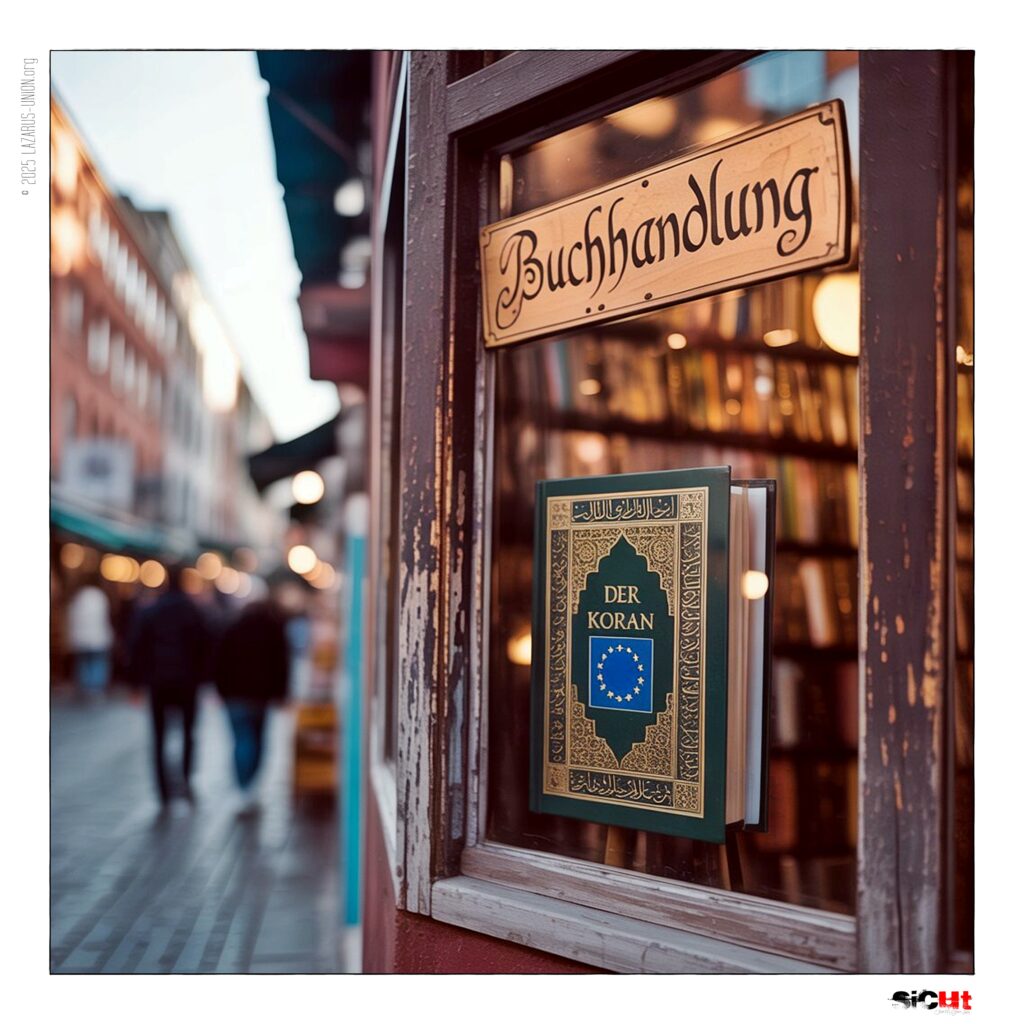
Die EU und der europäische Koran: Eine Symphonie der Ideologie
Man stelle sich folgendes vor: Die Europäische Union, jenes kollektive Konglomerat von Bürokraten, Beamten und ambitionierten Förderprogrammen, entschließt sich, nahezu zehn Millionen Euro in ein Projekt zu investieren, dessen Titel allein schon so verheißungsvoll klingt, dass man sich automatisch fragt, ob hier nicht ein neuer Bestseller für Museumsshops, eher als für universitäre Archive, geplant ist: The European Qur’an. Zwischen 1150 und 1850 – einer Epoche, in der Europa in mancher Hinsicht noch von der Pest heimgesucht wurde und in anderen noch nicht einmal ansatzweise die politische Kohärenz besaß, die es heute wenigstens auf dem Papier propagiert – soll der Koran als heimlicher Motor europäischer Kultur erkannt werden. Wanderausstellungen, Konferenzen, Buchveröffentlichungen – das volle Programm, um endlich „traditionelle Wahrnehmungen“ zu hinterfragen, während man die Latte gleich so hoch hängt, dass selbst der Turm von Babel neidisch werden würde. Die Botschaft: Der Islam, dieser unterschätzte Wohltäter, habe Europa geprägt – ein wohlfeiles Narrativ, das man ohne Zögern in das leuchtende Schaufenster der EU-Kulturpolitik stellen kann. Dass die Projekt-Website zu Beginn des Artikels nicht aufrufbar war, rundet den Eindruck ab: Wie in jedem guten Abenteuer muss man erst ein Labyrinth überwinden, bevor man die verborgenen Schätze erreicht.
Ideologische Allianz oder akademische Expertise?
Die Story wird jedoch pikant, sobald man die beteiligten Wissenschaftler unter die Lupe nimmt. Einige von ihnen sollen – wie zu hören ist – Kontakte zur Muslimbruderschaft pflegen. Plötzlich erhält die ganze Initiative den Charme einer Mischung aus akademischer Exegese und geopolitischem Schachspiel. Florence Bergeaud-Blackler, selbst unter Polizeischutz wegen kritischer Veröffentlichungen über dieselbe Bruderschaft, warnt vor der subtilen Verankerung dieser Organisation in europäischen Programmen. Ein Hauch von Spionage, vermengt mit wohlmeinender Kulturförderung – ein Cocktail, der sowohl den Geschmack der Neugierigen als auch den der Alarmierten trifft. Man stelle sich die Szenarien vor: Wanderausstellung in Brüssel, daneben ein kleiner Stand mit „Kontakten zur Bruderschaft – bitte nehmen Sie Broschüre“; Konferenzgäste, die zwischen Vorträgen über mittelalterliche Manuskripte und geopolitische Strategieplanungen hin- und hergerissen sind. Alles im Dienste der Wissenschaft, versteht sich.
Geschichtsfälschung mit EU-Siegel
Fabrice Leggeri, Ex-Chef von Frontex und EU-Abgeordneter, nennt das Projekt offen eine „Geschichtsfälschung – finanziert mit öffentlichen Geldern“. Man muss ihm fast zustimmen, wenn man sich die Logik anschaut: Europa soll zwischen 1150 und 1850 durchgehend vom Islam geprägt gewesen sein, ein Gedanke, der Historiker wie Glühwürmchen im Tageslicht erscheinen lässt – sichtbar, aber nicht wirklich glaubhaft. Dass ausgerechnet das Programm Scientific Excellence, das eigentlich dazu dienen sollte, Europas Rückstand in High-Tech-Forschung aufzuholen, nun Mittel für kulturhistorische Koran-Studien bereitstellt, ist eine Pointe, die sich jeder Satiriker in Paris, Brüssel oder Wien nur schwer hätte ausdenken können. Wettbewerbsvorteile gegen die USA durch die Analyse mittelalterlicher Koran-Exegesen – die Vorstellung alleine erzeugt ein leichtes Zucken im Augenlid.
Kontrolle über EU-Gelder: Ein Schattenspiel
Céline Imart, ebenfalls EU-Abgeordnete, schreibt an Ursula von der Leyen, um den „Mangel an Kontrolle über EU-Gelder“ zu beklagen. Man muss sich die Szene bildlich vorstellen: ein Briefwechsel voller höflicher Entrüstung, während im Hintergrund Aktenberge wachsen, die mehr Geschichten enthalten als das gesamte Projektbudget. Die Ressourcen, so argumentiert sie, sollten besser jenen Forschern zugutekommen, die den europäischen High-Tech-Motor am Laufen halten – und nicht jenen, die sich ideologisch einspinnen und historische Narrative umtexten. Das ist eine Ironie, die an sich schon literarischen Wert besitzt: Mit einem Federstrich könnten Milliarden in echte Innovationen fließen, aber nein – man investiert in Koran-Ausstellungen, die nicht einmal online sichtbar sind.
Würde Wien nur…
Und schließlich der köstlich-schwarze Humor: Hätte Wien die freundliche Einladung des Jahres 1529 oder 1683 angenommen, wären diese zehn Millionen Euro heute überflüssig gewesen. Es ist, als würde man sagen: „Danke, Europa, dass du uns heute durch Kulturförderung erleuchtest – während wir vor Jahrhunderten bereits standhaft blieben.“ Ein subtiler Seitenhieb auf die historische Realität, der das gesamte Projekt in ein ironisches Licht taucht: Europa investiert Millionen, um rückblickend die eigene Geschichte zu klittern, während die alten Stadttore längst offen wie Scheunentore sind.