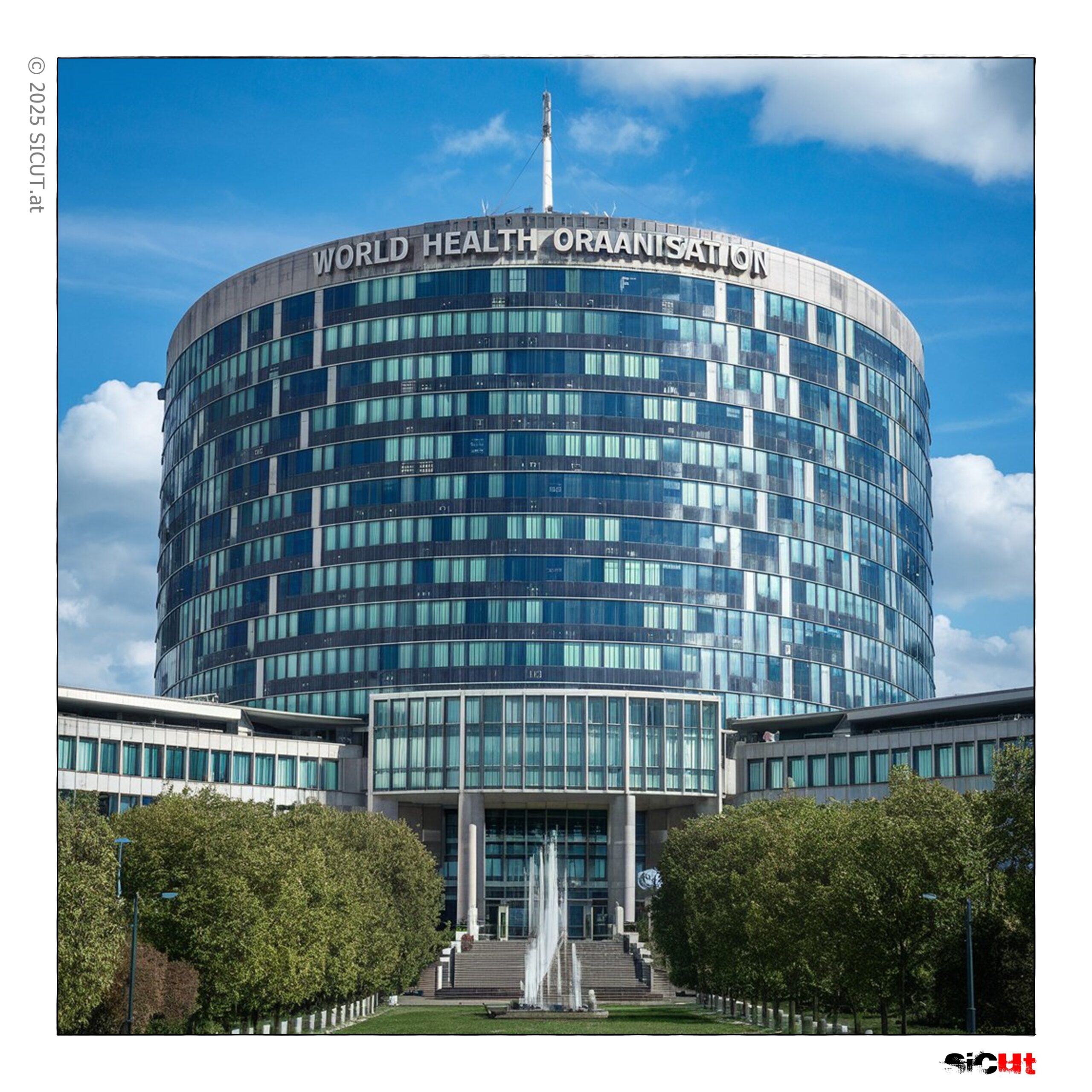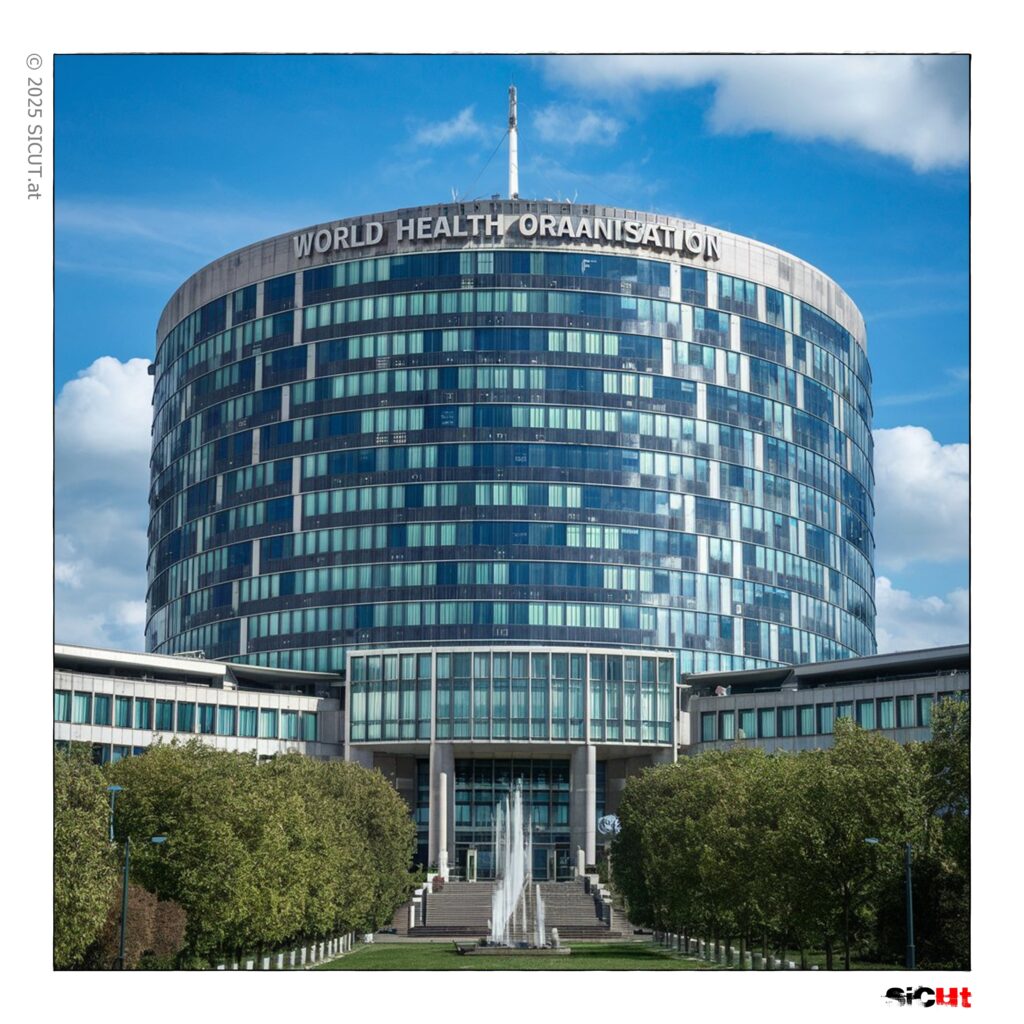
Diagnose einer Institution in Schieflage
Die Weltgesundheitsorganisation, liebe Leserinnen und Leser, jener angeblich omnipotente Wächter über das Wohl der Menschheit, taumelt seit Jahren wie ein Hypochonder in der Selbsthilfegruppe für gescheiterte Ideale. Einst ein stolzer Löwe im Dschungel der globalen Gesundheit, verkommt sie zusehends zu einem hechelnden Schoßhund, der sich zwischen den Füßen mächtiger Geldgeber windet, auf der Suche nach dem nächsten Leckerli – sei es in Form von großzügigen Spenden oder politischen Zugeständnissen. Einst gegründet, um der Welt Heilung und Hoffnung zu bringen, wirkt die WHO heute wie ein alternder Mediziner, der seine eigene Rezeptpflichtigkeit vergessen hat.
Die Bürokratie: Wenn Heilung an Formularen scheitert
Man stelle sich vor, ein internationaler Notfall bricht aus – eine Pandemie, sagen wir. Die WHO wird gerufen, ein Gremium, das, wenn man den Eigenbeschreibungen glauben darf, stets bereit ist, „umgehend zu handeln“. Doch was geschieht? Zuerst wird ein Notfallkomitee einberufen, das wiederum einen Unterausschuss bildet, der seinerseits eine Risikoanalyse anfertigen lässt. Bis die endgültige Entscheidung fällt, ob man das Ganze überhaupt als Notfall definieren will, sind bereits zigtausende Menschen gestorben, und ein Land hat sich selbst auf den Mond evakuiert. Doch keine Sorge: Die WHO veröffentlicht eine Pressemitteilung, in der sie „tiefe Besorgnis“ äußert und dazu aufruft, weiterhin „Vorsicht walten zu lassen“. Ein Akt der Weltrettung, minutiös protokolliert – in dreifacher Ausfertigung.
Die WHO-Bürokratie ist das Gesundheitssystem unter den Gesundheitssystemen: kostspielig, ineffizient und stets darauf bedacht, Symptome zu verwalten, anstatt Ursachen zu bekämpfen. Dabei gibt sie sich selbst den Anstrich von technokratischer Perfektion, während sie in Wirklichkeit kaum mehr ist als ein Flickenteppich aus regionalen Interessen, nationalen Egoismen und der Angst vor Verantwortung.
Finanzierung: Mit Zuckerbrot und Diktat
Was wäre eine internationale Organisation ohne ihre Gönner? Nichts weiter als ein zahnloser Tiger im Zoo der geopolitischen Machtspiele. Die WHO hat jedoch nicht nur die Zähne verloren – sie hat sie freiwillig abgegeben. Ihr jährliches Budget gleicht dem einer mittelgroßen Stadtverwaltung, ihre Abhängigkeit von privaten Spenden und den Launen mächtiger Staaten ist geradezu grotesk. In einer Welt, in der der Milliardär mit der größten Brieftasche mehr Einfluss auf globale Gesundheitsentscheidungen hat als die Generaldirektion, wird schnell klar: Die WHO ist keine unabhängige Institution, sondern ein Marionettentheater, bei dem die Strippen in Washington, Peking oder bei der Gates Foundation gezogen werden.
Man fragt sich: Ist es nicht geradezu zynisch, wenn die Organisation, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für die Gesundheit der Ärmsten zu kämpfen, ausgerechnet von den Reichsten alimentiert wird? Die WHO mag dies als „Public-Private-Partnership“ bezeichnen; Kritiker hingegen könnten es treffender als „Public-Panhandling“ bezeichnen.
Krisenmanagement: Die Kunst, im entscheidenden Moment zu versagen
Es heißt, man solle niemals eine Krise ungenutzt verstreichen lassen. Die WHO hat diesen Satz offenbar so interpretiert, dass sie jede Krise zur Perfektion ignoriert. Ob es nun um Ebola, SARS oder COVID-19 geht – die Organisation hat eine bemerkenswerte Fähigkeit bewiesen, stets hinter den Ereignissen herzulaufen, anstatt sie aktiv zu gestalten. Ihre Reisehinweise während der Pandemie waren so präzise wie die Wettervorhersage einer Glaskugel, ihre Empfehlungen wechselten schneller als der Kurs des Bitcoins, und ihre Kommunikationsstrategie glich einer Mischung aus Phrasendrescherei und beschwichtigendem Schulterzucken.
Doch das eigentliche Meisterstück der WHO ist ihr Umgang mit autoritären Regimen. Anstatt Fehlverhalten offen zu kritisieren, übt sie sich in einer geradezu beängstigenden Kunst der diplomatischen Unterwerfung. Dass China bei der COVID-19-Pandemie monatelang kritische Informationen zurückgehalten hat, wurde von der WHO mit einem höflichen Nicken quittiert. Kein Wunder, denn wer beißt schon die Hand, die einen (mehr oder weniger) füttert?
Das Narrativ: Die Mär vom globalen Wächter
Die WHO liebt es, sich als moralische Instanz darzustellen – ein Leuchtturm in stürmischen Zeiten, ein Bollwerk gegen die Unvernunft. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine Organisation, die längst ihren eigenen Idealen entfremdet ist. Sie fordert von der Weltbevölkerung, die Wissenschaft zu respektieren, während sie selbst wissenschaftliche Standards immer wieder dem politischen Opportunismus opfert. Sie spricht von Transparenz, während sie selbst ein Labyrinth aus internen Machtkämpfen und verschlossenen Türen ist.
Die Wahrheit ist: Die WHO ist kein globaler Wächter, sondern ein Getriebener – von Geld, Macht und dem verzweifelten Versuch, relevant zu bleiben. Und wie alle Getriebenen verliert sie dabei das Ziel aus den Augen.
Der Patient braucht eine Therapie
Was bleibt also zu sagen über die WHO, den kranken Mann der UNO? Vielleicht dies: Sie ist weder Heilsbringer noch Teufel, sondern eine tragische Figur – gefangen in einem System, das sie selbst nicht mehr versteht. Doch während wir die Schwächen der WHO kritisieren, sollten wir nicht vergessen, dass sie auch ein Spiegel unserer Welt ist: einer Welt, die lieber Symptome lindert, als Ursachen zu beseitigen; die lieber redet, als handelt; und die lieber Schuldige sucht, als Verantwortung übernimmt.
Die WHO braucht eine Therapie, keine Schönheitsoperation. Ob sie diese Therapie je erhalten wird, hängt jedoch nicht von ihr allein ab. Es hängt von uns ab, den Bewohnern dieses kränkelnden Planeten, der sich einst anmaßte, das Zeitalter der Aufklärung eingeläutet zu haben – nur um dann vor den Herausforderungen seiner eigenen Ideen zu kapitulieren.