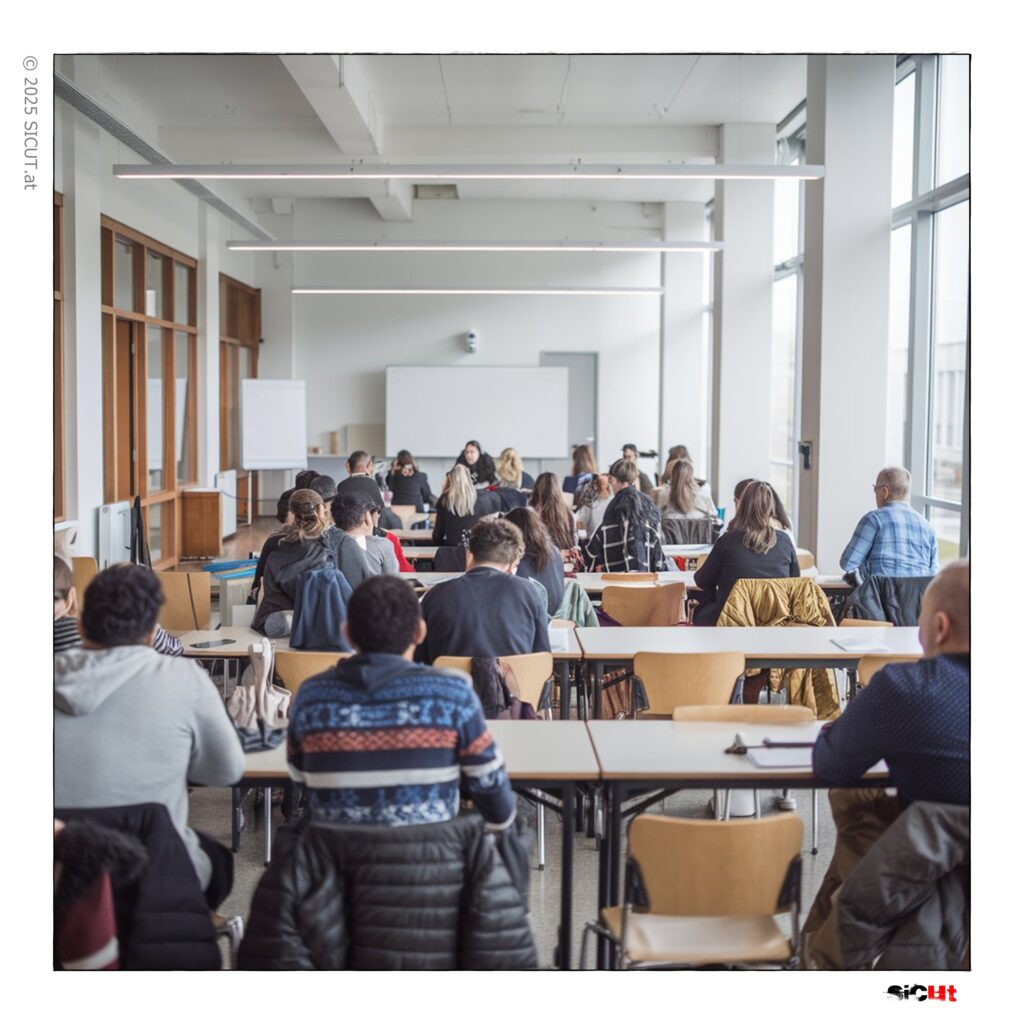
Vom großen Scheitern der moralischen Nachhilfestunde
Es gibt Zahlen, die sprechen für sich. Und dann gibt es Zahlen, die schreien. Die neuesten Ergebnisse aus den Integrationsstatistiken Österreichs gehören zur zweiten Kategorie. Jeder vierte Migrant bricht den sogenannten „Wertekurs“ ab. Also jenes freundliche, pädagogisch liebevoll verpackte Nachhilfeprogramm, in dem wir den Neuankömmlingen erklären, was hierzulande als zivilisierter Minimalkonsens gilt. Man sollte meinen, dass es sich dabei um Grundlegendes handelt – wie etwa, dass Frauen nicht der verlängerte Arm des Eigentumsbegriffs sind, dass das Wort „Meinungsfreiheit“ nicht „ich darf andere niederbrüllen“ bedeutet, und dass man Konflikte im Zweifel nicht mit der Machete löst, sondern mit einer Anzeige bei der Polizei. Aber nein – offenbar sind diese kulturellen Basics für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Kursteilnehmer derart schwer verdaulich, dass ihnen der Lernprozess auf halber Strecke im Hals stecken bleibt.
Wohlgemerkt: Wir reden hier nicht über den Abbruch eines Yogakurses, sondern über das freundliche Angebot der Republik Österreich, in einem klimatisierten Seminarraum das zarte Pflänzchen westlicher Werte aufblühen zu lassen. Doch was passiert? Der Kurs wird abgebrochen. Die Hand, die man reicht, wird ausgeschlagen. Mancherorts wohl auch gebissen. Und wieder einmal sitzen wir in der ersten Reihe beim Trauerspiel einer Integration, die im besten Fall holpert und im schlimmsten Fall nicht einmal den Anlauf übersteht.
Der Wertekanon als Zumutung – oder: Warum Gleichberechtigung manchen Kopfschmerz bereitet
Ein besonders pikantes Detail, das diese Statistik so delikat wie bitter macht, ist der Blick auf das Geschlechterverhältnis unter den Kursabbrechern. Spoiler: Es sind vor allem Männer, die sich bei der Präsentation unserer gesellschaftlichen Leitlinien dezent abwenden. Offenbar ist der Gedanke, dass Frauen in Österreich nicht nur zum Kinderkriegen und Kochen da sind, sondern auch als selbstbestimmte Individuen auftreten dürfen, für einige Teilnehmer schwerer zu ertragen als ein Drei-Gänge-Menü aus Glasscherben.
Man kann sich lebhaft vorstellen, wie der Vortrag über Gleichberechtigung verläuft. Da sitzt der Vortragende, vermutlich ein pensionierter Gymnasiallehrer mit einer PowerPoint-Präsentation, die irgendwo zwischen „Erklärbär“ und „Moralkeule“ changiert, und erklärt geduldig, dass es in Österreich keine patriarchale Hackordnung gibt, jedenfalls nicht offiziell. Auf der anderen Seite sitzen die Zuhörer, die das mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit, innerlichem Augenrollen und offenem Desinteresse quittieren. Manche stehen irgendwann auf, packen ihre Jacke und gehen. Integration abgebrochen. Wertevermittlung gescheitert. Der Kursleiter bleibt ratlos zurück und spürt, wie seine Resthoffnung langsam verdampft.
Die linke Erzählung vom ewigen Opfer – oder: Das Märchen von der Anpassungspflicht des Gastgebers
Natürlich dauert es nach solchen Enthüllungen nie lange, bis die üblichen Stimmen ertönen. Der Chor der Betroffenheitsbeauftragten ist schnell zur Stelle. „Man müsse mehr Verständnis haben“, heißt es dann. „Die Menschen sind traumatisiert.“ „Wir müssten nur empathischer sein.“ Und so weiter. Dieselbe Leier seit Jahrzehnten. Das Mantra lautet: Wer nicht ankommt, dem wurde nicht genug beim Ankommen geholfen.
Doch diese Erklärung ist, mit Verlaub, intellektuell faul. Sie ist bequem, weil sie die Verantwortung ausschließlich beim Aufnahmeland ablädt. Der Migrant wird darin zum willenlosen Blatt im Wind der Umstände, unfähig zur eigenen Entscheidung, zum eigenen Lernen, zum eigenen Handeln. Eine paternalistische Sichtweise, die, wenn man es genau nimmt, zutiefst herablassend ist. Wir fordern nichts weiter als die Akzeptanz dessen, was hierzulande für selbstverständlich gehalten wird. Und wenn das schon zu viel verlangt ist, dann darf – nein, dann muss – das Konsequenzen haben.
Sanktionen als letzte Bastion – oder: Warum Zuckerbrot allein nicht reicht
Es ist an der Zeit, dass wir den Werteunterricht nicht länger als kostenlosen Feel-Good-Workshop begreifen, bei dem man jederzeit die Türe leise hinter sich schließen kann, wenn einem das Thema nicht schmeckt. Wer den Kurs abbricht, soll spüren, dass das nicht ohne Folgen bleibt. Punkt. Andernfalls sind unsere Integrationsbemühungen nichts weiter als gut gemeinter Kitsch für den politischen Folkloreabend.
Natürlich regen sich sofort die üblichen Verdächtigen: Menschenrechts-NGOs, Sozialarbeiter mit Weltrettungspathos, linke Kolumnisten auf der Suche nach dem nächsten moralischen Höhenflug. Sie werfen mit Begriffen wie „Diskriminierung“, „Ausgrenzung“ und „Rassismus“ um sich, als wären das Konfetti auf einer Feier der Selbstgerechtigkeit. Doch am Ende bleibt die Frage: Wollen wir Integration als ernsthaften Prozess begreifen oder als therapeutische Begleitveranstaltung ohne jede Verbindlichkeit? Wenn wir Letzteres wählen, dann brauchen wir uns über die Ergebnisse nicht mehr wundern. Dann ist das Scheitern Programm.
Der blinde Fleck der liberalen Demokratie – oder: Wer keine Werte definiert, wird überrannt
Die unangenehme Wahrheit ist: Niemand kann sich anpassen, wenn es nichts gibt, woran man sich orientieren könnte. Eine Demokratie, die nicht in der Lage ist, ihre eigenen Grundsätze klar zu benennen und zu verteidigen, lädt unweigerlich dazu ein, ausgehöhlt zu werden. Wer immer nur Verständnis predigt, aber nie Grenzen zieht, macht sich am Ende selbst zur Karikatur seiner Werte.
Der Druck wächst. Der Unmut wächst. Die Resignation wächst. Immer weniger Einheimische glauben noch an ein harmonisches Zusammenleben mit Zuwanderern – und das ist kein Gefühl, das vom rechten Rand ins Land getragen wird, sondern eine Alltagserfahrung. Vor drei Jahren war noch jeder Dritte optimistisch, heute ist es nur noch jeder Fünfte. Der Rest hat kapituliert oder schweigt betreten.
Der Abschied vom naiven Humanismus – oder: Ein Land zwischen Anspruch und Realitätsverlust
Vielleicht ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen von der Illusion, Integration sei ein Spaziergang. Sie ist ein harter, steiniger Weg – für beide Seiten. Doch wer diesen Weg geht, muss wissen, dass es Regeln gibt. Wer das nicht akzeptiert, bleibt eben draußen stehen. So funktioniert jede Gemeinschaft, seit es Menschen gibt. Und Österreich ist da keine Ausnahme, auch wenn es sich gelegentlich einbildet, der moralische Nabel der Welt zu sein.
Wir müssen endlich aufhören, uns selbst etwas vorzumachen. Nicht jeder, der hier ankommt, will auch Teil dieser Gesellschaft werden. Und nicht jeder, der es versucht, schafft es. Das ist bitter, das ist schmerzhaft, aber es ist auch die Realität. Vielleicht hilft es, wenn wir diese Tatsache nicht länger als Skandal betrachten, sondern als das, was sie ist: eine schlichte Beschreibung des Zustands.
Und manchmal ist genau das der erste Schritt zur Besserung.
