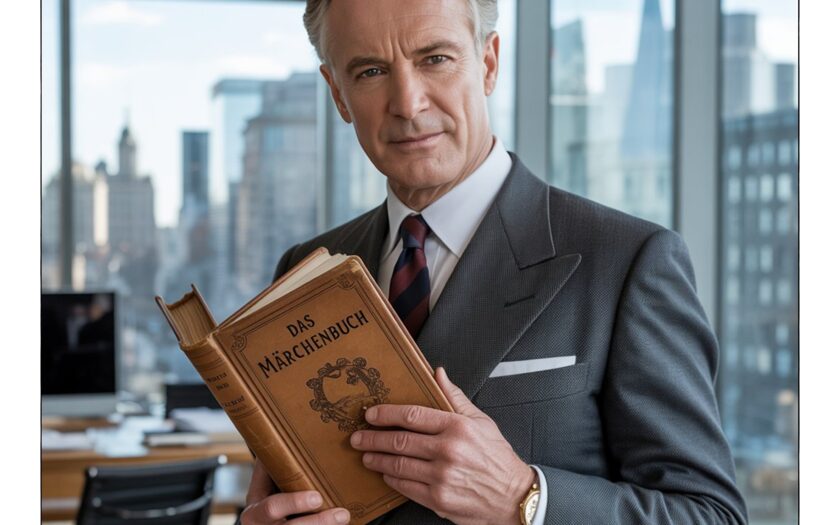Es gibt eine ganz bestimmte, fast schon poetische Ironie in Ustinovs Satz: „Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: Das ist technisch unmöglich!“
Man könnte fast meinen, es sei eine Prophezeiung, die sich in den Protokollen der Menschheit bereits eingraviert hat. Schließlich ist das Vertrauen in die Experten unserer Zeit eine Art säkulare Religion geworden – und Experten sind ihre Hohepriester, ihre Orakel, ihre Sprachrohre des vermeintlich Unfehlbaren. Doch wie es bei Orakeln üblich ist, klingen ihre Verkündigungen oft im Nachhinein wie schlechte Satire. So auch hier: Die Welt brennt, der Himmel leuchtet in einem unschönen Orange, aber keine Sorge, liebe Zuhörer – laut Fachmeinung ist das gar nicht möglich. Vielleicht ist es auch genau das: die letzte Form von Service, bevor der große Knall kommt – ein beruhigender Irrtum.
Der Kult der Unfehlbarkeit
Die Figur des Experten ist im 21. Jahrhundert zu einer Art heiliger Kuh geworden, die man nicht schlachten darf – selbst wenn sie mitten im Wohnzimmer liegt und den Teppich ruiniert. Politiker zitieren sie, Medien schmücken sich mit ihnen, und das Volk folgt ihnen, weil: „Der muss es ja wissen!“
Doch der Experte ist nicht etwa der allwissende Halbgott, sondern oft nur ein Mensch mit einer sehr, sehr spezifischen Nische – so spezifisch, dass er in 90 % aller Fälle nichts zu sagen hat und in den restlichen 10 % falsch liegt. Das Problem: Er sagt es trotzdem.
Man stelle sich vor, Archimedes wäre zu einem brennenden Wald gerufen worden, hätte kurz in die Flammen geblickt, den Kopf geschüttelt und verkündet: „Nach meinen Berechnungen existiert Feuer nicht.“ Genau so wirken manche fachlichen Stellungnahmen, wenn die Realität sich erdreistet, außerhalb der Modellparameter zu handeln.
Apokalypse im Konferenzraum
Es ist erstaunlich, wie viele Weltuntergänge bereits in Sitzungen begonnen haben. Nicht in den dampfenden Fabrikhallen oder im Schatten geheimer Militäranlagen – nein, im Konferenzraum, mit Kaffee aus einer viel zu teuren Maschine und PowerPoint-Präsentationen, die aussehen, als wären sie von gelangweilten Praktikanten erstellt.
Da sitzen sie dann, die Experten, und analysieren mit einer Mischung aus Selbstsicherheit und müdem Desinteresse, warum das Szenario, das gerade live passiert, laut Modell unmöglich ist. Meist geschieht das mit der gleichen Tonlage, mit der ein Meteorologe einen Sonnentag ankündigt, während draußen ein Tornado die Autos stapelt. Die Ironie ist nicht, dass sie sich irren – das tun wir alle. Die Ironie ist, dass sie sich irren und gleichzeitig überzeugt sind, dass sie es nicht tun.
Die Chronik der Fehleinschätzungen
Historisch gesehen hat der Satz „Das ist technisch unmöglich“ schon eine beachtliche Karriere hingelegt.
- „Fliegende Maschinen? Physikalisch nicht umsetzbar“, sagten Experten, bevor die Gebrüder Wright starteten.
- „Computer im Haushalt? Wozu?“, fragten Ingenieure noch in den 70ern.
- „Das Internet wird sich nicht durchsetzen“, erklärte ein Digitalberater 1995 und verschwand vermutlich kurz darauf im Orkus der eigenen Prognosen.
Diese Liste ist nicht nur lang, sie ist unendlich – und jede neue Fehleinschätzung reiht sich ein wie ein weiteres Puzzlestück in das große Kunstwerk menschlicher Überzeugungskraft. Es ist, als ob der Satz „Das ist unmöglich“ die Einladung der Geschichte wäre, es sofort möglich zu machen.
Zynismus als Notwehr
Es bleibt also nur der Zynismus, nicht als bloßes Lästern, sondern als geistige Überlebensstrategie. Denn wenn die letzte Stimme, die wir hören, tatsächlich diese des Experten ist, der den Untergang für ausgeschlossen erklärt, dann wollen wir wenigstens innerlich vorbereitet sein.
Vielleicht wird es in diesem finalen Moment auch kein panischer Schrei sein, sondern ein höflich formuliertes Gutachten: „Nach gegenwärtigem Kenntnisstand kann ein spontanes Auseinanderbrechen des Planeten nicht eintreten.“ Sekunden später hören wir ein Geräusch, das stark an das Zerbrechen einer Kaffeetasse erinnert – nur in deutlich größerem Maßstab.
Epilog: Die ultimative Ironie
Am Ende könnte man Ustinovs Satz auch als eine Art Trost verstehen. Wenn die Welt schon untergeht, dann wenigstens in einer perfekt absurden Pointe. Kein Chaos, keine unverständlichen Schreie, kein sinnloser Heldenmut – nur die gelassene Stimme des Irrtums, die uns versichert, dass das, was gerade geschieht, nicht geschehen kann.
Und vielleicht, ganz vielleicht, ist das die letzte Form von Humor, die uns bleibt: Lächeln, während der Abgrund näher kommt, wissend, dass wir wenigstens mit Stil untergehen.