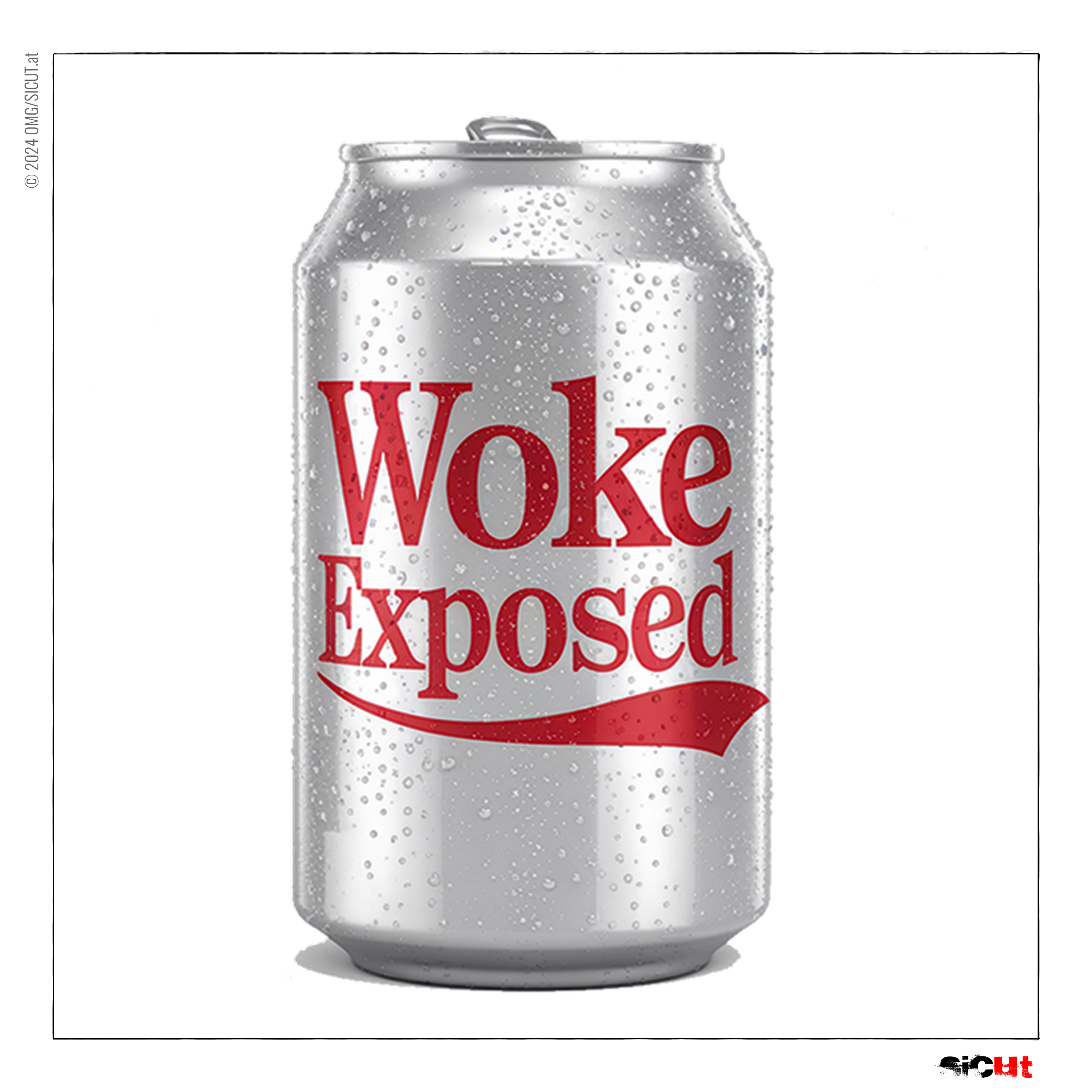Die „distanzierten Mitte“
In einer Welt, in der die Grenzen zwischen „rechts“ und „links“ zunehmend verschwommen erscheinen, präsentiert uns die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie, die uns auf eine verstörende Wahrheit aufmerksam macht: Man kann rechtsextrem sein und es gar nicht wissen. Die gute Nachricht? Wir haben immerhin die SPD-nahen Forscher, um uns auf die richtige Seite der Geschichte zu bringen. Aber bevor wir uns zu euphorisch freuen, sollten wir uns einen Moment Zeit nehmen, um über die nüchterne Realität dieser Studie nachzudenken, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet.
Der Weg zur „objektiven“ Studie
Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat bei einer Telefonumfrage mit gerade mal 800 Befragten ermittelt, dass der Anteil der Bundesbürger mit einem „manifest rechtsextremen Weltbild“ von 1,7 auf 8,3 Prozent gestiegen ist. Um die Glaubwürdigkeit dieser Studie zu sichern, ist es beruhigend zu wissen, dass sie von einem Institut der SPD durchgeführt wurde. Was könnte schon schiefgehen, wenn die politischen Interessen der Sozialdemokraten in der Hinterhand stehen? Vielleicht sollten wir auch gleich eine Umfrage zur Fragestellung „Sind Sie mit dem aktuellen Wetter unzufrieden?“ durchführen und diese als nationale Krisenstudie veröffentlichen.
Und was bedeutet „rechtsextrem“ in dieser wunderbaren neuen Welt? Laut dieser Studie sind wir bereits rechtsextrem, wenn wir uns mit den etablierten Medien unwohl fühlen, die aktuelle Migrationspolitik kritisieren oder es wagen, das Wort „Ausländer“ in den Mund zu nehmen. Man könnte fast meinen, dass die neuen „Rechtsextremen“ genauso gut mit einem Schild „Ich bin nicht woke“ durch die Straßen marschieren könnten. Und das ist der Punkt: Wenn wir all diese Merkmale auf die Goldwaage legen, dann könnten wir uns an einem Punkt befinden, an dem wir auch „rechtsextrem“ sind, wenn wir einen Fuß auf den Boden setzen.
Eine unheimliche Definition von Rechtsextremismus
Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass die Definition von „Rechtsextremismus“ in Deutschland offenbar so flexibel ist wie ein Yoga-Lehrer im Morgensonnenlicht. Wer das Gendern ablehnt, dem wird gleich das Stigma des Rechtsextremismus angeheftet. Glaubt man an zwei Geschlechter? Oh, das ist auch rechtsextrem! Und damit sind wir schon fast beim nächsten Punkt: die krampfhaften Versuche, den Begriff „Ausländer“ durch „Neuhinzukommende“ zu ersetzen. Das ist so ähnlich, als würde man versuchen, einen alten, rostigen Golf durch einen neuen Porsche zu ersetzen und dabei das klapprige Teil weiterhin als „Porsche“ zu verkaufen. Ein echter Kaufrausch der politischen Korrektheit!
Es ist beinahe komisch zu beobachten, wie die Studie den Verdacht einer bewussten und schwammigen Definition von rechtem Radikalismus im Auftrag linker Ideologie nicht einmal verbergen kann. Denn wenn alles, was wir nicht mögen, in eine Schublade gepackt wird, wo bleibt dann der Raum für Diskussionen? Wo ist die Demokratie, wenn wir nicht mehr miteinander reden können, ohne gleich die Stempelmaschine für „Rechtsextrem“ oder „Woke“ zu aktivieren?
Skepsis gegenüber der Demokratie
Ein besonders witziger Aspekt dieser Studie ist die Behauptung, dass etwa 27,3% der Befragten der Demokratie, unserem Staat und unseren Institutionen feindselig oder zumindest skeptisch gegenüberstehen. Oh je, da haben wir es: 27,3% der Deutschen, die einfach nur kritisch hinterfragen! Sind das alles Rechtsextreme? Skepsis ist ein Grundpfeiler der Demokratie. Nur weil ich nicht jeden Tag auf den Straßen nach der nächsten „Wir lieben die Regierung“-Demo marschiere, heißt das nicht, dass ich gegen das System bin. Skepsis ist notwendig, um eine gesunde Debatte zu führen.
Der Zwang zur Zustimmung
Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der Verlust des Vertrauens in ARD und ZDF als „bedauerlich“ eingestuft wird, weil „politisches und mediales Vertrauen“ eng miteinander verbunden sind. Wer hätte gedacht, dass wir eine Vertrauenskrise in die Medien haben? Was für eine erstaunliche Entdeckung! Aber anstatt die Ursachen dieses Vertrauensverlusts zu analysieren, wird schnell die Keule des Rechtsextremismus geschwungen, und das Vertrauen der Mitte in die Politik wird noch weiter in den linken Bereich verschoben. Die Frage bleibt: Wann kommt die Meldung einer FPÖ/AFD-nahen Stiftung, die uns mitteilt, dass wir uns die aktuelle Migrationspolitik nicht mehr leisten können? Natürlich wird eine solche Stiftung ignoriert, da sie nicht ins gewünschte Narrativ passt.
Das neue Normal?
Am Ende dieser Betrachtung stellt sich die Frage: Was passiert, wenn wir alle zu Rechtsextremen werden? Wenn wir die Definition von Rechtsextremismus so weit dehnen, dass die Mehrheit der Bevölkerung in diese Kategorie fällt, wer bleibt dann noch übrig, der als „normal“ gilt? Vielleicht sollten wir uns alle ein „Rechtsextremisten“-T-Shirt zulegen und uns bei der nächsten Umfrage einfach als „Neuhinzukommende“ ausgeben.
In einer Welt, in der das vermeintlich „normale“ Denken kriminalisiert wird und das „Woke“-Denkmodell sich als neue Weltanschauung etabliert, verlieren wir nicht nur den Überblick über die eigentlichen Probleme, sondern auch die Fähigkeit, respektvoll miteinander zu diskutieren. Das Resultat: eine Gesellschaft, die unter dem Gewicht ihrer eigenen Widersprüche zusammenbricht.
Wenn wir uns also fragen, ob wir rechtsextrem sind, sollten wir uns vielleicht einfach eine neue Umfrage wünschen. Denn eines ist sicher: Die einzige Grenze zwischen uns und dem Rechtsextremismus ist unser Verständnis davon, was es bedeutet, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben. Und wer weiß? Vielleicht haben wir ja die ganze Zeit rechtsextrem gedacht und es nicht einmal gemerkt.
Quellen und weiterführende Links
- Friedrich-Ebert-Stiftung. (2023). Die distanzierte Mitte: Rechtsextremismus in Deutschland.
- Bundeszentrale für politische Bildung. (2022). Rechtsextremismus: Eine Herausforderung für die Demokratie.
- ARD/ZDF-Studie. (2023). Vertrauen in die Medien und die Demokratie.