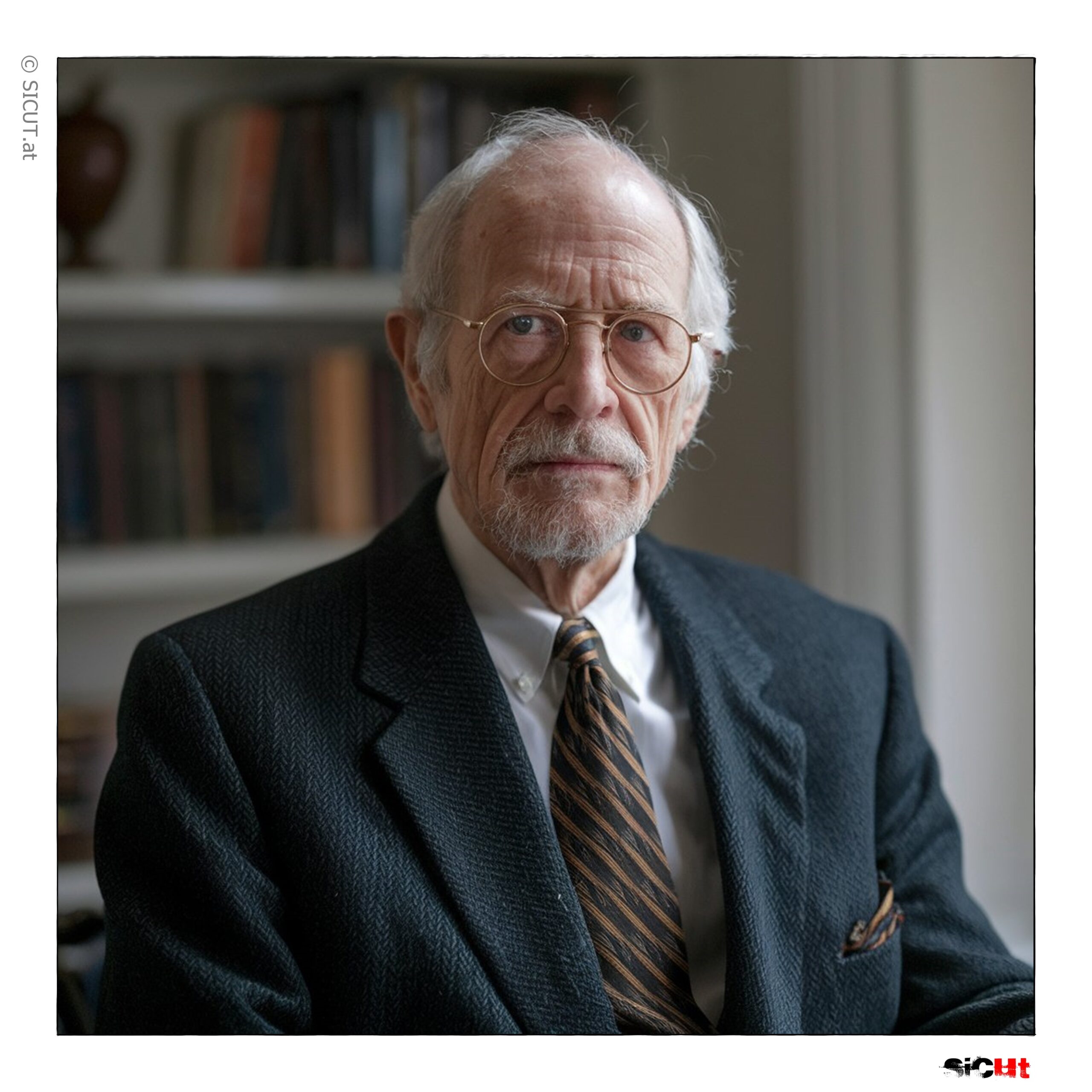Zwischenruf aus der Vergangenheit
Wenn Ignazio Silone, ein Mann, der dem Faschismus ins kalte Auge geblickt hatte, in den Ruinen des Zweiten Weltkriegs warnte, der Faschismus werde eines Tages im Mantel des Antifaschismus zurückkehren, so darf man sich erlauben, diesem Gedanken mit vorsichtiger Ironie zu begegnen. Denn wie viel subtiler könnte sich eine totalitäre Ideologie tarnen als mit der Maske der Tugend, der Banner der Freiheit und der Moral in Händen haltend? Silones Zitat ist eine jener pointierten Bemerkungen, die gleichermaßen als Mahnung wie auch als Einladung zur Selbstprüfung dienen. Doch wie ernst ist es ihm gewesen? War das ein prophetisches Seufzen oder schlicht ein kluger Aphorismus für die Ewigkeit, einer jener Sätze, die dazu geschaffen sind, in den Gassen von Florenz als Graffito zu enden oder in den Fußnoten linker Theoretiker verstaubt zu werden?
Der Antifaschismus als sakrosanktes Narrativ
Man könnte behaupten, der Begriff „Antifaschismus“ sei mittlerweile die perfekte Hohlformel geworden: wandelbar, adaptiv und elastisch genug, um alles und jeden zu umfassen, der sich irgendwie gegen Unterdrückung positioniert – oder dies zumindest behauptet. Da ist keine klare Linie mehr zwischen dem, was realer Widerstand ist, und dem, was bloß schillernde Pose bleibt. Denn seien wir ehrlich: Wer möchte in den Spiegel schauen und entdecken, dass er auf der „falschen Seite der Geschichte“ steht? Doch genau hier beginnt das Problem: Der Antifaschismus, so wie er heute vielfach auftritt, funktioniert nicht mehr als Werkzeug der Emanzipation, sondern immer öfter als Waffe der gesellschaftlichen Sanktionierung. Er wird zum Kontrollinstrument, ein moralischer Pranger, dessen Effektivität nicht auf Fakten, sondern auf der emotionalen Macht seiner Begriffe basiert.
Die Dialektik der Tugendterroristen
Es scheint fast eine dialektische Ironie der Geschichte zu sein, dass der Kampf gegen den Faschismus zuweilen selbst faschistoide Züge annimmt. Da marschieren sie, die neuen Tugendwächter, bewaffnet mit Twitter-Accounts, empörten Hashtags und der moralischen Unfehlbarkeit eines Zehnjährigen, der gerade entdeckt hat, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist, sondern in hunderttausend Grautönen schimmert. Ihre Gegner? Jeder, der es wagt, auch nur eine Nuance außerhalb der offiziellen Palette der korrekten Meinungen zu wählen. Und hier liegt die groteske Tragik: Wer einmal in die Fänge dieser selbsternannten Garde gerät, wird nicht befragt, er wird verurteilt. Der Antifaschismus wird so zum Tribunal, vor dem Abweichler keine Gnade erwarten dürfen.
Eine neue Uniform für alte Ideen
Das Paradoxe – und vielleicht auch das Geniale – an dieser neuen Form von moralischem Konformitätsdruck ist, dass er von einer Erzählung getragen wird, die sich auf die höchsten Prinzipien der Freiheit und der Menschenwürde beruft. Wer könnte es wagen, sich dagegen zu stellen? „Antifaschistisch“ ist das Adjektiv, das jeden Zweifel zerquetscht, jede Debatte vorab beendet. In seinem Namen wird diffamiert, ausgeschlossen, boykottiert, sanktioniert. Dabei könnte es fast zum Lachen reizen, wie blind die moralischen Wachtposten gegenüber ihrer eigenen Inkohärenz sind. Sie, die sich als die letzten Bastionen gegen autoritäre Übergriffe sehen, werden selbst zu autoritären Überwachern. Doch wie man weiß, sieht ein Fisch sein eigenes Wasser nicht.
Die Ästhetik der Anklage
In einer Zeit, in der Diskurse mehr von Emotionen als von Argumenten geprägt sind, haben Worte wie „Faschist“ oder „Nazi“ ihre ursprüngliche Schärfe verloren. Sie wurden zu bloßen Etiketten, die man Gegnern aufklebt, um sie aus der Arena zu schubsen. Das Problem dabei? Wenn jede Abweichung, jede Opposition, jeder Zweifel faschistisch ist, dann ist irgendwann gar nichts mehr faschistisch. Das Wort wird entkernt, seines ursprünglichen Schreckens beraubt, bis es nichts weiter ist als ein rhetorischer Vorschlaghammer, der mehr Lärm als Wirkung verursacht. Und was bleibt am Ende übrig? Ein gesellschaftliches Klima, in dem keiner mehr wagt, das Wort zu ergreifen, aus Angst, mit dem falschen Etikett versehen zu werden.
Selbstmord der Kritik
Silones warnender Satz ist heute vielleicht aktueller denn je, nicht weil der Faschismus im herkömmlichen Sinne wiederkehrt, sondern weil wir vergessen haben, wie man ihn erkennt. Die wahren Feinde der Freiheit tarnen sich nicht mehr in Uniformen und Stiefeln, sondern in freundlichen Phrasen, inklusiven Logos und gut gemeinten Initiativen. Doch unter der glänzenden Oberfläche lauert derselbe alte Geist: der Zwang, die Welt in Gut und Böse zu teilen, die Unfähigkeit, Ambiguitäten zu ertragen, und der unbändige Drang, die eigene Wahrheit universell zu machen. Und so kehrt er zurück, nicht mit dem Marschtritt vergangener Tage, sondern im sanften Flüsterton, der sich stets als das Gegenteil von dem ausgibt, was er ist.
Die Pflicht zur Skepsis
Am Ende bleibt die Frage: Wie entkommen wir diesem neuen Tugendwahn? Die Antwort ist so schlicht wie unbequem: mit Skepsis. Skepsis gegenüber einfachen Antworten, Skepsis gegenüber moralischen Absolutismen, Skepsis auch gegenüber dem eigenen Drang, alles in Schubladen zu stecken. Vielleicht würde Silone heute mit einem leisen Lächeln anmerken, dass der Faschismus zurückgekehrt ist – in Gestalt derer, die sich am lautesten gegen ihn stellen. Doch wie jeder gute Satiriker wüsste auch er: Die Tragödie der Geschichte ist immer auch ihre Farce.