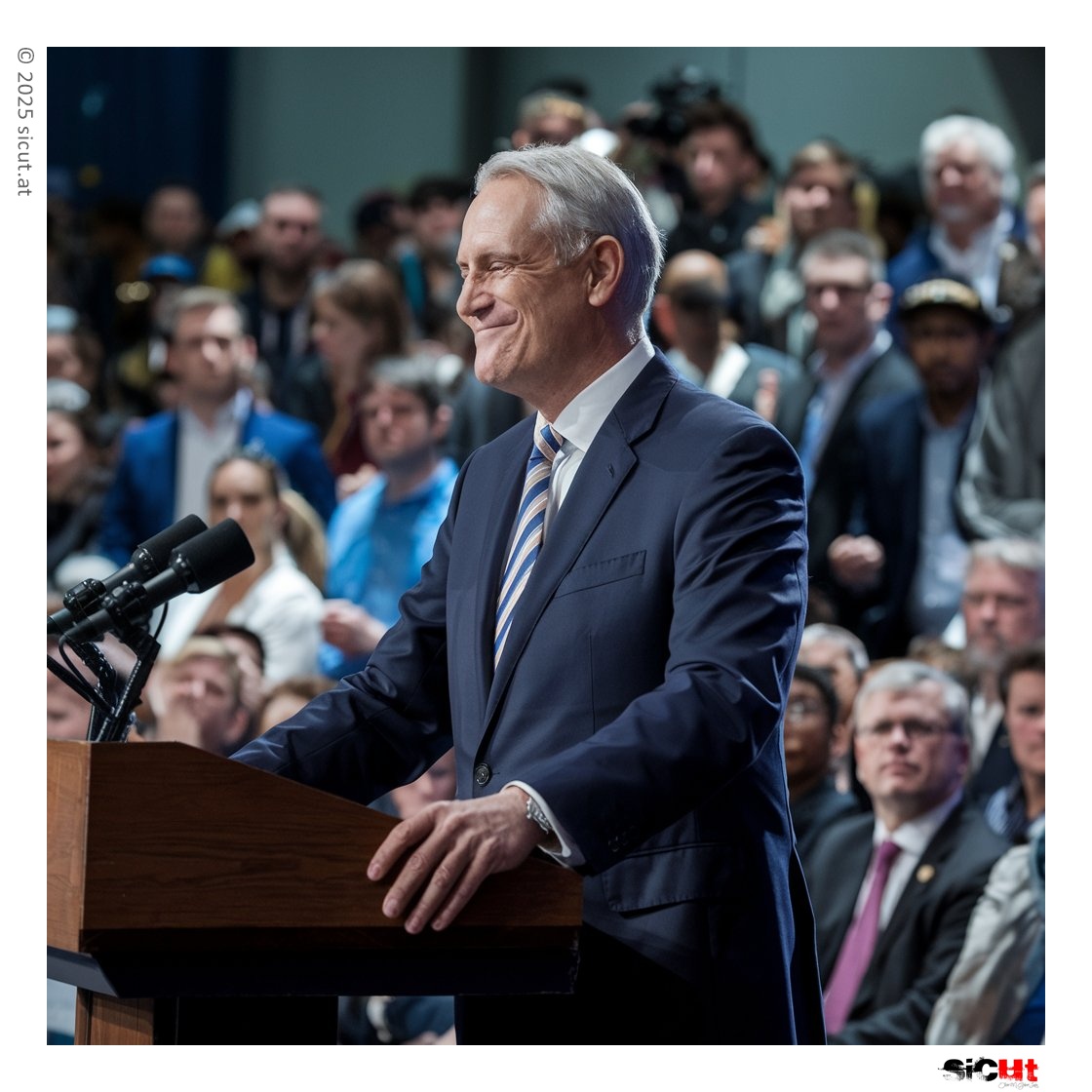Einführung in die Kunst der politischen Selbstfürsorge
Ein altes Sprichwort besagt: „Wer den Futtertrog bewacht, frisst zuerst.“ Und in der EU, diesem leuchtenden Paradebeispiel für demokratische Selbstkontrolle und fiskalische Zurückhaltung, nimmt man diese Weisheit sehr ernst. Denn während sich Otto Normalverbraucher in Brüssel durch die Bürokratielabyrinthe kämpft, um eine Subvention für seinen maroden Bauernhof oder eine Förderung für sein ambitioniertes Start-up zu ergattern, gibt es eine Elite, die sich gar nicht erst mit solchen profanen Dingen herumschlagen muss: die 66.000 Beschäftigten der EU-Institutionen. Ihnen fließt das Geld in zuverlässiger Regelmäßigkeit zu – und das mit einer Konstanz, die Schweizer Uhrmacher vor Neid erblassen lässt.
Eine Erhöhung jagt die nächste – und niemand fragt nach dem „Warum?“
Zum siebten Mal innerhalb von nur drei Jahren werden die EU-Gehälter nun angepasst. „Angepasst“ – welch wunderbar euphemistischer Begriff für das, was es wirklich ist: eine Gehaltserhöhung! Schließlich lebt es sich mit den drückenden Sorgen eines monatlichen Einkommens von 3.645 Euro (im schlimmsten Fall!) oder gar 34.800 Euro (im besten Fall!) nur schwerlich. Man stelle sich vor, man müsste mit diesem Kleingeld in Brüsseler Feinkostgeschäften überleben, eine Sommerresidenz in Südfrankreich unterhalten oder die internationalen Eliteschulen für den Nachwuchs bezahlen. Unvorstellbar!
Inflation? Die Gießkanne regelt das!
Doch halt – die Erhöhung kommt ja nicht aus heiterem Himmel. Es ist die Inflation, dieses böse Monster, das selbst die Elite nicht verschont. Und weil es der EU-Elite stets um Gerechtigkeit geht, hat man sich eine geniale Lösung überlegt: Anpassung zweimal jährlich! Im Januar und im Juli. Damit nicht genug: Wenn es im Vorjahr nicht ganz zur gewünschten Steigerung reicht, dann gibt es einfach eine Nachzahlung im April. Sozusagen der „Inflationsbonus Deluxe“ – ein Konzept, von dem sich Normalverdiener, Rentner und Selbstständige eine dicke Scheibe abschneiden könnten. Dumm nur, dass sie es nicht können. Denn für sie gibt es kein „automatisches Anpassungsmodell“, sondern nur die mühsame Hoffnung auf Tarifverhandlungen, gnädige Arbeitgeber oder großzügige Sozialleistungen.
Eine Managerin der Sonderklasse
Die EU-Kommissionspräsidentin selbst darf sich fortan über 34.800 Euro monatlich freuen – eine Summe, die sie sich durch unermüdliche Arbeit redlich verdient hat. Denn immerhin muss sie den Kontinent durch schwierige Zeiten steuern, sich mit unbequemen Fragen zur Demokratie in der EU und der Vergabe von Impfstoffverträgen auseinandersetzen und gleichzeitig noch ausreichend Zeit finden, um ihre persönliche Vision eines europäischen Superstaates voranzutreiben. Ein Knochenjob, der selbstverständlich gebührend entlohnt werden muss!
Die „Mäßigungsklausel“ – eine Sternstunde der EU-Logik
Aber, liebe Leser, haltet ein! Die EU hat ja tatsächlich Rücksicht genommen. Letztes Jahr hätte es nämlich eigentlich 8,5 Prozent mehr geben sollen – aber man wollte sich bescheiden zeigen und hat „nur“ 7,3 Prozent ausgeschüttet. Welch eine noble Geste! Die restlichen 1,2 Prozent kommen nun mit leichter Verzögerung. So sieht Verantwortungsbewusstsein in der Politik aus: Man genehmigt sich die Erhöhung einfach ein bisschen später. Vielleicht ein Vorbild für zukünftige Rentenreformen?
Ein Schlaraffenland ohne Grenzen
Was lernen wir also aus dieser Geschichte? Wer clever ist, sorgt dafür, dass er sein Geld nicht von einem knausrigen Arbeitgeber oder einer geizigen Rentenkasse bekommt, sondern direkt von der EU. Denn dort sitzt das Füllhorn so locker, dass selbst die biblische Manna-Versorgung dagegen wie ein karges Almosen erscheint. Und während die einfachen Bürger brav Steuern zahlen, auf Gehaltserhöhungen hoffen oder mit den realen Konsequenzen der Inflation kämpfen, sorgen die Brüsseler Eliten dafür, dass ihre eigenen Gehälter sich stets im Gleichschritt mit den steigenden Preisen bewegen – oder besser noch: ihnen vorauslaufen.
Wer also noch kein EU-Beamter ist, sollte dringend über eine Karriere in Brüssel nachdenken. Die Zukunftsaussichten sind rosig – und die Gehaltserhöhungen sind sicher!