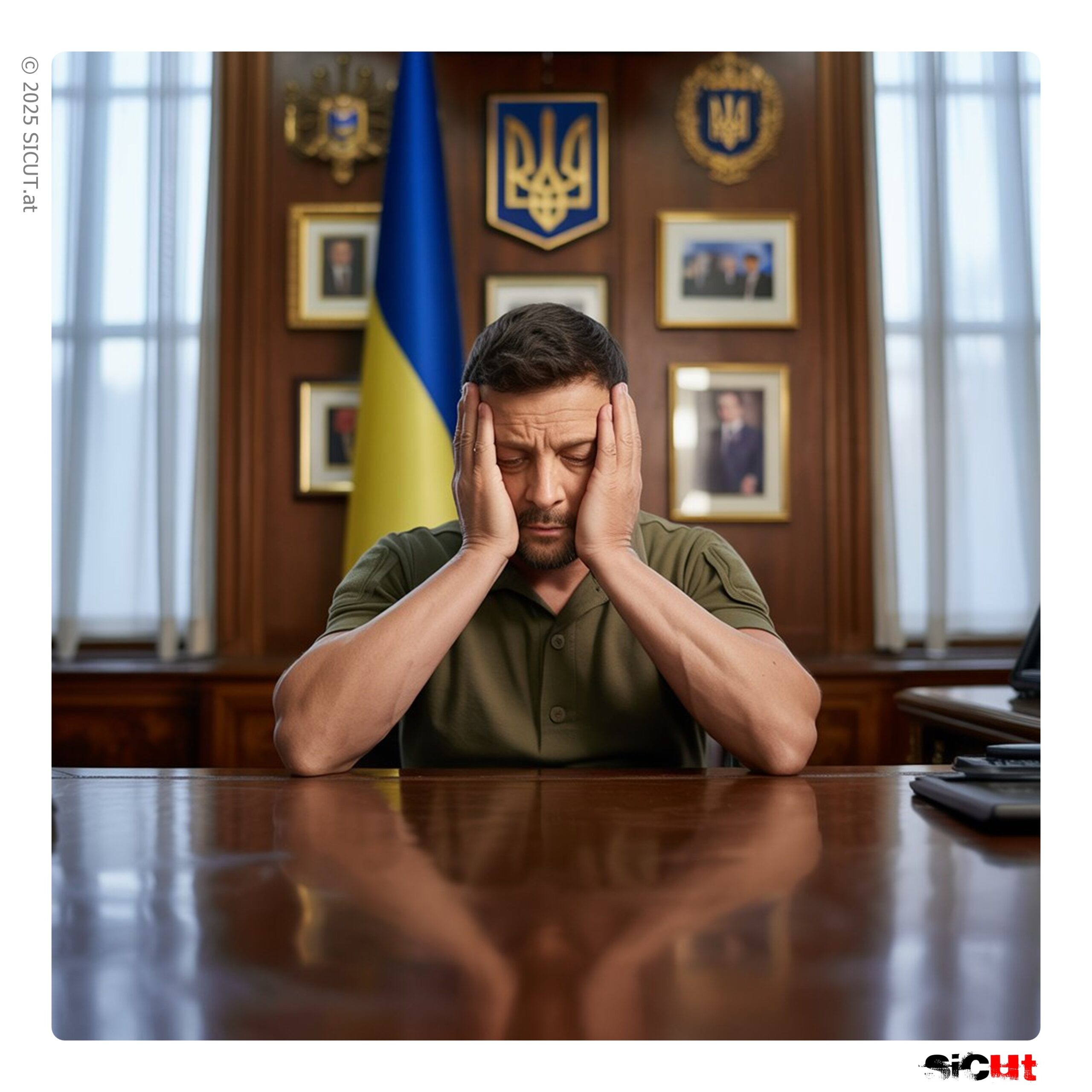Prolog der Aussichtslosigkeit
Es gehört zu den stillen Ironien unserer Epoche, dass Menschen, die sich für rational halten, regelmäßig an den Absprungpunkten ihrer eigenen Vernunft scheitern. Man könnte sagen, dass wir – als Zivilisation, als Gesellschaft, als verunsicherte Primaten mit Touchscreen-Abhängigkeit – schon lange im Stadium eines schlingernden Gedankenfahrzeugs unterwegs sind, dessen Bremsen quietschen und dessen Lenkrad verdächtig locker sitzt. Und dennoch fahren wir weiter, unbeirrbar und mit blitzender Selbstgewissheit, als hätten wir im Handschuhfach einen geheimen Masterplan verstaut, der uns aus dem unvermeidlichen Trümmerfeld herausführen wird.
Doch wir haben keinen Masterplan. Wir haben nur: Plan Z.
Der letzte Buchstabe des Alphabets, das post-heroische Rückzugsmanöver, die Option nach allen Optionen – und wahrscheinlich jene fatale Abkürzung, die man wählt, wenn man ahnt, dass sämtliche Abzweigungen davor in Sackgassen führten.
Ein „Plan Z“ ohne Wiederkehr, wohlgemerkt. Denn wer sich auf den letzten Buchstaben beruft, hat keine Absicht mehr, umzukehren; er hat bereits resigniert, aber auf eine so grandios entschlossene Art, dass sie fast beeindruckend wirkt – wie ein Untergang mit Choreografie, ein Finale, das die Pyrotechnik des Scheiterns zur hohen Kunst erhebt.
Vom Mythos der letzten Rettung
Der Mensch liebt bekanntlich das Narrativ der letzten Chance, jenes rührselige Drehbuch, in dem sich kurz vor dem Abspann eine jähe Wendung ereignet: Die Rakete zündet, der Held erkennt seinen Irrtum, die romantische Geste rettet die Beziehung, und das globale Chaos löst sich plötzlich in Wohlgefallen auf – als hätte die Welt nur auf den richtigen Filmmoment gewartet.
Doch „Plan Z“ verweigert sich strikt dieser dramaturgischen Trope.
Er ist das Anti-Happy-End, die Absage an den deus ex machina, die kalte Dusche für alle, die hoffen, dass sich der Lauf der Dinge irgendwie, irgendwo, irgendwann schon wieder einrenken werde.
Denn „Plan Z“ ist nicht die letzte Chance. Nein, er ist die erste akzeptierte Einsicht, dass Chancen überschätzt werden. Was uns bleibt, ist das lakonische Schulterzucken derer, die zwar noch wissen, wie man ein Ideal buchstabiert, aber sich nicht mehr erinnern können, weshalb man es ursprünglich tat.
Vielleicht liegt darin der wahre Kern dieser Endzeitromantik: Wir sehnen uns nach dem Schlussakkord, weil die Strophen davor so chaotisch waren, dass uns ein abruptes Ende fast wie Erlösung erscheint. Und vermutlich ist dies die einzige Funktion, die „Plan Z“ noch erfüllt – er ist weniger ein Plan als vielmehr eine tröstliche Etikette, ein Name für die Phase des endgültigen Nichts-tut-mehr-weh-Weil-Es-Ohnehin-Keine-Lösung-Gibt.
Die technokratische Kapitulation
Natürlich gibt es Menschen, die behaupten, „Plan Z“ sei in Wahrheit ein Listensystem, ein finales Protokoll, das unsere kollektive Selbstentzivilisierung ordnungsgemäß abwickeln soll. Bürokraten des Abgrunds, die in Tabellenkalkulationen das Ende strukturieren, während sie sich selbst auf die Schulter klopfen, weil immerhin ihr Formular fristgerecht ausgefüllt wurde.
Doch lassen wir uns hier keine Illusionen machen: Hinter der Sturheit dieser Technokraten verbirgt sich weniger Überzeugung als reine Höflichkeit gegenüber dem Chaos – ein Versuch, dem Untergang wenigstens die Würde einer letzten Signatur zu verleihen.
Es ist erstaunlich, mit welchem Ernst Menschen das Unumkehrbare verwalten. Da werden Ausschüsse gegründet, um die Lage „sorgfältig zu beurteilen“, Protokolle entstehen über das „effiziente Management“ von Katastrophen, und ganze Konferenzen widmen sich der Frage, ob man die Titanic nicht doch noch in ein schwimmendes Spa hätte umbauen können, während sie bereits in der Vertikalen versank.
„Plan Z“ ist der feierlich verkündete Moment, in dem sich selbst die kühnsten Optimisten eingestehen:
Wir werden das nicht mehr ordentlich lösen. Aber wir können es immerhin korrekt dokumentieren.
Die Psychologie des letzten Buchstabens
Zugegeben, „Z“ ist ein schöner Buchstabe. Er trägt eine gewisse grafische Entschlossenheit in sich, einen diagonalen Schwung, der energisch wirkt, als würde er vorspiegeln: Ich komme am Schluss, aber dafür komme ich schnell. Vielleicht fällt es uns deshalb so leicht, gerade diesen Buchstaben mit der Endgültigkeit unserer Lage zu verknüpfen. Seine Form erinnert an einen Blitzschlag, an einen letzten, abrupten, endgültigen Schnitt.
Interessanterweise beruhigt uns genau das:
Der Mensch findet Trost in klarer Endlichkeit.
Was wirklich Angst macht, ist das endlose Dazwischen – die Dauerprovisorien, die halben Lösungen, die unentschlossenen Kompromisse, diese unendliche Gegenwartsschleife eines „bald wird alles besser“, das niemals eintrifft.
„Plan Z“ ist daher paradox tröstlich: Er nimmt uns die lästige Hoffnung ab.
Endlich müssen wir nicht mehr optimistisch tun, endlich dürfen wir die Hände in die Taschen stecken und nachlässig sagen:
Ja, gut. Dann ist das jetzt eben so.
Eine Form von Resignation, die beinahe entspannend wirkt – wie das Geräusch, wenn man nach langem Kampf die weiße Fahne wäscht und feststellt, dass sie im Wind tatsächlich recht hübsch aussieht.
Von der Würde des Untergangs
Wer an „Plan Z“ denkt, stellt sich unweigerlich das Bild eines Endes vor, das gleichzeitig heroisch und absurd ist: eine Mischung aus griechischer Tragödie und Monty-Python-Sketch. Wir wissen, dass wir keine epischen Helden sind, aber wir können zumindest so tun, als würde unsere finale Fehlentscheidung literarischen Mehrwert generieren.
Vielleicht ist dies die letzte verbliebene Würde des modernen Menschen:
Auch im Scheitern will er glänzen.
Er möchte, dass sein Untergang nicht nur angemessen katastrophal, sondern auch kunstvoll, ironisch, vielleicht sogar stilvoll abläuft.
Und ja, vielleicht ist es gerade diese Sehnsucht nach ästhetischem Scheitern, die uns am Ende doch wieder sympathisch macht.
Wir wissen, dass wir uns verrannt haben.
Wir wissen, dass der Weg nicht zurückführt.
Wir wissen, dass „Plan Z“ kein Plan, sondern ein Abschied ist.
Doch wir gehen diesen letzten Weg mit einem gewissen Eleganzanspruch, mit einem wissenden Lächeln, das sagt:
Wenn wir schon untergehen, dann wenigstens mit Haltung, Witz – und der leisen Hoffnung, dass jemand später darüber schreibt.
Epilog ohne Rettung
„Plan Z ohne Wiederkehr“ ist also weniger eine Warnung als eine Diagnose.
Er ist das intellektuelle Eingeständnis, dass wir als Spezies das freiwillige Abonnement des Abgrunds abgeschlossen haben – ohne Kündigungsfrist, aber mit Bonusmeilen für jede zusätzliche Absurdität.
Doch vielleicht – und dies ist die letzte Ironie, die uns bleibt – ist genau dieses Erkenntnisvermögen unsere verbliebene Form von Freiheit.
Denn wer weiß, dass es keine Wiederkehr gibt, ist seltsam entlastet. Der Weg mag enden, aber endlich ist er klar. Die Zukunft mag dunkel sein, aber sie ist wenigstens eindeutig.
Und so schreiten wir hinab, nicht mehr mit der Hybris der Unbesiegbaren, sondern mit der sarkastischen Heiterkeit jener, die aus ihrem Scheitern eine Pointe machen – und aus ihrer Pointe einen kleinen Triumph.
Denn wenn uns schon der Wiederkehr die Tür versperrt bleibt, so bleibt uns doch die Möglichkeit, den letzten Schritt mit erhobenem Haupt zu tun.
Und manchmal, in seltenen Momenten, ist das fast genauso viel wert wie ein Ausweg.