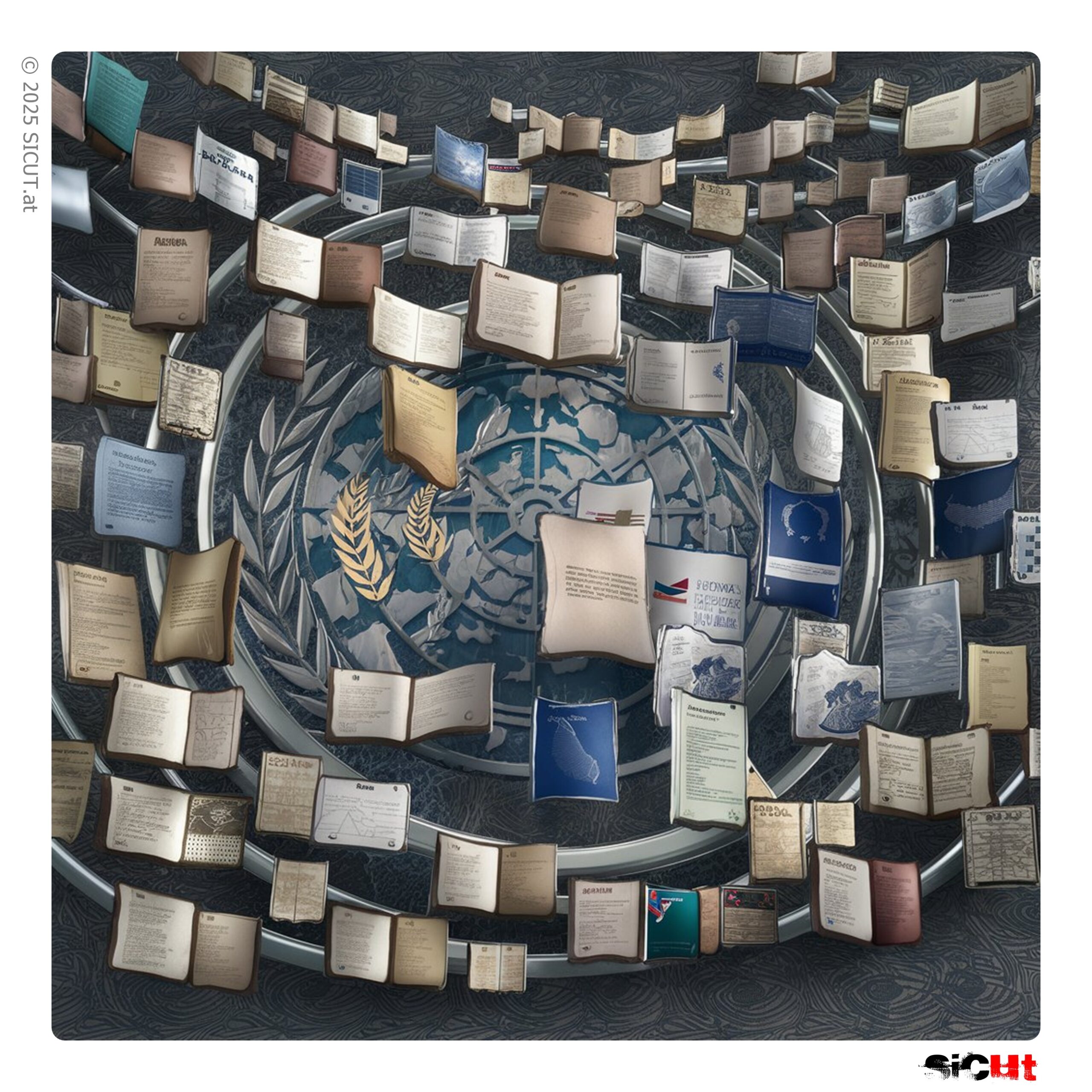Es klingt ja erstmal harmlos. Fast charmant. Sondervermögen. Als würde irgendwo im Tresor des Finanzministeriums ein besonders guter Jahrgang Rotwein lagern, der nun für etwas Besonderes geöffnet wird – ein großes Fest, vielleicht sogar für das Volk. 500 Milliarden Euro – das ist eine Summe, bei der sogar Hedgefonds die Stirn kraus ziehen. Und man könnte meinen, ein so gigantisches Budget sei doch – ganz naheliegend – gedacht für die Heilung all jener Wunden, die dieses Land seit Jahrzehnten vernarben lässt: bröckelnde Schulen, verrottete Brücken, Zugverspätungen, deren Komik längst zur Tragik mutierte.
Doch wer sich mit funkelnden Augen der Illusion hingibt, dass dieses Sondervermögen unser Leben verbessern soll – wer glaubt, dass damit die Kita-Plätze kommen, die Glasfaserkabel, die barrierefreien Bahnhöfe, die wohnliche Zukunft – der glaubt vermutlich auch, dass Politiker nachts von Bürgerwohl träumen.
Denn wie sich herausstellt, geht es bei diesem Geld nicht etwa um Lebensqualität. Es geht um Kriegsqualität. Oder, wie man es in den Pressetexten nennt: Verteidigungsfähigkeit durch infrastrukturelle Resilienz im Bündnisfall. Auf gut Deutsch: Deutschland wird NATO-Durchmarschstraße. Willkommen im Land der rollenden Panzer – möglichst klimaneutral natürlich.
Die Wiederverzauberung des Schienenverkehrs – jetzt mit Leopard-Logistik
Wer hätte gedacht, dass die Bahn eines Tages doch wieder sexy wird? Nicht für Pendler natürlich – deren tägliches Leid wird auch von 500 Milliarden nicht gemildert. Die ICEs werden weiterhin wegen „technischer Störungen im Betriebsablauf“ stehen bleiben wie maulende Esel. Nein, es ist die Bundeswehr, die sich freut. Endlich bekommen wir wieder ein Schienennetz, das funktioniert – allerdings primär für den Zweck, Panzer quer durch das Land zu verfrachten, im Idealfall in Richtung Osten.
Während der gewöhnliche Bürger im Fernverkehr mit einer verkrüppelten App um Sitzplatzreservierungen kämpft, wird im Hintergrund längst geprobt, wie schnell ein Truppenverband von Rheinland-Pfalz nach Litauen kommt – inklusive Brückenbelastungstests, NATO-Streckenanalysen und „militärischer Durchleitungsrechte“, die in keinem Sommerinterview angesprochen werden.
Die Vision ist also klar: Während Oma Hilde auf Bahnsteig 7 ihren Anschluss verpasst, rattert auf Gleis 8 ein Munitionszug vorbei – pünktlich, zuverlässig und völlig emissionskompensiert. Deutschland 2025: Die Bahn kommt. Für den Krieg.
Autobahnen für den Angriff – Betonierte Bündnistreue
Natürlich betrifft das auch die Autobahnen, dieses Symbol der deutschen Ingenieurskunst, das einst für Freiheit stand und heute primär für Baustellen und Funklöcher. Das Sondervermögen wird auch hier eingreifen – aber nicht etwa, um die Mobilität der Menschen zu verbessern, sondern um die „Verlegefähigkeit schwerer Verbände“ sicherzustellen. Das ist keine Theorie. Das steht so in den Planungen.
Was der Durchschnittsbürger als 12 Kilometer langes, nervenzermürbendes Verkehrschaos erlebt, ist in Wahrheit ein strategisches Trainingsfeld. Die rechte Spur ist nicht verstopft – sie ist verteidigungsbereit. Die Raststätten an der A2? Logistische Knotenpunkte. Das Autobahnkreuz Köln-Ost? Ein möglicher Umschlagplatz für Nachschub im Fall des „Artikel-5-Szenarios“.
Wer also glaubt, die Verkehrswende sei dazu gedacht, dass der Mensch schneller, sicherer oder klimafreundlicher von A nach B kommt, hat das neue Narrativ nicht verstanden: Die wahre Mobilitätswende bedeutet, dass das Kriegsgerät im Stau den Vorrang bekommt – mit Blaulicht, Panzerkette und Bündnistreue im Tank.
Die Inszenierung der „wehrhaften Demokratie“ – mit Beton und Brüssel
Natürlich wird das Ganze nicht als Kriegsvorbereitung verkauft. Nein, man spricht von „Resilienz“, von „Bündnisfähigkeit“, von „Sicherstellung der Verteidigungslogistik“. Und wer dagegen den Mund aufmacht, wird sehr schnell mit der Replik abgekanzelt: Willst du etwa, dass Putin durchmarschiert? Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht wollen einige Menschen auch einfach nicht, dass der nächste europäische Großkrieg durch Deutschland durchmarschiert – egal in welche Richtung.
Das Sondervermögen Infrastruktur ist keine Investition in Frieden. Es ist eine Investition in Kriegstauglichkeit – moralisch aufgeladen, medial flankiert, demokratisch kaum debattiert. Und es ist Teil eines größeren Spiels: Deutschland, der bröckelnde Riese, soll wieder funktionsfähig gemacht werden – nicht als Heimat, sondern als Operationsbasis.
Die europäische Integration findet inzwischen auf Beton statt. Wer Brücken baut, tut es nicht mehr für Menschen, sondern für Marschkolonnen. Wer Gleise legt, plant nicht den Schülertransport, sondern das Gefechtsfeld. Und wer Budget bewilligt, tut es nicht mehr mit Blick auf Gemeinwohl, sondern auf die Gefechtsbereitschaft bis 2030.
Historischer Schatten: Von der Völkerverständigung zur Verlegeplanung
Man könnte sagen, das alles sei pragmatisch. Man könnte auch sagen, es sei fatal. Denn wer ein wenig Geschichtsbewusstsein besitzt – und das sollte man in diesem Land tunlichst mitführen wie einen gültigen Fahrschein – weiß, dass Infrastruktur nie neutral ist. In jedem Reich, in jeder Epoche, wurden Straßen, Gleise und Brücken nicht nur gebaut, um Menschen zu verbinden, sondern um Truppen zu bewegen. Die Römer wussten das. Napoleon auch. Und Deutschland? Hat Erfahrung. Leider.
Dass sich ausgerechnet dieses Land – nach zwei Weltkriegen, nach Auschwitz, nach dem Schwur „Nie wieder“ – heute wieder in Infrastruktur für Frontlinien investiert, ohne dass es einen Aufschrei gibt, ist ein zivilisatorischer Tiefpunkt, verpackt in PR-Sprech.
Die Vorstellung, dass deutsche Züge in litauische Gefechtszonen rollen, weil Berlin sie dazu ertüchtigt hat, ist nicht nur politisch problematisch. Sie ist moralisch obszön. Und sie wird verkauft wie ein Upgrade auf dem Digitalgipfel.
Pointe ohne Trost: Das Leben wird nicht besser, aber der Krieg pünktlicher
Am Ende bleibt ein bitteres Fazit: Das Leben der Menschen in diesem Land wird durch diese Investition nicht einfacher, nicht gerechter, nicht lebenswerter. Wer morgens um sechs im Regionalzug friert, weil die Heizung wieder ausfiel, wird auch in zehn Jahren keine Wärme spüren – außer vielleicht die Resthitze eines Tieffliegers.
500 Milliarden Euro – die größte Einzelinvestition seit Generationen – fließt nicht in das, was dieses Land zusammenhält. Sondern in das, was es kampffähig macht. Man hat nicht Schulen gebaut, sondern „Anfahrtsachsen“ für Bündnistruppen. Man hat keine Zukunft geschaffen, sondern Durchmarschräume.
Und das alles unter dem Banner der „Sicherheit“. Aber Sicherheit wovor? Vor dem Feind, der am Horizont inszeniert wird – oder vor der Wahrheit, dass ein Land, das seine Infrastruktur nur noch aus der Perspektive der NATO denkt, längst nicht mehr zukunftsfähig, sondern bloß noch aufmarschfähig ist?
Der Krieg kommt vielleicht nie. Aber die Vorbereitung ist längst da. Und sie rollt, pünktlicher als jeder Nahverkehrszug, mitten durch das Herz der Republik.