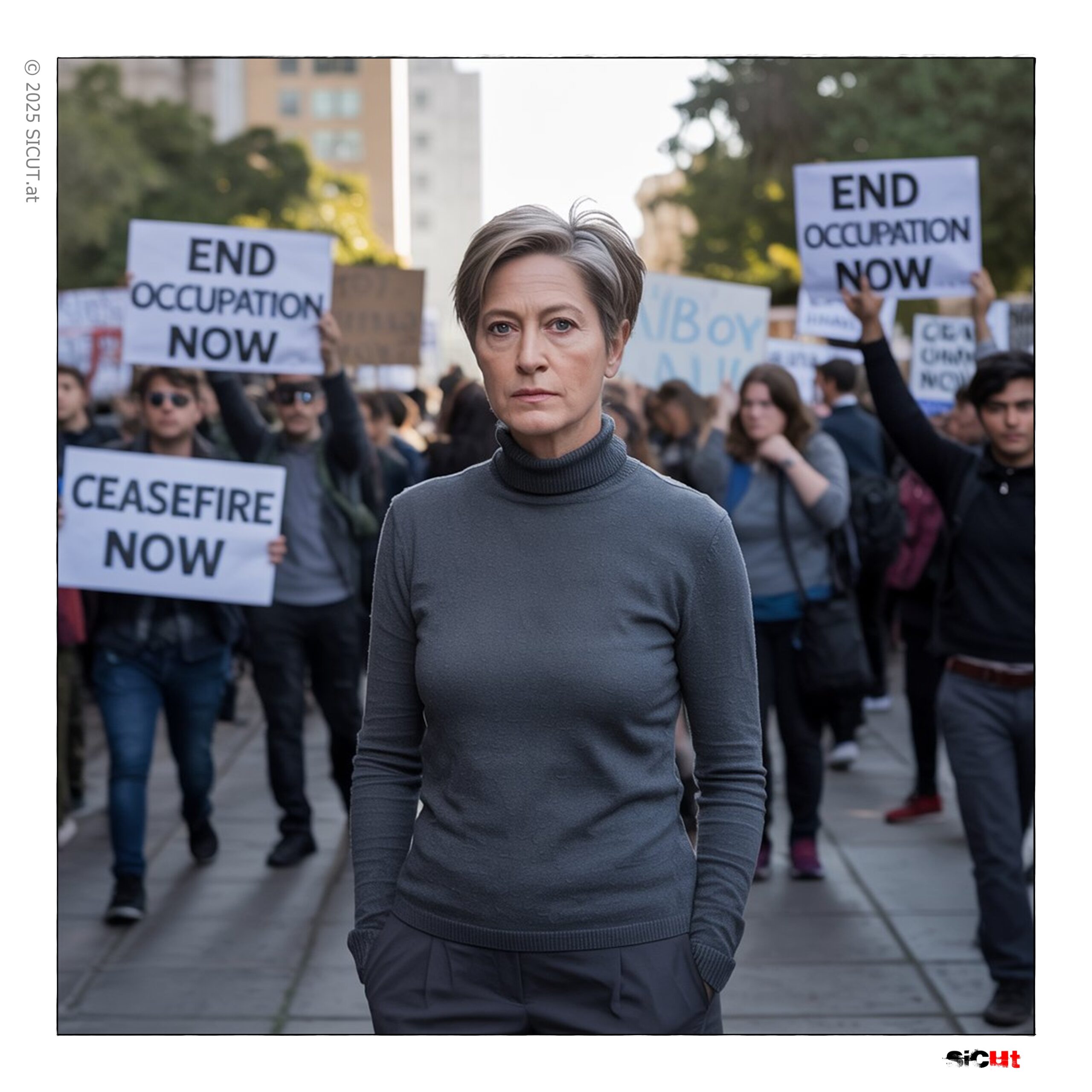Vom Schlaraffenland der Kriegsökonomie: Die Mär vom Krieg ohne Schweiß, ohne Ruß, ohne Werkbank
Der „Economist“, jenes immer leicht britisch-herablassend grinsende Wochenblatt der Globalisierungseliten, hat wieder einmal in die Zukunft geblickt – und dabei aus Versehen in den Rückspiegel geschaut. Es verkündet, mit jener blendend arroganten Sicherheit, die man sich nur leisten kann, wenn man beim Mittagessen gleichzeitig über Staatsanleihen und Gin-Cocktails parlieren darf, dass der Westen den Krieg neu erfunden hat. Genauer: den Krieg ohne Fabriken, ohne Arbeiter, ohne das ölige Gestöhne von Zahnrädern.
Die Ukraine liefert den Anlass, der Economist liefert die Deutung: Man kann heute Kriege führen, ohne sich mit dem lästigen Ballast einer produzierenden Wirtschaft herumzuschlagen. Der „Komplexe post-industrielle Krieg“ lautet das neue Paradigma. Waffen kommen künftig aus PowerPoint-Präsentationen, Rüstungsproduktion ist ein Software-Update, Drohnen werden bei Amazon bestellt (Prime-Shipping selbstverständlich inklusive). Und falls es doch einmal an Raketen mangelt? Dann ruft man Lockheed Martin an – oder besser noch: man ruft an und lässt den Anrufbeantworter sprechen, während man mit Raytheon schon den nächsten Zoom-Call plant.
So klingt es jedenfalls, wenn ein Londoner Finanzjournalist mit Oxford-Diplom über Artillerieproduktion philosophiert. Das Schöne an dieser Sichtweise: Sie befreit uns von der lästigen Realität der Materialschlachten. Wer noch an Stahlwerke denkt, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Der neue Krieg ist clean, digital und vor allem: ausgelagert. Es braucht keine Arbeiterklasse mehr, um ihn zu gewinnen – nur noch Berater, Cloud-Dienste und ETFs mit Rüstungsaktien.
Der Krieg als Cloud-Service: Militärischer Sieg im Abo-Modell
Natürlich, der Artikel drückt es etwas geschmeidiger aus. Der „Economist“ wäre ja nicht der „Economist“, wenn er nicht den neoliberalen Duktus in Reinform beherrschen würde. Da liest sich das dann so: Der Westen muss nicht mehr wie im Zweiten Weltkrieg Fabriken im Akkord umstellen, Frauen an die Fließbänder beordern, Aluminium rationieren oder Nachtschichten in der Munitionsfabrik schieben. Heute erledigen das Märkte und modulare Lieferketten. Wer braucht schon industrielle Kapazitäten, wenn man ein globales Sourcing-Netzwerk hat?
Panzerketten aus Südkorea, Halbleiter aus Taiwan, Zielsuchsysteme aus Kalifornien, Schrauben aus Mexiko, Software-Updates aus Israel – fertig ist das post-industrielle Waffensystem. Der Krieg als Cloud-Service.
Man stelle sich das Szenario vor: Während im Donbass Granatsplitter regnen, läuft im Pentagon das nächste Procurement-Meeting. Man klickt sich durch ein paar Slides, entscheidet zwischen Option A (etwas teurer, aber schneller lieferbar) und Option B (etwas günstiger, aber leider mit 6 Wochen Lieferzeit, da gerade der Containerhafen in Schanghai blockiert ist). Krieg als Betriebswirtschaft. Supply Chain Management mit Todesfolge.
Der Scharfsinn dieses Gedankens liegt natürlich darin, dass er niemandem wehtut – zumindest nicht den westlichen Lesern des „Economist“. Der post-industrielle Krieg hat keine verschwitzten Arbeiter mehr, keine Munitionsfabriken, keine Schlote. Er hat nur noch Algorithmen, Grafiken und Wertschöpfungsketten. Krieg als betriebswirtschaftliche Optimierungsaufgabe.
Die entfesselte Simulation: Warum der „Economist“ immer noch an die unsichtbare Hand glaubt – auch wenn sie inzwischen eine Drohne steuert
Das ist, mit Verlaub, eine ebenso absurde wie konsequente Fortschreibung der neoliberalen Religion. Der Markt wird es schon richten – selbst den Krieg. Rüstung als globalisierter Just-in-Time-Prozess, munitioniert von Start-ups, die gerade noch an der Blockchain gebastelt haben, jetzt aber Drohnenplattformen für den Verteidigungsmarkt bauen. Die Supply Chain der Gewalt ist angeblich so stabil, dass es keiner „Kriegswirtschaft“ im klassischen Sinne mehr bedarf.
Man könnte lachen, wenn es nicht so tragisch wäre. Denn was der „Economist“ hier skizziert, ist nicht nur ein techno-optimistisches Märchen – es ist eine Einladung zur Verantwortungslosigkeit.
Die Ukraine verbraucht Artilleriegranaten im Tempo der industriellen Hölle, der Westen liefert sie im Tempo der PowerPoint-Konferenz. Warum? Weil eben doch keine moderne Kriegsführung ohne industrielle Basis funktioniert. Die Lager sind leer, die Produktionslinien veraltet, die Arbeitskräfte fehlen. Aber der „Economist“ macht daraus eine Tugend: Wir haben die Rüstungsindustrie verschlankt! Wir müssen nicht mehr selbst bauen, wir können delegieren, auslagern, verschieben – auf morgen, auf übermorgen, auf irgendwen.
Zwischen Silicon Valley und Stahlwerk: Die bittere Pointe der digitalen Kriegsführung
Was der „Economist“ wirklich sagt, wenn er schreibt, dass der Westen aufrüsten kann, ohne sich zu re-industrialisieren? Er sagt: Wir wollen das mit dem Krieg schon machen – aber bitte ohne schmutzige Hände. Kein Stahl, kein Schweiß, keine Werkbank. Nur noch KI, Plattformen, Netzwerkzentrierung. Der Krieg der Zukunft soll so sauber aussehen wie ein Apple Store.
Doch die Realität ist bekanntermaßen störrisch. Sie besteht aus Lieferengpässen, aus Mangel an Facharbeitern, aus rostenden Fertigungshallen, die sich nicht mit Excel-Tabellen ersetzen lassen. Die Waffenproduktion ist keine PowerPoint-Präsentation. Sie ist Industrie – ob es dem „Economist“ gefällt oder nicht.
Die zynische Pointe: Während der Westen noch darüber sinniert, wie man den Krieg möglichst effizient ins Digitale outsourcen kann, re-industrialisiert sich der Osten längst wieder. Russland stampft Munitionsfabriken aus dem Boden, China baut Werften im Akkord, und der Westen? Der optimiert weiter seine Slides.
Fazit: Post-industrieller Krieg ist wie Diät-Schokolade – klingt gut, funktioniert nicht
Der „Economist“ hat mal wieder gezeigt, was er am besten kann: Das Unangenehme wegmoderieren. In der eigenen post-industriellen Komfortzone wird der Krieg zum Software-Problem umgedeutet. Bloß keine schmutzigen Hände, bloß keine soziale Frage. Krieg als Dienstleistung, Sieg als PowerPoint-Möglichkeit.
Die Frage bleibt: Was will uns der „Economist“ damit sagen?
Antwort: „Keine Sorge, ihr müsst nichts ändern.“
Und das, man ahnt es, ist genau das Problem.