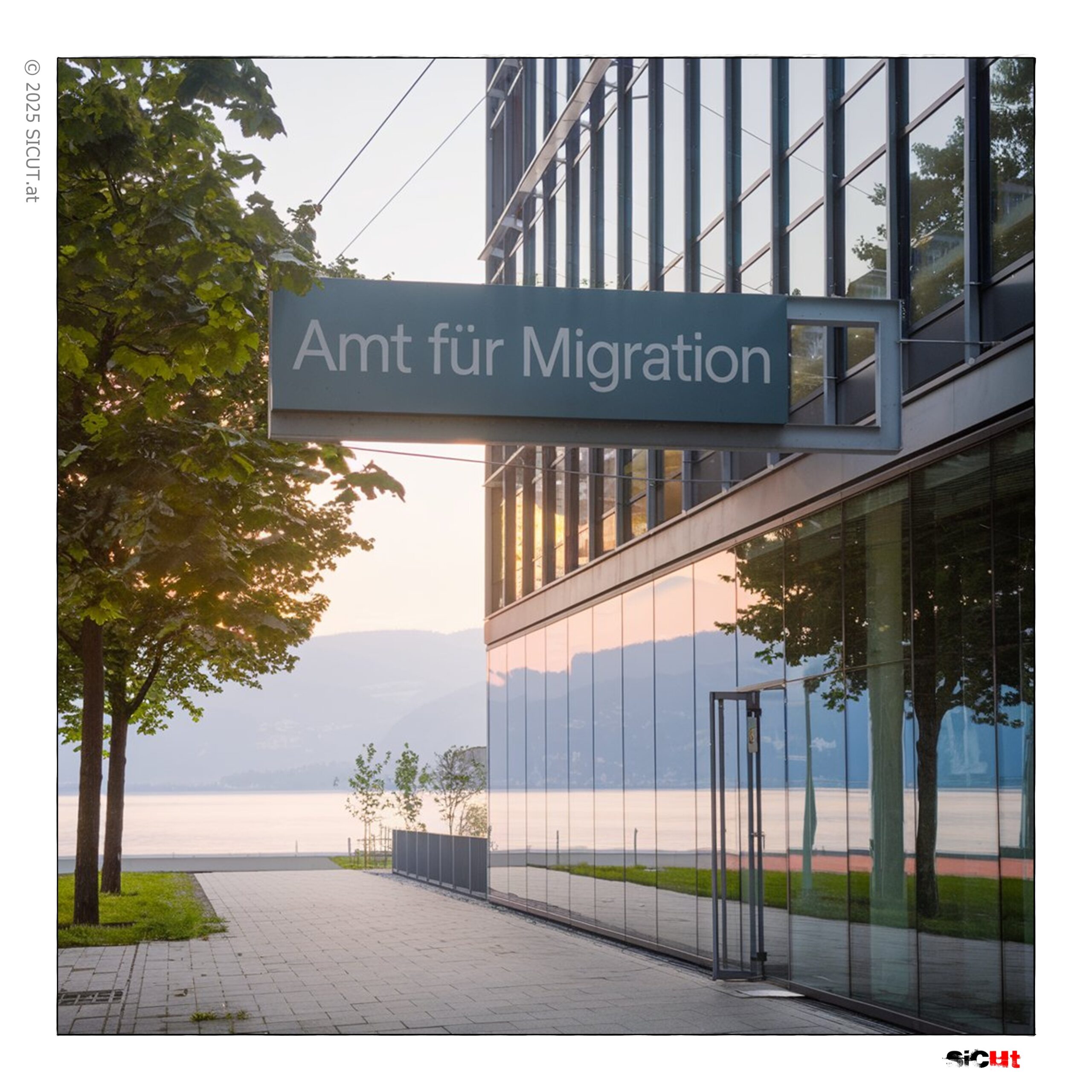Kulinarische Katastrophen in der postironischen Empfindlichkeitsgesellschaft
Es war einmal ein Koch, der dachte, es ginge ums Kochen. Welch rührender Irrtum.
John Torode, der australisch-britische Fernsehkoch mit der Stimmlage eines rostigen Woks und der Aura eines stets leicht überwürzten Schweinebratens, wurde aus den luftigen Höhen der Fernsehunterhaltung in die zähe Brühe der gesellschaftlichen Ächtung geschleudert. Der Grund? Nicht eine schlecht gebratene Jakobsmuschel. Nicht der Fauxpas, bei einem „MasterChef“-Finale Koriander mit Petersilie verwechselt zu haben. Nein, viel schlimmer: Der Mann benutzte, so die bestätigte Anschuldigung, einen „extrem beleidigenden rassistischen Ausdruck“. Was genau er sagte, bleibt—wie es sich für unsere moderne Medienethik gehört—in der Schwebe, zwischen Geheimhaltung, journalistischer Zurückhaltung und der süffisanten Suggestion des Schlimmstmöglichen. Das Publikum darf sich den Ausdruck selbst ausmalen, und seien wir ehrlich: Es tut es mit Leidenschaft.
So wurde aus Torode, dem Küchenonkel der Nation, über Nacht ein kulinarischer Paria, ein aus dem Fernsehen exkommunizierter Küchenketzer, der nicht mehr am Pass steht, sondern am Pranger.
Cancel Culture oder: Die Guillotine hat jetzt WLAN
Man muss sich das vorstellen: Der Mann, der jahrelang genüsslich zwischen Bœuf Bourguignon und Pavlova-Baiser vermittelte, steht nun am medialen Pranger, als wäre er mit einem Löffelchen Foie Gras durch den moralischen Minenpark der Gegenwart gestolpert. Die postironische Gesellschaft duldet keine Ausrutscher, schon gar keine sprachlichen. Worte sind nicht länger Werkzeuge der Verständigung, sondern Stolperdrähte sozialer Hinrichtung. Wer sie falsch setzt, wird nicht korrigiert, sondern vernichtet.
„Es war ein Fehltritt“, sagen die einen. „Es war unverzeihlich“, sagen die anderen. Und alle zusammen klicken, teilen, posten und genießen die kollektive Moralschau mit der gleichen sadistischen Wollust, mit der sie früher bei MasterChef den schlecht pochierten Lachs auseinandernahmen. Früher flog der Kandidat, jetzt der Moderator. So viel Demokratie muss sein.
Der soziale Totalschaden als Volkssport
Die Geschwindigkeit der Entrüstung ist dabei das eigentlich Bemerkenswerte. Früher reichte ein Shitstorm für eine Woche, heute braucht es den Exitus innerhalb von 24 Stunden. Es ist, als hätte man die Empörung industrialisiert: Massenproduktion von Empfindlichkeit, Fließbandfertigung moralischer Entrüstung, mit Overnight-Shipping ins kollektive Bewusstsein.
Der Torode-Fall zeigt das Prinzip in Reinform: Ein Satz, ein Ausdruck, ein toxisches Wort—und der Mensch wird auf seine schlimmste Sekunde reduziert. Sein Lebenswerk? Nebensache. Seine Verdienste? Obsolet. Der prallgefüllte Teller mit marinierten Garnelen und Estragon-Schaum? Verpufft wie ein zu schnell flambierter Crêpe Suzette.
Der Preis der Reinheit: Selbstkannibalisierung als gesellschaftliches Ritual
Man könnte sich fragen: Warum gerade jetzt? Warum so heftig? Warum so endgültig?
Die Antwort ist einfach: Wir leben in einer Zeit der hypermoralischen Selbstdarstellung, in der jeder kleine Fehltritt als Gelegenheit dient, den eigenen ethischen Reinheitsgrad öffentlich zu demonstrieren. Der „extrem beleidigende Ausdruck“ wird dabei nicht nur John Torode angelastet, sondern dient als Spiegel für alle anderen, um sich selbst möglichst fleckenlos zu zeigen. Das Internet ist nicht mehr das globale Dorf, es ist das globale Kloster. Und der moralische Ablasshandel floriert besser als im Mittelalter.
Ironischerweise ist diese Art der kollektiven Reinheitsprüfung auch eine Form des Kannibalismus: Man frisst den eigenen Helden auf, weil man sich seiner moralischen Unversehrtheit so sicher sein möchte, dass man lieber alle möglichen Gefährder ausmerzt, bevor das eigene Bild Risse bekommt. Torode? Weg damit. Sicher ist sicher.
Humor als letzte Zuflucht: Satire in Zeiten des Moralfurors
Und hier kommt der bittere Witz an der ganzen Sache: John Torode, der Mann, der früher über verkochte Pasta die Stirn runzelte, ist nun selbst in der gesellschaftlichen Mikrowelle geendet, auf höchster Stufe, ohne Abdeckung, spritzend, dampfend, bis das soziale Fett an den Wänden klebt. Die Ironie könnte man kaum schärfer würzen.
Man hätte es auch anders machen können. Eine Entschuldigung, ein Dialog, eine Reflexion über Sprache, Verantwortung, die Grenzen des Sagbaren. Aber das setzt eine Gesellschaft voraus, die Gespräch sucht, nicht Exekution. Leider ist der Humor, den man bräuchte, um das auszuhalten, längst ausverkauft. Die Regale der Satire sind leergefegt, der Bestand rationiert. Lachen darf nur noch, wer vorher die Reinheitsprüfung bestanden hat.
Fazit: Das Menü der Zukunft – Lauwarm, fade, garantiert unanstößig
Was bleibt? Wahrscheinlich ein Fernsehprogramm der Zukunft, in dem Moderatoren mit stoischer Miene glutenfreie Quinoasalate besprechen, ohne einen einzigen Witz, ohne eine einzige Floskel, garantiert ohne jedes Risiko. Die Kamera schwenkt auf den Teller, nicht auf den Menschen. Das ist sicherer. Der Mensch ist unberechenbar. Der Quinoasalat nicht.
John Torode ist der neueste Eintrag auf der Liste der medial Geköpften. Aber keine Sorge, der nächste Kandidat steht schon bereit. Die Guillotine des Zeitgeists hat keinen Wartungsbedarf, sie läuft auf Hochtouren. Sie braucht nur ein falsches Wort – und der Rest erledigt sich von selbst.
Bon Appétit.