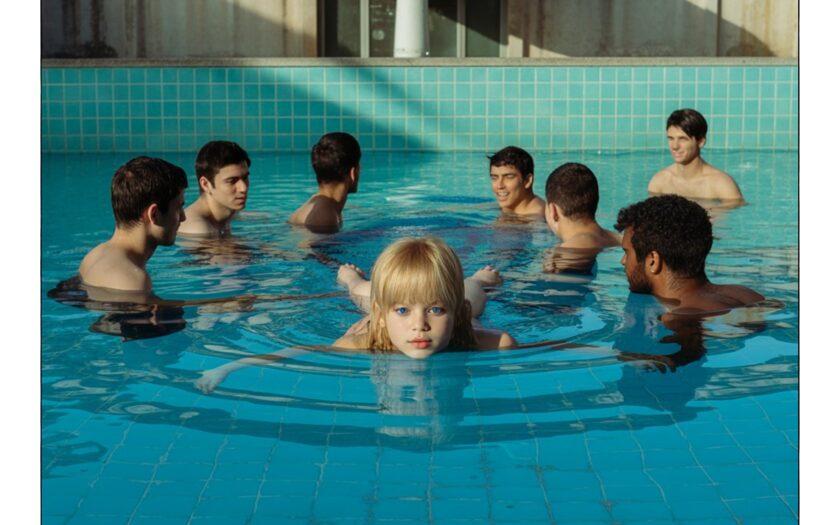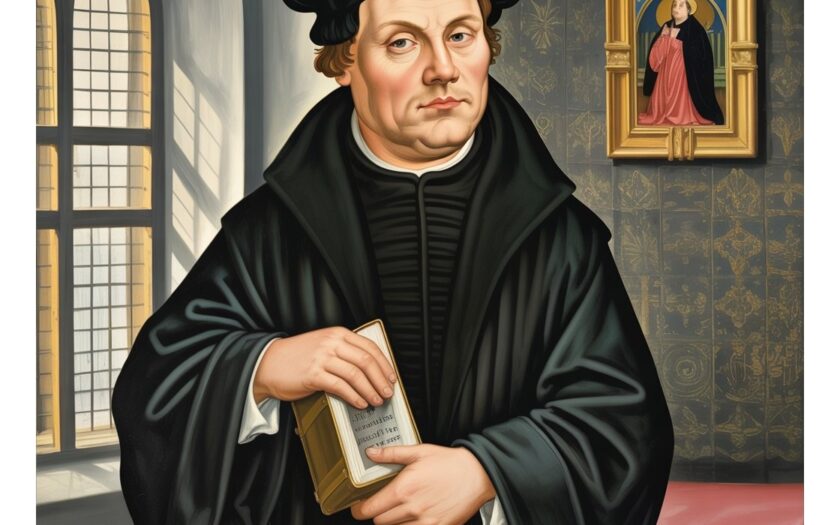Willkommen in der strahlenden Zukunft
Ah, Deutschland im Jahr 2030 – das Land der Dichter, Denker und natürlich: der digitalen Punktejäger! Haben Sie schon gehört? Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im August 2020 die Studie „Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land“ veröffentlicht. Klingt spannend, oder? Nein? Keine Sorge, die wahren Stars des 21. Jahrhunderts sind längst nicht mehr die Dichter oder Denker, sondern die Punktesammler. Und hier liegt die Krux: Die Zukunft, liebe Leserinnen und Leser, ist digital, partizipativ und natürlich freiwillig – so sagt man es jedenfalls, wenn man in Berlin den neuesten Entwurf des digitalen Bonussystems vorstellt.
Denn nichts schreit so sehr nach Freiheit wie ein freiwilliges Punktesystem, das jeden unserer Schritte misst, bewertet und anschließend liebevoll in bonifizierte oder mit Abzügen versehene Alltagshandlungen umwandelt. Ein digitales Nervensystem, das uns wie durch liebevolle, unsichtbare Fäden lenkt, wobei jeder Klick, jede Mülltrennung und jede Abgasreduktion in glänzenden Punkten belohnt wird. Wie modern! Wie demokratisch! Und vor allem: wie unverzichtbar. Man könnte fast sagen, es ist das neue Alphabet der Bürgerpflichten.
Vom Digital Service Act zum digitalen Strafzettel
Doch bevor wir zu euphorisch werden: Das digitale Punktesystem steht nicht allein. Es ist eingebettet in einen cleveren, europäischen Rahmen, der bereits jetzt mit dem Digital Service Act (DSA) eine neue Ära der Kontrolle einläutet. Dieser Akt, so heißt es offiziell, soll „einen sicheren und transparenten digitalen Raum“ schaffen – also nichts anderes als die Bühne bereiten für die ganz großen digitalen Überwachungsschlösser.
Der DSA ist mehr als nur ein bürokratischer Akt – er ist der erste Schritt, um die Bürger*innen im Netz nicht nur zu beobachten, sondern auch zu steuern. Inhalte, Verhalten, Daten – alles wird gezählt und in Form von Punkten bewertet. Nicht von ungefähr heißt es in den offiziellen Umsetzungsplänen: „Ein sicheres, digitales Ökosystem erfordert klare Anreize für positives Verhalten und konsequente Sanktionen für negative Aktionen.“
Ob das bedeutet, dass künftig nicht nur die Mülltrennung, sondern auch das Online-Verhalten (Fake News? Minuspunkt!) in die Punktwertung einfließt, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Wer im Netz zündet, wird virtuell ausgezündet.
Bargeldgrenzen und der Abschied vom letzten Refugium der Freiheit
Aber es wird noch subtiler: Begleitend zur Digitalisierung der Verhaltenskontrolle sinken die Bargeldgrenzen immer weiter. War es früher eine Frechheit, Beträge über 10.000 Euro bar zu begleichen, so wird bald jeder größere Bargeldverkehr unter die Lupe genommen. Nicht zur Verfolgung von Kriminalität, sondern zur „Effizienzsteigerung der Bonusvergabe“, versteht sich.
Der Abschied vom Bargeld ist nicht weniger als die Ablösung des letzten privaten Freiraums. Bargeldlos zu zahlen bedeutet, sich im gläsernen Netz zu bewegen, wo jeder Euro mit einem digitalen Fußabdruck versehen wird. Und hier kommt der digitale Euro ins Spiel, die Währung der Zukunft – dezentral kontrolliert und zentral gesteuert.
Der digitale Euro: Punkte sammeln mit Geld, das selbst Punkte vergibt
Der digitale Euro ist mehr als nur eine neue Zahlungsart; er ist das Bindeglied zwischen digitaler Identität, Verhalten und wirtschaftlicher Teilhabe. So offenbart ein Konzeptpapier der Europäischen Zentralbank (EZB) eine faszinierende Vision: „Der digitale Euro soll es ermöglichen, gezielte Anreize über monetäre Transfers zu setzen, die Verhaltensänderungen fördern und nachhaltiges Wirtschaften belohnen.“
Klingt nach einer schönen Zukunft: Wer Fahrrad fährt, bekommt 0,5% Cashback, wer mit dem SUV durch die Stadt brettert, kassiert Minuspunkte auf seinem digitalen Konto – und wenn man dann noch mit niedriger Punktzahl einkaufen will, wird’s eng. Denn: „Geld ist Macht“ erhält hier eine ganz neue Dimension.
Das Bonussystem: Freiheit mit Fußfessel
„Freiwilligkeit“ – so schön das Wort klingt, so märchenhaft ist es in der Praxis. Man kann sich kaum der Versuchung entziehen, daran zu zweifeln, ob es wirklich einen freiwilligen Verzicht geben kann, wenn sich die gesamte Gesellschaft in einem ständigen Wettkampf um Punkte, Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe befindet. Schon heute werden wir von sozialen Netzwerken und der Kultur des Vergleichens erdrückt, morgen heißt der Wettstreit um „Likes“ und „Shares“ schlicht „Punkte fürs Klima“, „Punkte fürs Ehrenamt“ oder „Punkte für den Verzicht aufs Auto“. Ein digitales Dorfplatzgericht, das denjenigen bestraft, der den Blick vom Punktekonto abwendet.
Diejenigen, die nicht mitspielen wollen, sind die neuen Nichtwähler: unsichtbar, aber nicht minder verloren. Sie sehen zu, wie die Punktegesellschaft sich formiert, lachen heimlich über die „Augenwischerei“ von Freiheit und Freiwilligkeit – und müssen dennoch die Folgen der Entscheidungen akzeptieren. Die Demokratie 2.0 ist also eigentlich nur Demokratie mit Fußfesseln.
Klima, Fachkräftemangel und der allumfassende Griff nach Punkten
Ach, der Klimawandel! Er ist der große Motor des Punktesystems, der heilige Zorn, der das Land in Bewegung setzt. Wer hätte gedacht, dass die Rettung des Planeten und die Ordnung des Arbeitsmarkts Hand in Hand gehen würden – über Punkte, versteht sich! Mit der transparenten Bewertung des ökologischen Fußabdrucks wird das Verursacherprinzip plötzlich ganz einfach: Wer viel verpestet, wird bestraft, wer punktet, wird belohnt. So wird Nachhaltigkeit zur Währung der Zukunft, während die Fachkräftelücke durch die clevere Erfassung von Qualifizierungspotenzialen ausgeglichen wird. Der Arbeitsmarkt wird zur Punktbörse, die räumliche Mobilität zum Spielball.
Man darf nur nicht zu genau hinschauen, wieviel Kontrolle und wieviel Überwachung in diesen wunderbaren Mechanismen steckt. Wie praktisch, dass der wirtschaftliche Aufschwung gerade so rosig ist, um diese technokratische Lösung zu finanzieren – sonst wäre es womöglich schwierig geworden, die Bürger von den Vorzügen eines digitalen Punktesystems zu überzeugen.
Die Demokratie in Zeiten des digitalen Nervensystems
Die Einführung war ein Fest der Kontroversen. Nicht etwa, weil es grundsätzliche ethische Bedenken gab, nein, sondern weil man sich darüber stritt, wie der Staat seine Rolle ausfüllt und wie die Daten monetarisiert werden sollen. In guter alter deutscher Manier wurde die Lösung im partizipativen Ringen gefunden: ein Punktesystem, dessen Regeln nicht von oben herab diktiert, sondern im Dialog erarbeitet werden. So viel Demokratie im Algorithmus!
Trotzdem, und das ist das wirklich Interessante, wird das System zur gesellschaftlichen Norm. Die Punkte werden zum Maßstab – nicht nur für Verhalten, sondern für Wertvorstellungen. Die Homogenisierung ist die dunkle Kehrseite dieser neuen Ordnung. Die „Dauerabgehängten“ bleiben zurück, ihre Punktekonten leer, ihre Chancen gering. Eine digitale Kluft, die neue Konflikte schafft, die aber ebenfalls über die Plattform der digitalen Demokratie ausgetragen werden – mit Abstimmungen, digitalen Petitionen und endlosen juristischen Prozessen.
Das Ende der Werte? Oder das Versprechen einer neuen Ordnung?
Der Übergang zur Steuerung durch Punkte bedeutet auch das Ende der klaren Trennung zwischen politischem Ziel und persönlicher Moral. Werte sind keine innere Überzeugung mehr, sondern algorithmisch messbare Attribute. Die Transparenz dieses digitalen Nervensystems verringert die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit – doch zu welchem Preis?
Wir beobachten eine seltsame Spaltung: Auf der einen Seite die begeisterten Punktesammler, die mit leuchtenden Augen in ihre digitalen Konten schauen; auf der anderen Seite eine kleine, aber laute Minderheit, die das System als Kontrollinstrument, als Feind der Freiheit begreift und gegen das unsichtbare Netz der Punkte aufbegehrt.
Epilog: Die Zukunft wartet – und wir dürfen noch warten
Die Pläne sind da, wir müssen nur noch warten. Warten auf die Punkte, auf die Zukunft, auf das Versprechen einer besseren, gerechteren und nachhaltigeren Gesellschaft. Doch Vorsicht, liebe Leserinnen und Leser: Zwischen den Zeilen dieses glänzenden Zukunftsentwurfs lauert die bittere Ironie einer Freiheit, die freiwillig scheint, aber systematisch alle zu Teilnehmern macht.
Denn am Ende wird aus der Demokratie der Punktediktatur eine Gesellschaft, die sich in Zahlen misst, in Werten aus Punkten denkt und in Konflikten der digitalen Teilhabe lebt. Und wenn dann eines Tages jemand sagt: „Wir haben es so gewollt“, dann sollte man sich fragen, ob das „wir“ nicht längst nur noch eine kleine Mehrheit in einem digitalen Punktespiel war.
Punkte, Punkte, Punkte – die neue Währung der Freiheit. Die Pläne sind da, wir müssen nur noch warten!
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zur „Zukunft von Wertvorstellungen der Menschen in unserem Land“
Sie wussten es vor uns:
„Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit; wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft.“ – George Orwell, 1984
„Ein Volk, das bereit ist, seine Freiheit gegen ein bisschen Bequemlichkeit einzutauschen, verdient weder Freiheit noch Bequemlichkeit.“ – Aldous Huxley, sinngemäß aus Schöne neue Welt
„Sie lebten glücklich und sorglos bis ans Ende ihrer Tage, und niemand hatte je eine Flamme der Rebellion entfacht.“ – Ray Bradbury, Fahrenheit 451