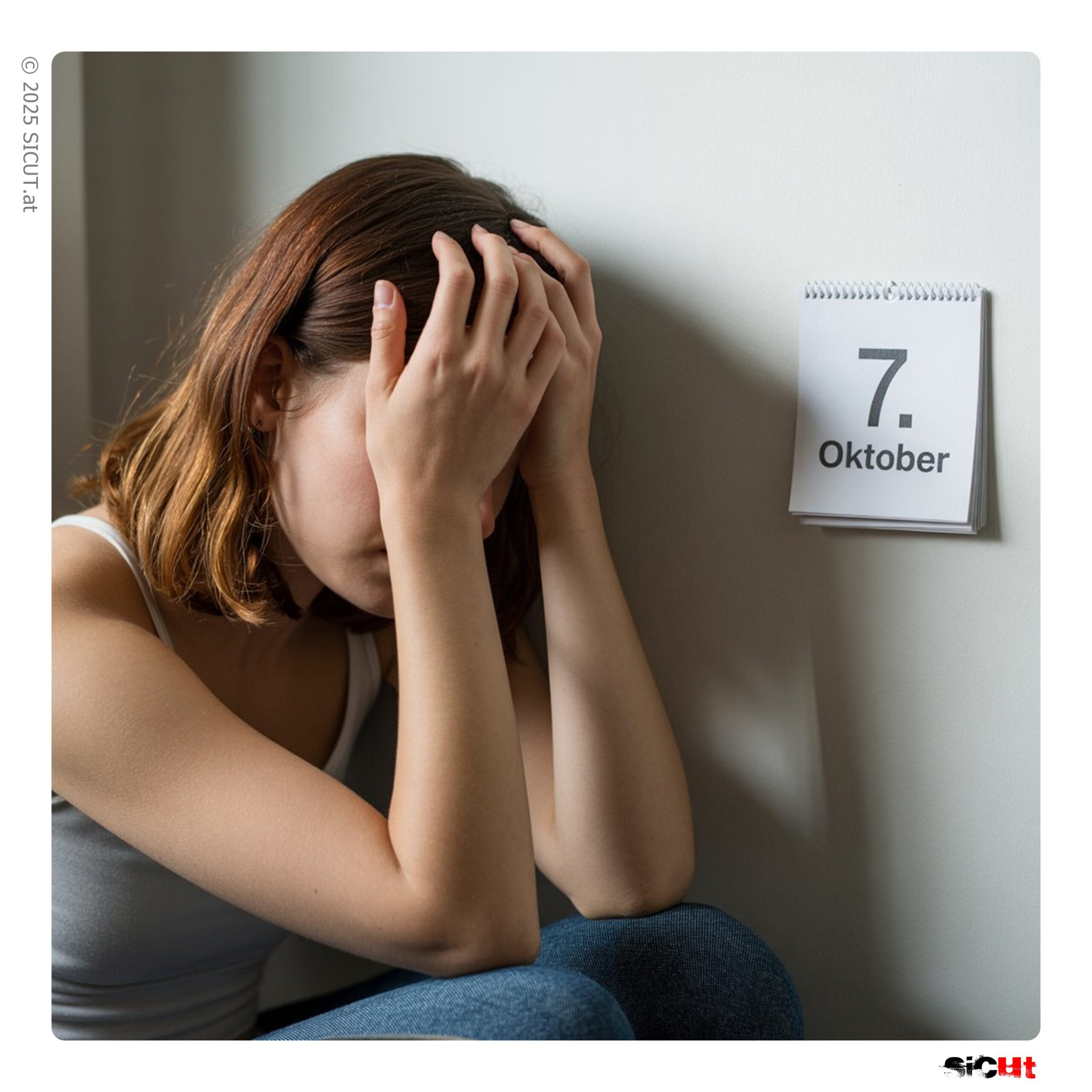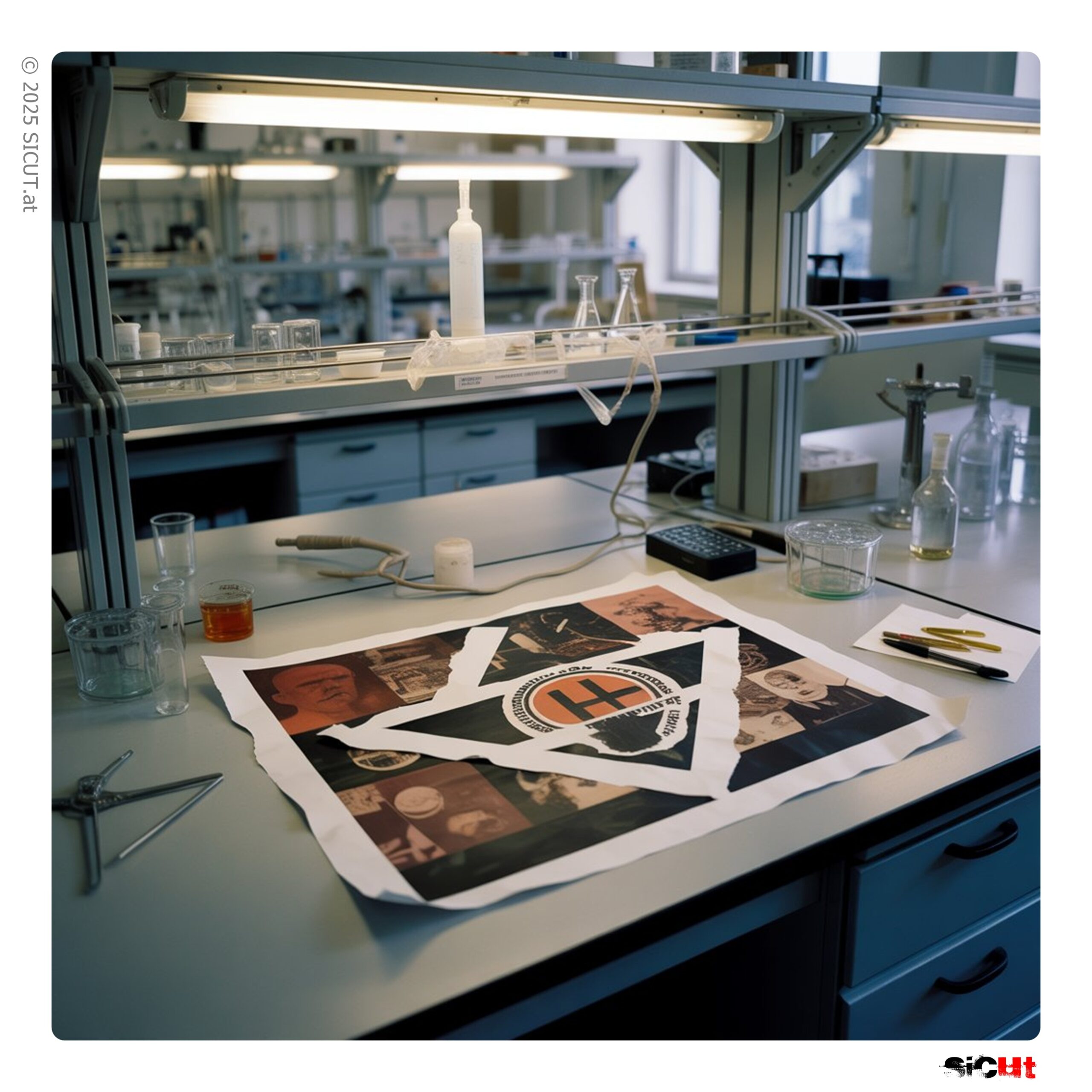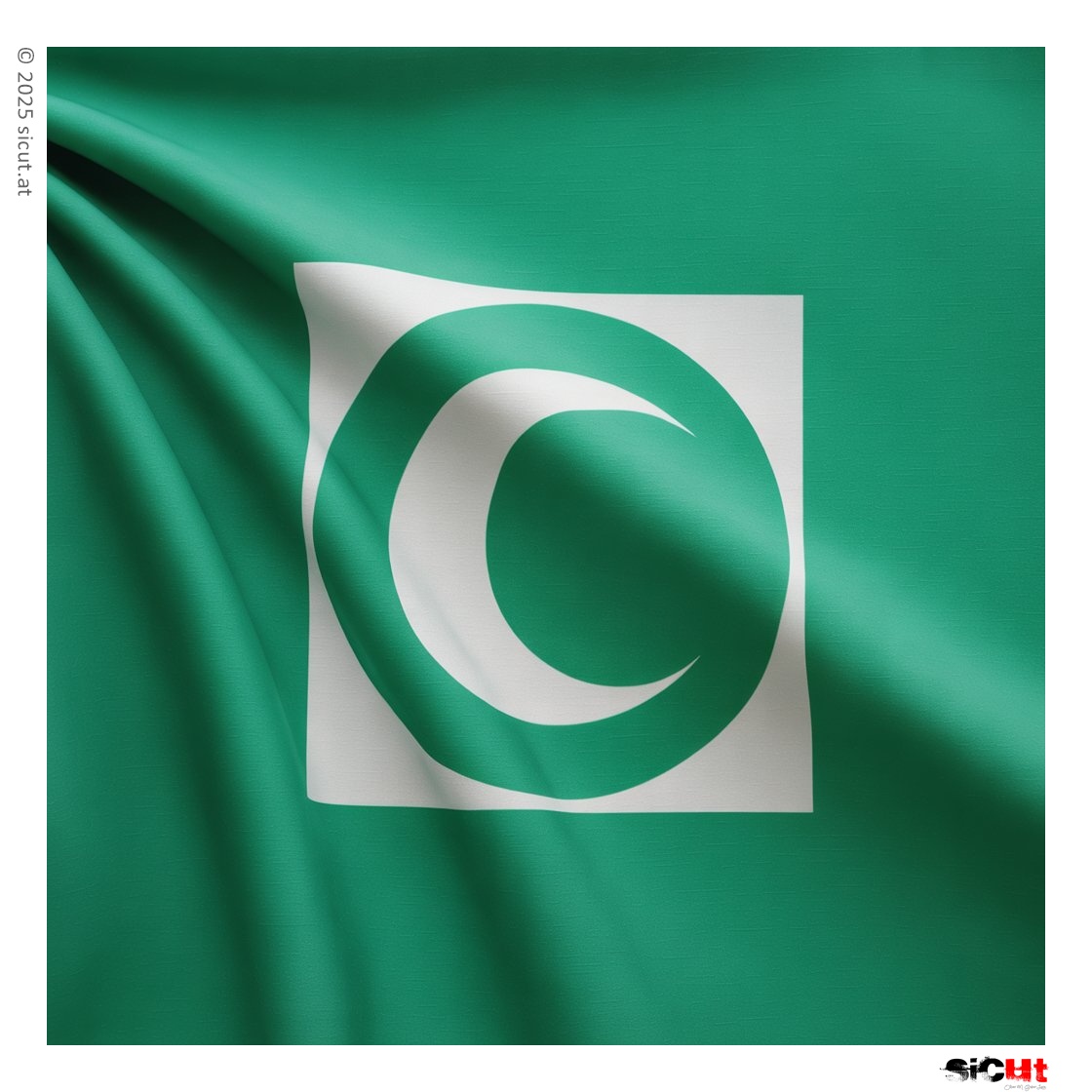Wenn die gute Absicht geschniegelt marschiert und dabei das Denken erschlägt
Es gibt Texte, die liest man und hat sofort dieses unverwechselbare Gefühl: Ah ja, hier spricht die aufgeklärte Avantgarde – aber bitte nur in dem Sinn, in dem ein Presslufthammer „spricht“. Der Gastkommentar von Benjamin Schütze in der taz mit dem Titel „Die Truppen der Staatsräson“ gehört in diese Kategorie: eine jener stilistisch geschniegelt daherkommenden Generalabrechnungen, die so tun, als würden sie die Realität freilegen, aber in Wahrheit vor allem eins freilegen – die erstaunliche Fähigkeit eines bestimmten akademisch-linken Milieus, sich in der Pose des Widerstands moralisch zu adeln, während es sich gedanklich in einer Art selbstgebautem Argumentationsbunker einmauert. Man muss diese Art Text gar nicht lange analysieren, um sein Funktionsprinzip zu erkennen: Er beginnt mit dem großen Begriff („autoritärer Anti-Antisemitismus“), setzt dann ein paar druckfrische Empörungsmarker dazu („Genozid“, „Normalisierung“, „Diffamierung“, „antiarabischer Rassismus“) und endet schließlich in einem dramaturgisch unvermeidlichen Feindbildkabinett („DIG“, Antisemitismusbeauftragte, eine mobilisierte Staatsräson-Front gegen die angeblich unterdrückte Wahrheit). Fertig ist das moralische Perpetuum mobile: Wer widerspricht, beweist nur, dass er Teil des Problems ist – und wer zustimmt, beweist, dass er zu den Guten gehört. Eine diskursive Einbahnstraße mit eingebautem Applausautomat. Und damit das alles auch wirklich nach „kritischer Analyse“ aussieht, wird noch ein wenig mit dem Völkerrecht gewedelt, wie man in früheren Zeiten mit dem Grundgesetz wedelte: nicht als komplexe Normenordnung, sondern als magisches Tuch, das man über jede Diskussion legt, damit der Gegner darunter erstickt.
Anti-Antisemitismus: Wenn aus dem Kampf gegen Judenhass eine Ideologie gegen Juden wird
Schon diese Formulierung – „autoritärer Anti-Antisemitismus“ – ist ein Meisterstück im Genre der linken Begriffsakrobatik: ein paradoxes Konstrukt, das sich anhört wie „freiheitliche Zwangsbeglückung“ oder „friedliche Vernichtung“. Gemeint ist offenbar: Die deutsche Politik bekämpfe Antisemitismus nicht, sondern benutze seine Bekämpfung als Herrschaftstechnik. Das kann man als Diagnose theoretisch diskutieren – es gibt ja tatsächlich Fälle, in denen Antisemitismusdefinitionen politisch instrumentalisiert werden, und es gibt ohne Frage auch opportunistische Staatsrhetorik, die sich mit moralischen Vokabeln schmückt, weil sie so schön geschniegelt aussehen. Aber die entscheidende Frage lautet: Was passiert, wenn man diesen Gedanken zum zentralen Narrativ erhebt? Nun, dann passiert exakt das, was der Text vorführt: Antisemitismus wird aus der Kategorie „konkrete Bedrohung für Juden“ herausgelöst und in die Kategorie „politisches Werkzeug des Westens“ verschoben. Judenfeindschaft wird zu einer Art Nebelmaschine im Dienste imperialer Interessen. Und plötzlich ist Antisemitismus nicht mehr das Problem, sondern der „Anti-Antisemitismus“ – also der Versuch, Antisemitismus zu benennen und zu bekämpfen. Das ist ungefähr so, als würde man sagen: „Hierzulande hat sich ein autoritärer Anti-Rassismus etabliert – seine Anhänger bekämpfen nicht Rassismus, sondern die Freiheit, sich rassistisch zu äußern.“ Man merkt sofort: Das klingt nur so lange nach mutiger Kritik, bis man realisiert, dass der Satz im Kern nicht Emanzipation, sondern Entkernung betreibt. Er verschiebt die moralische Schwerkraft. Er macht die Brandmelder zum Brand. Und wer den Brandmelder tritt, fühlt sich plötzlich wie Feuerwehr.
Staatsräson: Dieses deutsche Wort, das immer nach Kanzleramt riecht und trotzdem nicht automatisch „Genozid“ bedeutet
„Die Staatsräson … dient nicht der Bekämpfung von Antisemitismus, sondern der institutionellen Verankerung deutscher Unterstützung eines Genozids in Gaza.“ Das ist der Satz, bei dem man als Leser kurz innehält, nicht weil er so erschütternd ist, sondern weil er so entwaffnend schlicht ist: Ein einziges Wort – „Genozid“ – übernimmt hier die komplette Beweislast. Es ist ein moralisches Fallbeil, kein Argument. Er fällt und alles ist entschieden. Denn wenn es ein Genozid ist, dann ist jede Unterstützung dafür nicht bloß falsch, sondern verbrecherisch; dann ist jedes Zögern, jedes Abwägen, jede Komplexität bereits Komplizenschaft; dann ist nicht nur die Politik schuldig, sondern jeder, der sie nicht in der gewünschten Tonlage verdammt. Genau so funktioniert dieses Vokabular. Es ist nicht dazu da, die Debatte zu erhellen, sondern dazu, sie zu exekutieren. Man kann das rhetorisch brillant finden – und intellektuell unerquicklich. Denn wenn wirklich alles so eindeutig ist, warum braucht man dann überhaupt noch Analyse? Warum dann diese ganze Theaterkulisse von „institutioneller Verankerung“, „Normalisierung“, „Diffamierung“? Dann reicht ja ein Plakat. Genozid. Ende. Und hier liegt das Problem: Der Text lässt nicht den leisesten Zweifel zu, dass es sich um eine nicht nur moralisch verwerfliche, sondern rechtlich eindeutige Sache handelt. Er tut so, als wäre die Lage glasklar, als wäre jede andere Einschätzung nur Propaganda. Damit macht er genau das, was er dem „autoritären Anti-Antisemitismus“ vorwirft: Er setzt auf moralische Disziplinierung. Er sagt: Wer das nicht so nennt, hat Unrecht. Wer Unrecht hat, ist nicht nur falsch, sondern verdächtig. Und wer verdächtig ist, gehört zur dunklen Seite. Das ist die autoritäre Geste im Gewand der Befreiung.
Anti-arabischer Rassismus: Ein reales Problem, das als rhetorischer Rammbock missbraucht wird
Besonders unerquicklich ist die elegante Verbindung von Begriffen, die in der Realität getrennt betrachtet werden müssen: Staatsräson, Gaza, Genozid, antiarabischer Rassismus, Diffamierung von Forscher. Das klingt nach einem großen Zusammenhang, nach Strukturkritik, nach Intersektionalität der Unterdrückung – aber es funktioniert eher wie eine Kettenreaktion im Argumentationslabor. Natürlich gibt es in Deutschland antiarabischen Rassismus. Das ist keine Erfindung. Aber in solchen Texten wird dieser reale Befund nicht als konkrete Herausforderung behandelt, sondern als moralische Universalwährung: Wer Israels Sicherheit betont, normalisiert automatisch antiarabischen Rassismus. Wer Antisemitismusbeauftragte verteidigt, diffamiert automatisch Forscher. Wer Hamas als antisemitische Organisation benennt, behauptet automatisch, Palästina-Solidarität sei „politischer Islam“. Das ist der Trick: Man nimmt etwas Wahres (Rassismus existiert) und klebt es wie eine Schuldmarke auf alle, die in einer anderen Frage nicht die richtige Parole sprechen. So wird das Wort „Rassismus“ entwertet, weil es nicht mehr beschreibt, sondern verurteilt. Nicht mehr differenziert, sondern zerschlägt. Und am Ende stehen die Betroffenen – Palästinenser, Araber, Muslime – nicht stärker da, sondern instrumentalisiert: als Kulisse für eine ideologische Abrechnung, die gar nicht zuerst ihnen gilt, sondern dem deutschen „Diskursregime“. Die Solidarität wirkt dann wie eine Art politisches Accessoire: Man trägt Palästina wie andere ein Che-Guevara-Shirt tragen – nicht als Verantwortung, sondern als Signal.
Forscher werden diffamiert: Ein Satz, der immer stimmt, wenn man ihn nur groß genug schreibt
„Diffamierung von Forschern, die solidarisch mit Palästina sind.“ Auch hier: Ja, es gibt Fälle, in denen Wissenschaftler und Künstler vorschnell unter Antisemitismusverdacht geraten, es gibt Cancel-Versuche, Einladungen werden zurückgezogen, Förderungen werden gestrichen. Das sollte man kritisieren, und zwar klar. Aber Schützes Formulierung ist nicht die Kritik an Einzelfällen oder Mechanismen, sondern die Generalbehauptung eines systematischen Feldzugs. Das ist bequem, denn es erlaubt einem, jede Kritik an bestimmten Positionen als „Diffamierung“ zu etikettieren. Wer von einem Forscher verlangt, sauber zwischen israelischer Politik und jüdischer Existenz zu trennen, diffamiert angeblich. Wer antisemitische Codes in Palästina-Rhetorik benennt, diffamiert angeblich. Wer darauf hinweist, dass „From the river to the sea“ nicht einfach ein poetischer Freiheitsvers ist, sondern historisch-politisch oft eliminatorisch gelesen wird, diffamiert angeblich. Und so entsteht eine immunisierte Zone: Palästina-Solidarität wird zum sakrosankten Terrain, auf dem Kritik automatisch als Repression gilt. Dass diese Immunisierung am Ende nicht die Wissenschaft schützt, sondern die Ideologie, ist die Pointe, die solche Texte nicht merken – oder nicht merken wollen.
DIG, Antisemitismusbeauftragte und der böse „Truppen“-Sound: Wie man Gegner baut, um sich als Widerstand zu fühlen
Der Titel „Die Truppen der Staatsräson“ ist nicht zufällig gewählt. „Truppen“ klingt nach Uniform, nach Befehl, nach Marschmusik. Es erzeugt sofort ein Bild: Hier die disziplinierte Front der Unterdrückung, dort die mutigen Dissidenten. Und dann werden die üblichen Verdächtigen aufmarschiert: Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG), Antisemitismusbeauftragte, politische Akteure, die mobilisieren, die diffamieren, die bekämpfen. Das ist die Dramaturgie der linken Selbstveredelung: Man braucht einen Apparat, gegen den man kämpft, denn ohne Apparat wäre man nur jemand, der eine Meinung hat. Der Apparat macht einen zum Helden. Und er erlaubt es, sehr unterschiedliche Akteure in einen Topf zu werfen: die DIG als Lobbyorganisation, staatliche Beauftragte mit ihren institutionellen Logiken, Medien, Parteien, Behörden, Universitäten – alles wird zu „Truppen“. Wer so spricht, will nicht erklären, sondern entlarven. Das Problem: Entlarven ist kein Denken, Entlarven ist ein Reflex. Es ist die intellektuelle Version von „Ich wusste es doch!“ Und das ist genau die emotionale Belohnung, die dieser Text verteilt: an alle, die sich längst sicher sind, dass Deutschland aus historischer Schuld heraus nun die nächste Schuld begeht – und dass die eigentliche moralische Pflicht darin besteht, dies mit maximaler Schärfe zu sagen, ohne jemals innezuhalten und zu fragen, ob die eigene Schärfe vielleicht längst Teil des Problems geworden ist.
Die „angebliche Allianz“: Wenn man mit spitzen Fingern das benennt, was man doch heimlich braucht
Besonders hübsch ist die Passage über die „angebliche Allianz aus politischem Islam und radikaler Linker“. Dieses „angeblich“ ist ein jener kleinen rhetorischen Handschuhe, die man über die Hand zieht, bevor man jemandem ins Gesicht schlägt. Es suggeriert: Das ist eine Erfindung, eine Diffamierung, eine konstruierte Angst. Aber gleichzeitig ist es eine Verharmlosung einer sehr realen, sehr sichtbaren Gemengelage: dass es in manchen Milieus tatsächlich Überschneidungen gibt zwischen linken Antiimperialismus-Reflexen und islamistischen oder zumindest islamistisch kompatiblen Narrativen. Das bedeutet nicht, dass jeder Palästina-Protest islamistisch ist, es bedeutet nicht, dass jeder Linke, der Israel kritisiert, mit Islamisten paktiert. Aber es bedeutet, dass es diese Schnittmengen gibt – ideologisch, rhetorisch, organisatorisch, auf Demonstrationen, in Parolen, in Feindbildern. Und dass man darüber reden muss, ohne gleich in platte Islamophobie zu verfallen. Doch Schützes Text will darüber nicht reden. Er will es wegwischen. Er braucht dieses „angeblich“, weil er den Gedanken nicht zulassen darf, dass die eigene Seite nicht nur Opfer, sondern auch Akteur sein könnte – und zwar ein Akteur, der sich im schlimmsten Fall mit Kräften gemein macht, die mit Emanzipation so viel zu tun haben wie ein Betonmischer mit Poesie. Denn das wäre der Moment, in dem die linke Selbstinszenierung bröckelt: Man wäre nicht mehr die reine Solidarität, sondern Teil eines politischen Spiels, in dem Juden am Ende wieder die Rolle spielen, die sie in der Geschichte so oft spielen mussten – die Rolle des Symbols, an dem man Weltbilder austobt.
Der eigentliche Witz: Wie man „Antisemitismus bekämpfen“ als Unterdrückung framen kann, ohne rot zu werden
Das wirklich Bitterkomische an dieser Art Text ist nicht einmal seine Polemik, sondern seine erstaunliche Blindheit für das, was er selbst tut. Der Autor wirft anderen vor, Antisemitismus nicht bekämpfen zu wollen, sondern das Völkerrecht. Nur: Was genau tut er? Er bekämpft nicht die Instrumentalisierung von Antisemitismus, sondern die Bekämpfung von Antisemitismus. Er bekämpft nicht die Staatsräson als politisches Dogma, sondern die Möglichkeit, überhaupt eine besondere Verantwortung gegenüber jüdischem Leben zu formulieren, ohne als Genozidunterstützer beschimpft zu werden. Er bekämpft nicht den Missbrauch des Holocaustgedenkens, sondern die Erinnerung selbst, indem er sie in eine moralische Erpressungsmaschine umdeutet: Deutschland unterstützt Genozid, weil es aus seiner Geschichte nichts gelernt hat. Das ist eine Erzählung, die sich hübsch anfühlt, weil sie das deutsche Schuldproblem in eine neue Schuld verwandelt – und damit endlich wieder eine Bühne schafft, auf der man moralisch glänzen kann. Es ist das alte deutsche Drama, nur mit neuem Kostüm: Früher wollte man sich durch Schweigen entlasten, heute will man sich durch Schreien erlösen. Und die linke Variante davon ist besonders perfide, weil sie sich als Antifaschismus tarnt, während sie ein Kernmotiv antisemitischer Denkfiguren reaktiviert: die Vorstellung, dass „die Juden“ – oder der jüdische Staat als Projektionsfläche – das Zentrum einer großen Unrechtserzählung sind. Nicht unbedingt als allmächtige Verschwörer, das wäre zu platt für dieses Milieu, sondern als moralischer Hebel der Mächtigen, als Ausrede des Westens, als Symbol imperialer Gewalt. Es ist Antisemitismus in Anzug und Gendersternchen: geschniegelt, gerechtigkeitsbewusst, und doch strukturell vertraut.
Pointe mit Beigeschmack: Das Leiden in Gaza wird zur Requisite, das jüdische Leben zur störenden Fußnote
Und am Ende bleibt ein schaler Geschmack: Denn so sehr solche Texte behaupten, sie würden für die Unterdrückten sprechen – sie sprechen vor allem für sich selbst. Gaza wird zur Requisite einer deutschen Selbstdebatte: Wie verlogen ist Deutschland? Wie repressiv ist die Staatsräson? Wie autoritär ist der Diskurs? Die Menschen in Gaza erscheinen weniger als Individuen als als moralischer Rohstoff. Gleichzeitig verschwinden die Juden – als lebende Menschen, als bedrohte Minderheit, als Ziel realer Gewalt – hinter dem Begriff „Staatsräson“, der dann so behandelt wird, als sei er das eigentliche Problem. Es ist eine seltsame Umkehrung: Statt zu fragen, wie man beides gleichzeitig ernst nehmen kann – das Leid der Palästinenser und die Bedrohung jüdischen Lebens – entscheidet sich dieser Text für den bequemen Totalismus: Hier die einen als Opfer, dort die anderen als Täter, und wer auf die Komplexität hinweist, ist ein Handlanger des Systems. So bekommt man eine klare Welt. Und eine klare Welt ist das größte Opium für Menschen, die sich vor Ambivalenz fürchten wie Vampire vor Sonnenlicht.
Man könnte darüber lachen, wenn es nicht so unerquicklich wäre. Aber vielleicht ist das die angemessene Reaktion: ein Lachen, das nicht entlastet, sondern entlarvt. Denn „linker Antisemitismus vom Feinsten“ ist genau das: nicht der grölende Hass, nicht die Springerstiefel-Variante, sondern die fein ziselierte, moralisch parfümierte Version, die sich selbst für die letzte Bastion der Menschlichkeit hält, während sie mit großer Geste genau jene Muster erneuert, die sie zu bekämpfen vorgibt. Und wenn man das einmal gesehen hat, kann man es nicht mehr ungesehen machen: die Pose der Solidarität, die in Wahrheit eine Lust am moralischen Tribunal ist; der Kampf gegen Unterdrückung, der in Wahrheit ein Kampf gegen Widerspruch ist; der Antifaschismus, der so gerne „Nie wieder“ ruft, bis er merkt, dass „Nie wieder“ auch Juden einschließt – nicht nur als historische Fußnote, sondern als Gegenwart, die stört, weil sie die schöne, einfache Erzählung kompliziert macht.
So steht man am Ende da, irgendwo zwischen Kopfschütteln und bitterem Grinsen, und denkt: Was für eine Leistung. Man muss es erst einmal schaffen, das Wort „Antisemitismus“ so zu drehen, dass am Ende die Juden die Störgröße sind – und man selbst der Held. Das ist wirklich linker Antisemitismus vom Feinsten. Gourmetware. Serviert in der taz. Mit einem Hauch Völkerrecht und einer Prise Selbstgerechtigkeit.
Bon appétit.