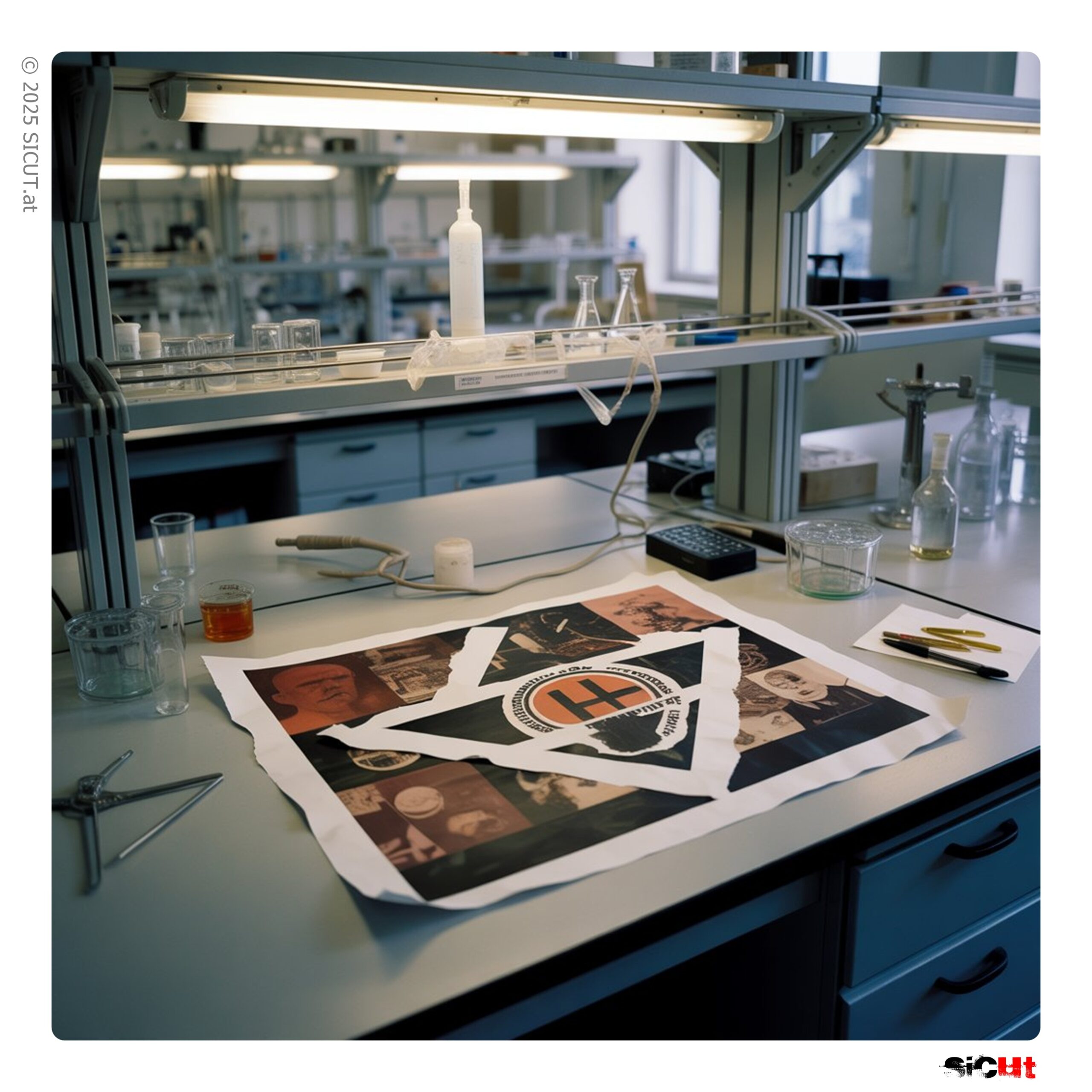… für ein notorisch kompliziertes Problem
Es gibt Ideen, die sind so bestechend einfach, dass man sich fragt, warum sie nie den Weg in die sonntäglichen Talkshows gefunden haben, warum kein Thinktank sie mit einem englischen Akronym geadelt und warum kein Strategiepapier sie in Diagramme gegossen hat. Meist liegt es daran, dass sie zwar logisch zwingend, moralisch provokant und gedanklich sauber sind, aber eben das eine große Tabu berühren: die Trennung zwischen denen, die über Krieg sprechen, entscheiden, schreiben und profitieren – und denen, die ihn führen, erleiden und überleben müssen. Der Krieg, dieses altehrwürdige Menschheitsritual, wird seit Jahrhunderten mit einer bemerkenswerten Arbeitsteilung betrieben. Die einen sitzen an langen Tischen, unter Kronleuchtern oder LED-Panels, formulieren Ziele, Narrative und rote Linien, während die anderen im Schlamm liegen, frieren, bluten und sterben. Und genau an dieser Stelle setzt die ebenso ketzerische wie charmant naive Frage an: Was wäre eigentlich, wenn man diese Arbeitsteilung einfach einmal aufheben würde? Nicht mit Revolution, nicht mit moralischer Empörung, sondern mit einer organisatorischen Maßnahme von entwaffnender Banalität.
Rekrutierung einmal anders gedacht
Stellen wir uns also – rein gedanklich, versteht sich, denn Satire darf alles, was Realität sich nicht traut – eine Mobilmachung vor, die nicht wie üblich am unteren Ende der sozialen Nahrungskette beginnt, sondern ganz oben. Keine anonymen Jahrgänge, keine statistischen Kollateralschicksale, sondern namentlich bekannte, gut ausgeleuchtete Biografien. Söhne und Töchter von Politikern aller Couleur, sorgfältig kuratiert ergänzt durch Journalisten, die sonst mit sicherer Stimme Frontverläufe erklären, Parteiführer, die gerne von historischer Verantwortung sprechen, Industriekapitäne, deren Gewinne in Rüstungsberichten aufblühen, Angehörige der oberen Zehntausend, die Krieg bislang nur aus Kunstauktionen und Benefizgalas kennen, sowie NGO-Funktionäre, die mit ernster Miene Leid verwalten, ohne es je riechen zu müssen. Man würde sie ausstatten, selbstverständlich regelkonform, mit dem gleichen Gerät, den gleichen Rationen, den gleichen Risiken wie all jene, die sonst stillschweigend als „verfügbares Personal“ gelten. Keine Sonderverpflegung, keine gepanzerten Pressebusse, keine humanitären Ausnahmen. Nur das, was Krieg eben ist, wenn man ihn nicht abstrahiert.
Die pädagogische Kraft der Realität
Die Wirkung dieser Maßnahme wäre vermutlich pädagogisch überwältigend. Denn Krieg ist vor allem eines: ein radikaler Lehrer. Er unterrichtet nicht in Seminarräumen, sondern mit Kälte, Angst und Zufall. Innerhalb weniger Stunden würde sich eine bemerkenswerte Transformation vollziehen. Begriffe wie „strategische Geduld“, „robuste Mandate“ oder „notwendige Eskalationsschritte“ verlören ihre geschmeidige Rhetorik und würden zu dem, was sie immer schon waren: Euphemismen für persönliches Risiko. Der zynische Charme dieser Vorstellung liegt darin, dass sie niemanden überzeugt, sondern alle betrifft. Es bräuchte keine Proteste, keine Petitionen, keine moralischen Appelle. Die Realität selbst würde argumentieren, mit einer Überzeugungskraft, gegen die kein Leitartikel, keine Pressekonferenz und kein Parteitagsbeschluss ankommt. Plötzlich würde jede militärische Option nicht mehr als abstrakte Möglichkeit, sondern als potenzielle SMS an das eigene Kind gedacht. Und erstaunlicherweise, so darf man vermuten, schrumpft in solchen Momenten der Spielraum für heroische Großworte dramatisch.
Medienlogik unter Beschuss
Besonders reizvoll ist der Gedanke, was dies mit der medialen Begleitmusik des Krieges machen würde. Journalisten an der Front, nicht als Beobachter, sondern als Beteiligte – was für ein Genrebruch! Die vertraute Distanz, aus der man sonst Verluste in Zahlenkolonnen verwandelt, wäre dahin. Jeder Bericht wäre zugleich Selbstporträt, jede Analyse ein Bericht aus der eigenen Verletzlichkeit. Die Schlagzeilen würden sich verändern, nicht aus Zensur, sondern aus Selbsterhaltung. Pathos hat bekanntlich eine geringe Halbwertszeit, wenn es im Schützengraben rezitiert werden muss. Und der Zynismus, dieses beliebte Stilmittel der feuilletonistischen Kriegserklärung, verdunstet erstaunlich schnell, wenn der Einschlag nicht metaphorisch ist. Man könnte fast von einer Demokratisierung der Angst sprechen, einer Gleichverteilung dessen, was sonst sorgfältig sozial selektiert wird.
Wirtschaft, Verantwortung und der Preis der Metapher
Auch die Wirtschaft würde eine neue Beziehung zur Realität entwickeln. Industriekapitäne, die bislang in Quartalszahlen denken, müssten lernen, dass Lieferketten im Krieg nicht nur unterbrochen, sondern zerrissen werden – und dass das eigene Erbe nicht in Aktienpaketen, sondern in Feldpostbriefen verhandelt wird. Die berühmte „Verantwortung der Wirtschaft“ bekäme eine ganz neue, schmerzlich konkrete Bedeutung. Investitionen in Sicherheit würden nicht mehr als abstrakte Marktchancen erscheinen, sondern als Fragen nach Helmqualität und Funkreichweite. Und vielleicht, nur vielleicht, würde man erkennen, dass Frieden nicht die Abwesenheit von Geschäft ist, sondern dessen nachhaltigste Form.
NGO Idealismus trifft Matsch
Selbst die Welt der Nichtregierungsorganisationen, sonst moralisch unangreifbar und rhetorisch stets auf der richtigen Seite der Geschichte, würde von dieser Erfahrung nicht unberührt bleiben. Idealismus ist ein kostbares Gut, aber er neigt zur Veredelung des Leidens, wenn er es nur verwaltet. Im Feld, fernab von Konferenzen und Förderanträgen, würde sich zeigen, wie belastbar die eigenen Narrative sind. Humanitäre Prinzipien unter Beschuss – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – sind eine harte Prüfung. Doch genau darin läge ihr Wert: Moral, die nicht nur verkündet, sondern durchlitten wird, gewinnt eine Glaubwürdigkeit, die kein Bericht je ersetzen kann.
Achtundvierzig Stunden später
Und dann, so die kühne Wette, wäre nach achtundvierzig Stunden Schluss. Nicht, weil plötzlich alle Menschen besser, klüger oder friedfertiger geworden wären, sondern weil der Preis des Krieges endlich dort angekommen wäre, wo er entschieden wird. Waffenstillstände würden sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit materialisieren, diplomatische Kanäle, die zuvor als „ausgereizt“ galten, erwiesen sich als überraschend aufnahmefähig. Unüberbrückbare Gegensätze schrumpften auf verhandelbare Interessen zusammen, sobald sie nicht mehr mit fremdem Blut bezahlt werden können. Der Krieg, dieses vermeintlich unvermeidliche Schicksal, entpuppte sich als das, was er immer war: eine Frage der Verteilung von Risiko und Leid.
Wetten dass
Natürlich weiß jeder halbwegs nüchterne Mensch, dass all dies niemals geschehen wird. Satire lebt von der Überzeichnung, vom gedanklichen Kurzschluss, der die Absurdität der Realität sichtbar macht. Doch gerade deshalb trifft diese Idee einen wunden Punkt. Sie legt offen, dass Kriege nicht an mangelnden Lösungen scheitern, sondern an mangelnder Betroffenheit. Solange die Entscheidenden sicher sind, bleibt der Krieg eine Option. Würde man diese Sicherheit aufheben, nicht rhetorisch, sondern real, dann wäre Frieden keine utopische Vision mehr, sondern eine pragmatische Notwendigkeit. Und genau darin liegt der augenzwinkernde, bitter-süße Humor dieses Gedankens: Er ist so offensichtlich richtig, dass er nur als Witz überleben kann. Wetten, dass?