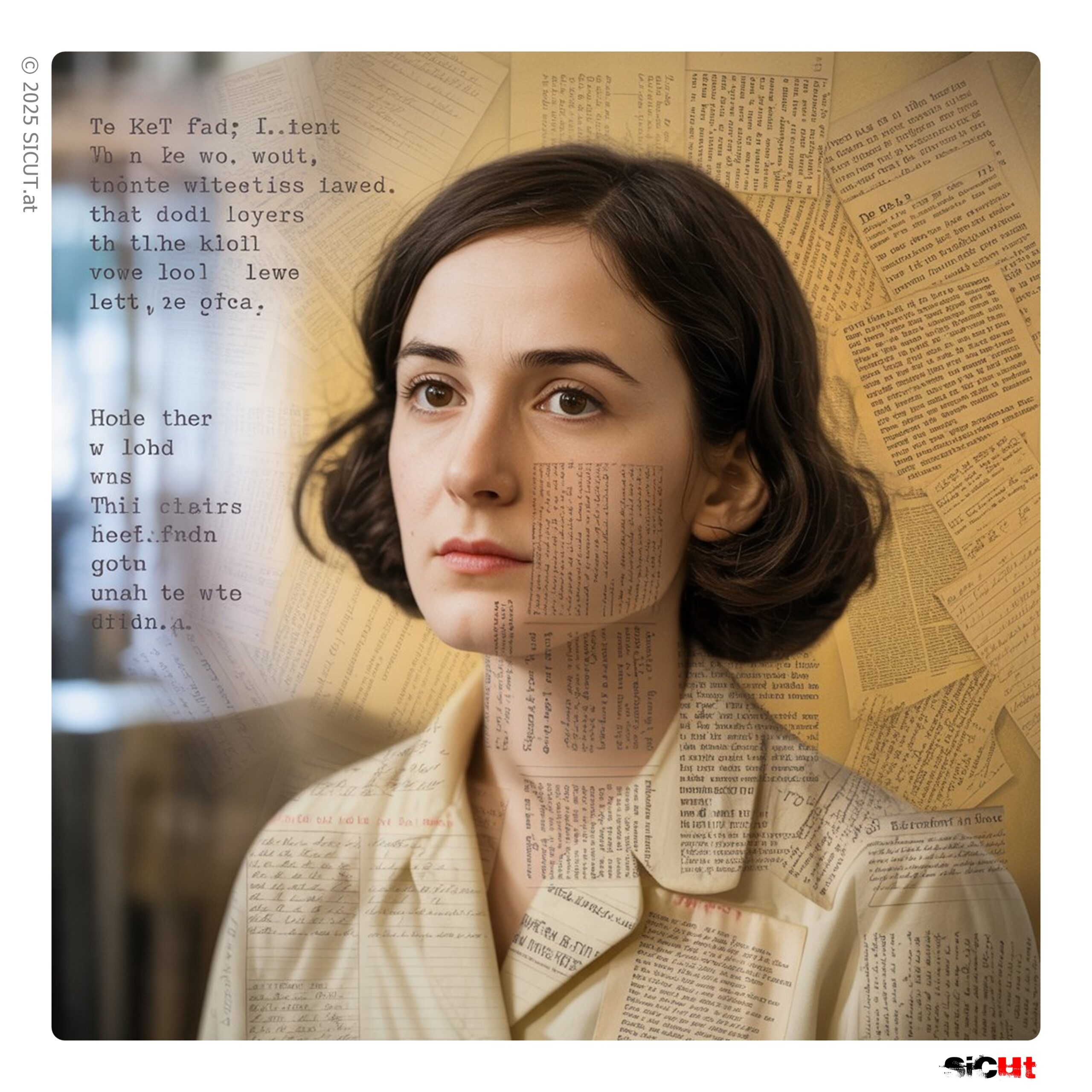Prolog im Museum der guten Absichten
Europa steht da wie ein Kurator im eigenen Museum, umgeben von Vitrinen voller hehrer Ziele, ethischer Zertifikate und sauber laminierter Verordnungen, und wundert sich, warum draußen niemand mehr Schlange steht. Man hat alles richtig machen wollen, so richtig, dass es schon wieder falsch war, und nun blickt man mit jener milden Bestürzung auf die Welt, die sonst nur Menschen befällt, die beim Schach verlieren, obwohl sie die Regeln auswendig kennen. Der Telegraph ruft Alarm, doch Europa nickt zustimmend, notiert den Hinweis in dreifacher Ausfertigung und vertagt die Rettung auf den nächsten Gipfel. Der Anteil an der Weltwirtschaft schrumpft wie ein Wollpullover bei falscher Wäsche, während USA und China expandieren, nicht elegant, aber effektiv. Europa hingegen liebt den perfekten Schnitt und friert dabei. Die Pointe ist bitter, aber tröstlich zugleich: Der Niedergang ist nicht schicksalhaft, sondern selbstgemacht, also theoretisch reparabel. Praktisch allerdings fehlt es an Schraubenziehern, weil diese inzwischen als sicherheitsrelevant eingestuft sind.
Energie als moralische Disziplinierungsmaßnahme
Die europäische Energiepolitik gleicht einem spirituellen Exerzitium, in dem Industrie und Bürger gleichermaßen zur inneren Einkehr gezwungen werden, vorzugsweise bei Kerzenlicht. Hohe Preise sind kein Fehler, sondern pädagogisches Instrument, eine Art ökonomischer Rosenkranz, der die Sünden der Vergangenheit abtragen soll. Dass energieintensive Industrien dabei kollabieren wie Marathonläufer ohne Wasser, wird als Kollateralschaden verbucht, denn nichts läutert so sehr wie Verzicht. Der Emissionshandel, dieses hochkomplexe Brettspiel für Fortgeschrittene, belohnt das Nichtstun und bestraft jene, die früh investiert haben, als wäre Innovation eine Charakterschwäche. Fabriken schließen, Produktionsketten wandern ab, und der globale CO₂ Ausstoß steigt paradoxerweise, weil anderswo weniger zimperlich produziert wird. Europa klopft sich dennoch auf die Schulter, denn die eigene Statistik ist sauber, und Sauberkeit war schon immer eine europäische Tugend, auch wenn sie gelegentlich das Zimmer verlässt und den Müll in den Hof des Nachbarn kippt.
Regulierung als Ersatzreligion
Wenn Europa etwas wirklich kann, dann ist es Regeln schreiben, nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Zweck an sich. Der Regelungsdschungel ist so dicht, dass selbst erfahrene Pfadfinder darin die Orientierung verlieren, doch das beruhigt, denn Ordnung entsteht nicht durch Wirkung, sondern durch Umfang. Start ups stolpern über Formularberge, bevor sie ihren ersten Kaffee getrunken haben, Investoren lesen Gesetzestexte wie Orakel, aus denen sich alles und nichts herauslesen lässt, und Innovation wird zur Mutprobe für Menschen mit juristischem Doppelstudium. Während anderswo ein Scheitern als Lernprozess gilt, gilt es hier als Verwaltungsproblem, das mit weiteren Regeln gelöst werden muss. So verwaltet Brüssel den Abstieg mit stoischer Gelassenheit, als handle es sich um eine kontrollierte Landung, bei der man nur vergessen hat, ein Flugzeug mitzunehmen.
China subventioniert, Europa sinniert
China spielt das Spiel der Macht mit der Unverfrorenheit eines Profis, der weiß, dass Moral auf dem Weltmarkt eine optionale Erweiterung ist. Massive Subventionen drücken Preise, Marktanteile werden erobert, und ganze Industriezweige wechseln den Kontinent wie Zugvögel mit staatlichem Rückenwind. Europa schaut zu und debattiert, ob Subventionen nicht den Wettbewerb verzerren könnten, während der Wettbewerb längst verzerrt davonläuft. In der Solarindustrie und im Automobilbau ist der Befund unerquicklich, aber lehrreich: Wer strategisch denkt, gewinnt Zeit, wer normativ denkt, verliert Märkte. Europa entscheidet sich traditionell für das Gute und wundert sich, warum das Gute keine Rendite abwirft. Satirisch betrachtet ist das immerhin konsequent, tragisch betrachtet aber ruinös.
Zukunftstechnologien und die Angst vor dem Morgen
In Pharma, Internet, Künstlicher Intelligenz und anderen Zauberwörtern der Gegenwart ist Europa vor allem eines: vorsichtig. Forschung wird gefördert, solange sie niemanden stört, Risikokapital fließt tröpfchenweise, als handele es sich um homöopathische Dosen, und jede neue Idee muss erst beweisen, dass sie niemandem schadet, bevor sie jemandem nützt. Die USA investieren, China kopiert und skaliert, Europa evaluiert. Man hat hervorragende Universitäten, kluge Köpfe und brillante Konzepte, doch sie verhungern an der langen Leine der Genehmigungen. Innovation wird hierzulande behandelt wie ein exotisches Haustier, das man bewundert, aber lieber nicht frei laufen lässt.
Die Verwaltung des Untergangs als Meisterdisziplin
Der vielleicht zynischste Befund ist nicht der Niedergang selbst, sondern seine bürokratische Eleganz. Brüssel dokumentiert, moderiert, reguliert und harmonisiert den Abstieg mit einer Professionalität, die fast schon Bewunderung verdient. Man erstellt Berichte über Berichte, während die Realität ungerührt weiterzieht. Der Telegraph spricht von einem Wendepunkt, doch Europa liebt Kreisverkehre, weil sie niemanden zwingen, eine Richtung zu wählen. Reformen sind möglich, heißt es, aber erst nach der nächsten Krise, die dann hoffentlich so schwer ist, dass sie niemand mehr ignorieren kann. Bis dahin bleibt der Kontinent in jenem Zustand melancholischer Selbstzufriedenheit, in dem man weiß, dass etwas schief läuft, aber überzeugt ist, moralisch im Recht zu sein.
Epilog mit ironischem Hoffnungsschimmer
Vielleicht braucht Europa tatsächlich die große Erschütterung, den Moment, in dem die Vitrinen klirren und die wohlgeordneten Exponate der guten Absichten auf dem Boden liegen. Vielleicht erkennt man dann, dass Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist und Moral ohne Macht nur eine Fußnote der Geschichte bleibt. Bis dahin bleibt uns der zynische Trost, dass der Untergang wenigstens stilvoll inszeniert ist, mit langen Gipfeln, langen Papieren und noch längeren Absätzen. finis europae klingt endgültig, ist aber vielleicht nur eine Zwischenüberschrift, h4 gewissermaßen, unter der sich die Hoffnung versteckt, dass Europa eines Tages wieder lernt, nicht nur recht zu haben, sondern auch erfolgreich zu sein.