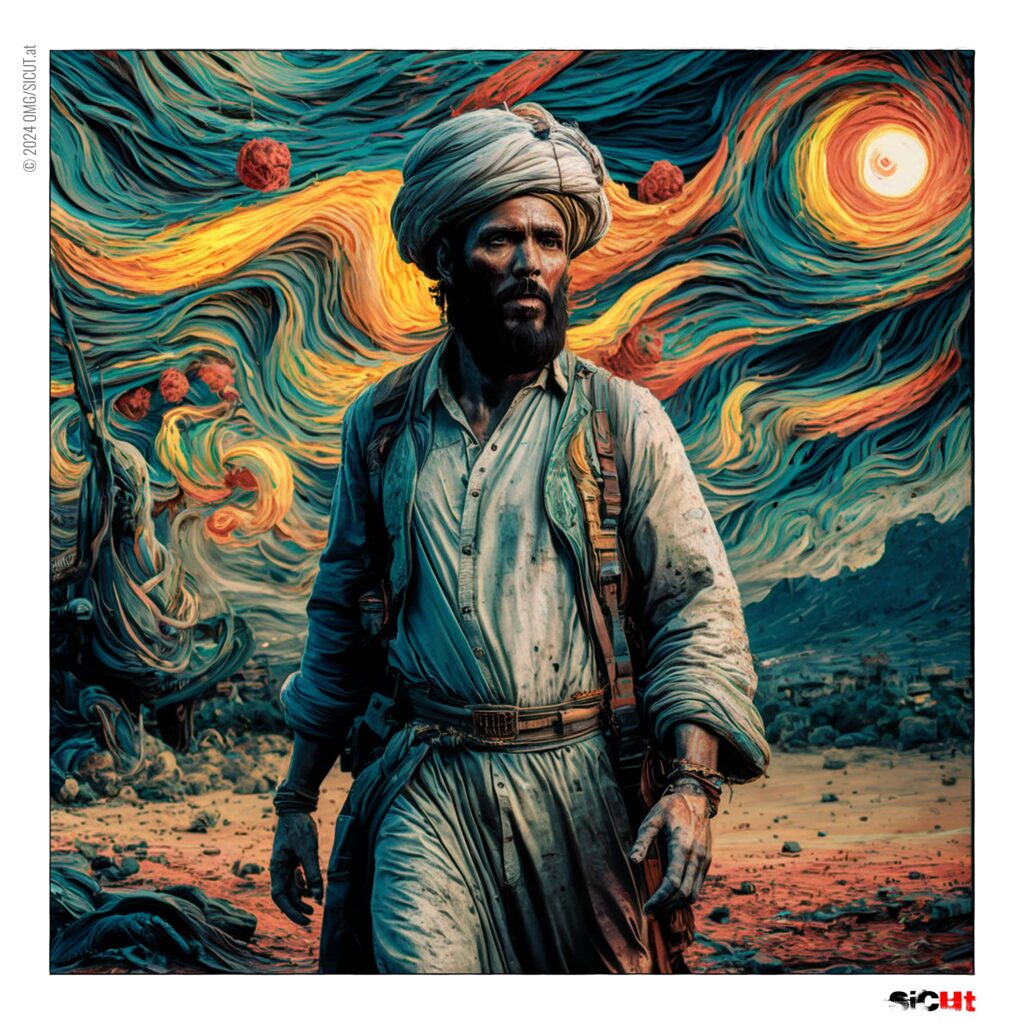
Ein zwanzig Jahre alter Paukenschlag gegen Freiheit und Fanatismus
Vor genau zwanzig Jahren endete das Leben des niederländischen Filmemachers und Satirikers Theo van Gogh auf eine Weise, die mehr war als eine persönliche Tragödie. Es war eine Wunde in das soziale und kulturelle Gefüge Europas. Van Gogh war kein Unschuldslamm; seine Bemerkungen über Religionen, Ethnien und Politik waren nichts weniger als verbal explodierende Brandsätze, deren Sinn für viele nur schwer zu begreifen war. Und dennoch – wer könnte sagen, dass sie es verdienten, von einem Fanatiker erstickt zu werden? Dass ein Künstler, der auf Provokation und Ironie setzte, in einer Art mittelalterlicher Vergeltung getötet wurde, ist nicht nur erschütternd, sondern führt uns die Fragilität der Freiheit vor Augen. Die Frage bleibt: Wer war Theo van Gogh wirklich? Ein „enfant terrible“ der niederländischen Kultur oder das Opfer einer brutalen Ignoranz gegenüber der Freiheit der Kunst?
Die ungezähmte Wildheit
Van Gogh war vieles, doch eines sicher nicht: diplomatisch. Seine Äußerungen waren wie reißende Wölfe, die durch die Reihen der gesellschaftlichen „Normen und Werte“ tobten. Für viele Holländer war er ein Held – ein ungezähmter, provokanter Kritiker des Establishments, der alle Seiten gleichermaßen angriff. Ob Religion, Rassismus oder politische Korrektheit, van Gogh hielt nichts von heiligen Kühen. Seine Haltung zur multikulturellen Gesellschaft war alles andere als wohlwollend; er sah in ihr eine Bedrohung für die „westlichen Werte“, die er für wertvoll hielt. Van Gogh benutzte Schimpfwörter, die den Durchschnittsbürger erröten ließen, bezeichnete Muslime als „geitenneukers“ und streute antisemitische Sticheleien gegen prominente jüdische Intellektuelle, ohne mit der Wimper zu zucken. Doch war van Gogh ein Rassist oder ein moralischer Nihilist? Nein, vielmehr war er ein zynischer Diagnostiker, der die wunden Punkte der Gesellschaft seismographisch erspürte und sie dann ohne Anästhesie in die Öffentlichkeit legte.
Submission und die sakrosankte Provokation
Sein letzter Film Submission, eine Zusammenarbeit mit der Islamkritikerin Ayaan Hirsi Ali, war das Werk, das ihm endgültig den Tod brachte. Die islamkritische Ästhetik des Films – verschleierte Frauenkörper, die mit Koransuren beschriftet sind – löste eine Empörungswelle aus, die bis heute nachhallt. War es wirklich nur ein Kunstwerk, oder war es eine gezielte Provokation, die mit Absicht die religiösen Gefühle einer ganzen Glaubensgemeinschaft verletzen sollte? Ja, Submission riss das Pflaster der islamischen Geschlechterpolitik brutal ab und zeigte darunter eine Wunde, die viele nicht zu sehen bereit waren. Die Absicht war klar: Van Gogh und Hirsi Ali wollten zeigen, dass Freiheit und Religion – zumindest in dieser speziellen Form – unvereinbar seien. Doch statt Diskussion brachte Submission eine Welle des Hasses, die nur wenige Wochen später in Van Goghs Mord mündete.
Ein Todesritual in der modernen Welt
Der Mord an van Gogh glich einer makabren Inszenierung: ein radikaler Muslim, Mohammed Bouyeri, jagt van Gogh am hellichten Tag, auf offener Straße, sticht und schießt auf ihn und hinterlässt eine fünfseitige Nachricht, die wie ein mittelalterliches Pamphlet der religiösen Inquisition anmutet. Ein Mann, der für seine Meinung bekannt war, wird brutal zum Schweigen gebracht – eine grausame Ironie in einem Land, das stolz auf seine Meinungsfreiheit ist. Bouyeris Beweggründe? Die „Ehre des Islam“ zu verteidigen. Doch was für eine Religion ist das, deren Ehre durch die Ermordung eines Filmemachers gerettet werden soll?
Die symbolische Dimension des Mordes ist unausweichlich: Hier kreuzen sich Meinungsfreiheit und religiöser Fanatismus wie zwei Züge, die aufeinander zurasen. Die Szene erinnert an ein absurdes Theaterstück: ein Künstler, der sich gegen die Unterdrückung der Frauen ausspricht, wird in einer ritualisierten Gewaltorgie von einem religiösen Fanatiker ermordet. Eine Handlung, die in ihrer Sinnlosigkeit bestürzend und gleichzeitig symptomatisch für die Konflikte unserer Zeit ist.
Das Paradoxon der Freiheit
Van Gogh’s Ermordung löste eine hitzige Debatte über die „Grenzen der Toleranz“ aus. Darf eine Gesellschaft, die sich Toleranz und Liberalität auf die Fahnen geschrieben hat, auch diejenigen akzeptieren, die diese Werte in Frage stellen? Van Gogh sah genau hier das Dilemma: Eine multikulturelle Gesellschaft, die sich einer vermeintlichen Toleranz verpflichtet fühlt, toleriert letztlich auch Intoleranz – bis hin zur gewaltsamen Intoleranz, die ihn das Leben kostete. Sein Tod war der bittere Beweis, dass grenzenlose Toleranz in die Selbstaufgabe führen kann. Doch hätte die Gesellschaft anders reagieren sollen? Hätte man ihn schützen müssen, ihn „zum Schweigen bringen“, um die islamische Gemeinde zu beschwichtigen? Nein – denn das wäre ein Verrat an der Freiheit gewesen, die van Gogh verkörperte, wie ungeschliffen und kompromisslos auch immer.
Von Märtyrern und Mördern
Zwanzig Jahre nach dem Mord an Theo van Gogh sehen wir uns einer seltsamen Ironie gegenüber: Van Gogh, der öffentliche Provokateur und respektlose Satiriker, wird in den Niederlanden heute fast wie ein Märtyrer verehrt. Doch wäre ihm diese Rolle wohl selbst zutiefst zuwider gewesen; zu Lebzeiten lehnte er Märtyrerfiguren in jeder Form ab und hätte über seine posthume Glorifizierung sicher nur verächtlich gelacht. Und Bouyeri? Er sitzt in lebenslanger Haft und bereut keinen Tag, bleibt ein Prophet des Hasses, ein Mann, dessen Weltbild auf der Annahme beruht, dass Gewalt eine legitime Antwort auf Meinungsfreiheit ist.
In vielerlei Hinsicht ist van Gogh, der intellektuelle Querkopf, in den Niederlanden zum Symbol für die Verteidigung der Meinungsfreiheit geworden. Aber ist das nicht ein entsetzlich bitterer Triumph? Der Mann, der Freiheit durch Provokation auslotete, musste sterben, um als Ikone der Liberalität zu gelten. Hätte er diesen „Triumph“ zu Lebzeiten wohl mit einem zynischen Lächeln quittiert und die Doppelmoral der Gesellschaft an den Pranger gestellt.
Zwanzig Jahre und kein bisschen weiser
Heute, zwei Jahrzehnte nach van Goghs Tod, hat sich wenig verändert. Religiöser Fanatismus ist lebendiger denn je, und die westliche Welt ist nach wie vor ratlos, wie sie mit den Herausforderungen der Multikulturalität umgehen soll. Die Lektion, die van Gogh und sein tragisches Ende hinterlassen haben, bleibt weitgehend ungehört. Er setzte sein Leben dafür ein, die unheilige Allianz von Religion und Unterdrückung anzuprangern – eine Mission, die zu seinem eigenen Kreuzweg wurde. Doch die Frage bleibt bestehen: Sind wir bereit, die Freiheit der Kunst, der Meinungsäußerung und der Kritik zu verteidigen, auch wenn sie unangenehm, herausfordernd oder verletzend sein kann?
Theo van Gogh bleibt ein Schatten auf der politischen und kulturellen Bühne Europas, eine ständige Erinnerung daran, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist, dass sie auch ihre finstere Seite hat und oft zum bitteren Preis der Provokation erkauft wird.
Quellen und weiterführende Links
- Bolkestein, Frits. Zwischen Toleranz und Unterwerfung: Die multikulturelle Herausforderung Europas. Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
- Buruma, Ian. Mord in Amsterdam: Liberalismus, Islam und die Grenzen der Toleranz. Princeton University Press, 2006.
- Louw, Peter-Jan. “The Legacy of Theo van Gogh: Twenty Years Later.” Dutch Historical Review, vol. 58, no. 3, 2024.
- Steiner, Gerhard. The Clash of Freedoms: Secularism vs. Fundamentalism in Europe. Cambridge University Press, 2018.
