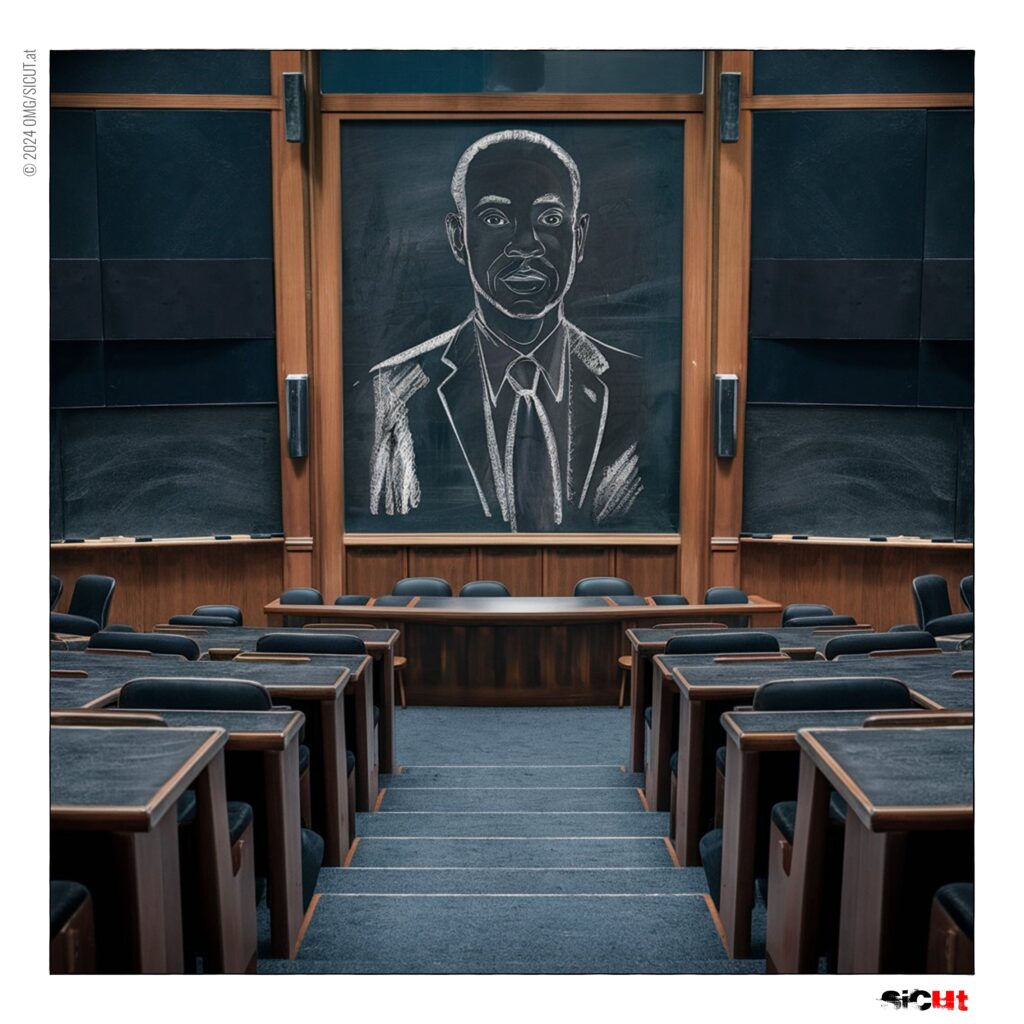
Rassismusforschung mit rassistischen Methoden
Es ist wieder einmal soweit: Die deutsche Wissenschaft hat ein weiteres Projekt hervorgebracht, das man in die Kategorie „Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht“ einordnen könnte. Diesmal geht es um das Institut für Medienforschung der Universität Rostock, das sich der ehrenwerten Aufgabe verschrieben hat, die fehlende „Vielfalt“ im deutschen Fernsehen und Kino zu untersuchen. Doch, und hier beginnt die unfreiwillige Komödie, um ihre Hypothese zu belegen – dass Migranten und Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe unterrepräsentiert sind – greifen die Forscher auf ein äußerst fragwürdiges Werkzeug zurück: rassistische Kategorien, die sie selbst erschaffen haben.
Ja, richtig gehört: Um den Rassismus im Fernsehen anzuprangern, haben die Wissenschaftler ein „Codebuch“ entwickelt, das Schauspieler, Moderatoren und Talkshow-Gäste anhand ihrer „ethnischen Herkunft“ einordnet. Hautfarbe, Augenform, Haarstruktur – die ganze Palette der pseudo-biologischen Kategorien des 19. Jahrhunderts wird bemüht, um den Beweis anzutreten, dass nicht alle in Deutschland vor der Kamera die gleiche Chance haben. Absurd? Oh, aber das ist erst der Anfang.
Die Rückkehr der Rassentheorie im Gewand der Diversität
Man könnte fast meinen, die Autoren der Studie hätten sich von der Ästhetik eines viktorianischen Anatomiebuchs inspirieren lassen. Unter „Schwarz/PoC“ (ein aufklärerisches Akronym für People of Color) finden wir Porträts von Menschen, die nach ihrer Hautfarbe eingeordnet werden. „Südasien“ erkennt man, so belehrt uns die Studie, an „gebräunter Haut“ – als hätte man den Farbfächer aus dem Baumarkt für menschliche Pigmentierungen importiert. Und dann die Krönung: Südostasiaten und Ostasiaten werden nach der „Form ihrer Augen“ codiert. Ein Hoch auf die moderne Wissenschaft, die uns in ein Zeitalter zurückführt, in dem man ernsthaft glaubte, man könne die Essenz eines Menschen an der Form seiner Augen und dem Farbton seiner Haut ablesen!
Zugegeben, der Zyniker in mir applaudiert dieser Studie – sie treibt den Diskurs auf die Spitze. Sie zeigt uns, wohin uns die besessene Fixierung auf „Identität“ und „Vielfalt“ führen kann: Nämlich zu einer Re-Implementierung von Rassenkategorien, die man hoffte, längst überwunden zu haben. Ist es nicht großartig, wie das Streben nach Diversität zu einer Umkehr in die dunkelsten Ecken der Rassentheorie führen kann? Und das Beste: Es geschieht unter dem Banner des Anti-Rassismus. Satire, wie sie das Leben schreibt.
Vielfalt auf dem Reißbrett entworfen
Wie das berühmte Sprichwort sagt: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“ Doch die Forscher der Universität Rostock schwingen den Vorschlaghammer und werfen in ihrer Untersuchung mit den größten Brocken, die sie finden können. Da wird munter codiert, sortiert und in Schubladen gesteckt, dass man sich fragt, ob wir nicht eine Zeitreise ins Kaiserreich gemacht haben.
Nehmen wir das Beispiel „Naher Osten/Türkei/Nordafrika“. Hier greift die Wissenschaft auf ihre schärfsten Werkzeuge zurück: „Schwarze Haare“, wird als Kennzeichen festgelegt. Schwarze Haare also – das Attribut, mit dem man, so suggeriert es die Studie, 500 Millionen Menschen zwischen Rabat und Teheran fein säuberlich voneinander abgrenzen kann. Der orientalische Kulturkreis schrumpft in diesem „Codebuch“ auf die Bedeutung einer Haarfarbe zusammen. Man könnte meinen, wir befinden uns im Casting für eine Shampoo-Werbung.
Noch skurriler wird es bei der Kategorie „Indigen“. Wie die Autoren der Studie auf die Idee gekommen sind, Maoris aus Neuseeland mit den Sinti und Roma aus Europa sowie den Samen aus Norwegen in einen Topf zu werfen, bleibt wohl ihr Geheimnis. Vielleicht dachten sie, es handele sich um eine besonders exotische Mischung, die den Farbenrausch der Diversität perfekt abrundet. Doch was für den unkritischen Beobachter wie eine kulturelle Vielfalt aussieht, ist in Wahrheit das Einmaleins der ethnozentristischen Ignoranz. Ja, eine indigene Gruppe aus Neuseeland hat natürlich die gleichen kulturellen Merkmale wie eine marginalisierte Minderheit aus Europa. Logisch, oder?
Der Mensch als Raster
Was diese Studie besonders köstlich macht, ist die unerschütterliche Ernsthaftigkeit, mit der sie vorgetragen wird. Hier haben wir Wissenschaftler, die sich tatsächlich die Mühe gemacht haben, visuelle Beispiele von Menschen unterschiedlichen Aussehens in eine Tabelle zu packen, um daraus „wissenschaftliche“ Schlüsse zu ziehen. Die Botschaft ist klar: Wenn du ein dunkelhäutiger Schauspieler bist, gehörst du in Kategorie X; wenn du weiße Haut und braune Haare hast, dann landest du in Kategorie Y.
Aber halt! Ist das nicht genau der Mechanismus, den wir als Gesellschaft hinter uns lassen wollten? Das Einteilen von Menschen nach Äußerlichkeiten, das Schubladisieren auf Basis biologischer Merkmale? Man könnte meinen, die Forscher hätten eine satirische Parodie auf ihre eigene Disziplin inszeniert. Denn anstatt Rassismus zu bekämpfen, befeuern sie ihn mit ihrem pseudowissenschaftlichen Ansatz. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet jene, die die Gleichheit vorantreiben wollen, auf solch plumpe Weise die Unterschiede betonen?
Die deutsche Schuldkomplex-Industrie
Natürlich lässt sich dieses Projekt nicht ohne das Phänomen der deutschen Schuldkomplex-Industrie verstehen. In einem Land, das historisch mit seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg und den Verbrechen des Holocaust hadert, haben sich einige Denker dem ultimativen Sühnekult verschrieben: der ewigen Selbstgeißelung. Dabei ist das Grundprinzip einfach: Je intensiver wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen, desto mehr Rassismus entdecken wir – selbst wenn wir dafür rassistische Kategorien neu erfinden müssen.
Und so ergibt es sich, dass das Institut für Medienforschung aus Rostock in seinem Feldzug gegen die Unterrepräsentation von Migranten und People of Color im deutschen Fernsehen genau jene Mechanismen benutzt, die es doch angeblich zerstören möchte. Der Gedanke dahinter? Vielleicht glaubt man, dass man den Feind besser verstehen muss, um ihn zu besiegen. Man könnte aber auch sagen: Wer lange genug in den Abgrund des Rassismus blickt, dem blickt der Rassismus irgendwann zurück.
Der Triumph des Bürokratischen über das Menschliche
In einer idealen Welt wäre Vielfalt etwas, das ganz organisch passiert – ohne Tabellen, ohne Codierungen, ohne die wissenschaftliche Vermessung von Augenformen und Hauttönen. Aber das reicht den Bürokraten der Diversität natürlich nicht. Hier wird Vielfalt auf dem Reißbrett entworfen, werden Menschen zu Rasterdaten und Kategorien degradiert. Kein Wunder, dass sich das deutsche Fernsehen am Ende so steril und künstlich anfühlt wie eine App für Steuererklärungen.
Es geht hier nicht mehr um Menschen, ihre Geschichten und ihre Kulturen. Es geht um Zahlen, Statistiken und visuelle Merkmale, die uns auf dem Weg zur „optimalen Repräsentation“ helfen sollen. Aber am Ende bleibt die entscheidende Frage: Ist das wirklich die Art von Vielfalt, die wir wollen? Eine Vielfalt, die aus Kategorien und Etiketten besteht, anstatt aus menschlicher Erfahrung und Authentizität?
Die Rückkehr der Schubladen
Was also bleibt uns nach dieser absurden Studie? Eine schmerzhafte Erkenntnis: In dem Bemühen, Rassismus zu bekämpfen, kann man sich so tief in den ideologischen Morast verirren, dass man selbst zu dem wird, was man zu bekämpfen vorgibt. Die Schubladen, in die wir Menschen einordnen, haben sich vielleicht verändert – sie tragen jetzt hippe Begriffe wie „PoC“, „Latinx“ und „Südasien“ – aber es bleibt dieselbe alte Rassenlehre, nur in neuem Gewand.
Das Institut für Medienforschung hat hier eine historische Leistung vollbracht: Es hat den Rassismus ins 21. Jahrhundert überführt und mit den Werkzeugen der Diversität so fest in die akademische Landschaft eingeschrieben, dass es nur schwer wieder zu entfernen ist. Man könnte fast applaudieren – wäre es nicht so traurig.
Quellen und weiterführende Links
- Said, Edward. Orientalism. Pantheon Books, 1978.
- Goldberg, David Theo. The Threat of Race: Reflections on Racial Neoliberalism. Wiley-Blackwell, 2009.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. Can the Subaltern Speak? Harvard University Press, 1988.
- Foucault, Michel. Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses. Suhrkamp Verlag, 1977.
- Ahmed, Sara. The Cultural Politics of Emotion. Routledge, 2004.
