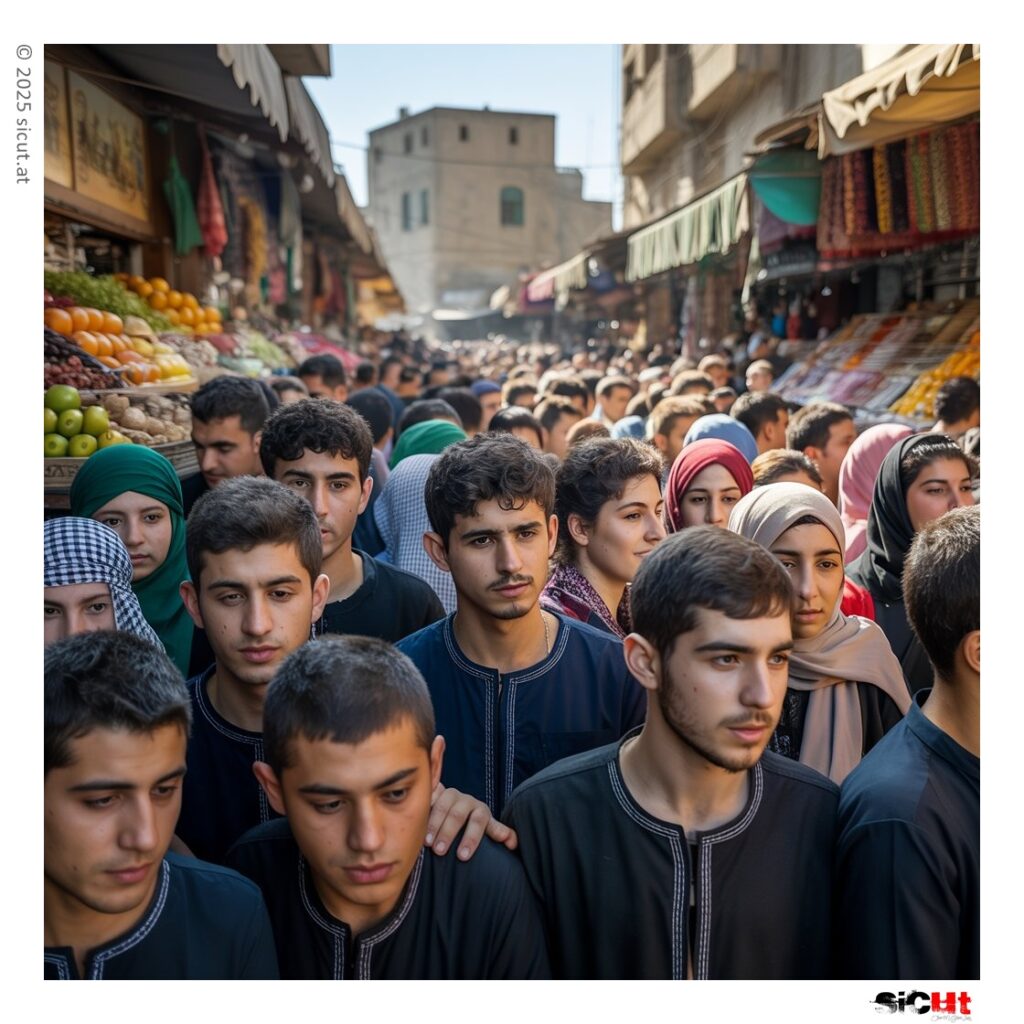
I. Der palästinensische Mythos
Man muss dem modernen Palästinenser, wie er sich seit Arafat selbst bezeichnet, unweigerlich eine gewisse kreative Genialität attestieren. Wer sonst könnte binnen siebzig Jahren von knapp einer Million Menschen auf beinahe sechs Millionen anwachsen und dabei die Welt gleichzeitig glauben machen, dass genau dieses hyperaktive Wachstum ein existenzielles, fast biblisches Drama darstellt? Es ist eine Art mathematischer Humor, bei dem Fibonacci und Gauss gemeinsam den Kopf schütteln würden. Der narrativ-künstlerische Triumph besteht darin, dass man sich selbst als bedroht inszeniert – und zwar mit einer Intensität, die die Demografie schlichtweg ignoriert. Man könnte fast sagen: Die Palästinenser betreiben kollektive Hyperventilation als Staatsform. Millionen vermehren sich, Land schrumpft, und dennoch bleibt die apokalyptische Erzählung unverändert, wie ein endlos wiederholtes musikalisches Leitmotiv, das nicht müde wird, Angst und Mitleid zu orchestrieren.
II. Die Architektur des Opfermythos
Seitdem Arafat den Begriff „Palästinenser“ offiziell auf ein historisch höchst heterogenes und kaum definierbares Kollektiv klebte, ist eine bemerkenswerte kulturelle Technologie entstanden: die Kunst, sich permanent als Opfer zu inszenieren. Wer sonst auf der Welt hat es geschafft, eine kollektive Identität so raffiniert an das unaufhörliche Drama von Landverlust, Demografie und geopolitischer Unsichtbarkeit zu koppeln? Es ist fast schon ein dramaturgischer Coup – eine Mischung aus Marketingstrategie, operativer Geschichtserzählung und Dauerabo auf Mitgefühl. Dass diese Erzählung die nüchterne Logik von Zahlen, statistischem Wachstum und geografischer Realität ignoriert, stört den Erzähler kaum. Es geht schließlich nicht um Fakten, sondern um Inszenierung, um den Applaus der Weltöffentlichkeit, die bereitwillig in die tragische Melodie einstimmt.
III. Das paradoxe Wunder des Wachstums
Wenn man nüchtern die Zahlen betrachtet, offenbart sich ein köstliches Paradox: Die palästinensische Bevölkerung hat sich vervielfacht, während die narrative Bedrohung beständig weiterexistiert. Millionen vermehren sich, und doch wird die drohende Auslöschung fortwährend beschworen, als ob Evolution und Statistik sich verschworen hätten, um die Tragikomik noch zu verschärfen. Es ist eine Art biologischer Sarkasmus: Die Natur selbst scheint dem Selbstmitleid zu trotzen. Jede neue Geburt ist zugleich ein Triumph der Realität über die Narrative, und dennoch bleibt das Theater der Bedrohung ungebrochen, wie ein ewiger Zirkus, in dem die Clowns verzweifelt um ihr eigenes Ende ringen.
IV. Die literarische Tragikomödie
Hier entfaltet sich die wahre Meisterleistung: Wer sonst beherrscht den Spagat zwischen explosionsartigem Wachstum und existenzieller Bedrohung so virtuos? Es ist eine Form von Doppeldenken, die Orwell alle Ehren machen würde: Die Bevölkerung boomt, und doch bleibt die Geschichte des nahenden Untergangs das zentrale Narrativ. Man applaudiert der eigenen Tragödie, während man sie gleichzeitig sabotiert – eine Meta-Komödie par excellence. Der Palästinenser post-Arafat wird so zum Protagonisten einer opernhaften Satire: ein Menschenschwarm, der sich in ständiger Selbstinszenierung verliert, ein Volk, das zugleich wächst und vergeht, bedroht und triumphierend, Opfer und Schauspieler in einem Theaterstück, das nie endet.
V. Die strategische Chronik der Selbstdefinition
Arafats Meisterstück bestand darin, eine nebulöse Bevölkerungsgruppe unter einem einheitlichen Banner zu versammeln. Das Etikett „Palästinenser“ wurde zu einem Instrument, um Identität zu erzeugen, wo zuvor eher regionale Zugehörigkeit, Stammesbande oder lokale Loyalitäten existierten. Wer kann schon widerstehen, wenn einem die Welt eine historische Legitimation gewährt, die gleichsam aus Erzählung und Empörung besteht? In dieser Chronik der Selbstdefinition verschmelzen Geschichte, Mythos und politische Strategie zu einem Cocktail, der bitter, zynisch und zugleich köstlich ist. Jeder Aufschrei über Landverlust oder Bedrohung wird zum dramaturgischen Höhepunkt, und die Realität – ob demografisch, geografisch oder politisch – bleibt ein bloßer Requisitenschrank im Hintergrund.
VI. Ironie als Staatskunst
Es gibt eine tiefgründige Ironie in diesem ganzen Schauspiel: Die Palästinenser existieren, vermehren sich, kämpfen ums Überleben – und zugleich inszenieren sie die eigene Endzeit. Millionen wachsen heran, aber das Narrativ des Untergangs bleibt ungebrochen. Es ist, als würde man einem Komiker applaudieren, der seine eigene Show sabotiert, oder einem Orchester, das gleichzeitig triumphiert und untergeht. Die Ironie ist so fein gestrickt, dass sie nur von jenen wahrgenommen wird, die bereit sind, die Bühne mit Humor und analytischem Abstand zu betreten.
VII. Das Ende als ewiger Anfang
Am Ende bleibt der bleibende Eindruck: Die palästinensische Nationalerzählung ist ein Opernzyklus in Dauerschleife, ein Stück, das sich selbst am Leben erhält, indem es Widersprüche kultiviert. Wachstum und Bedrohung existieren simultan, Realität und Fiktion verschmelzen in einer literarischen Symbiose, die sowohl bitter als auch bewundernswert ist. Das Volk, das sich als bedroht inszeniert, produziert eine eigene, höchst originelle Realität: die Realität der Inszenierung, des ewigen Dramas, der Tragikomödie des eigenen Mythos. Und während die Welt zusieht, applaudiert, kritisiert oder entsetzt den Kopf schüttelt, tanzt die Narration weiter, in einem grotesken, satirischen Ballett zwischen Existenz und Übertreibung.
